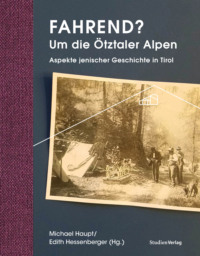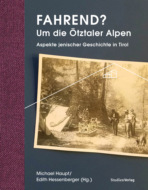Kitabı oku: «Fahrend? Um die Ötztaler Alpen», sayfa 4
Das Fallbeispiel Stanzertal
Besonders gut dokumentiert ist die Geschichte der Jenischen im Stanzertal, einem westlichen Seitental des Oberinntales zwischen Stanz und St. Anton am Arlberg. Die ohnehin schon schwierige naturgeographische Ausgangslage hatte sich dort noch durch die „Kleine Eiszeit“ (zweite Hälfte des 13. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts), die einer mittelalterlichen Warmperiode folgte und in ihrer Hauptphase vom 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts durch Gletscherhochstände gekennzeichnet war, verschärft.24 Die durchschnittlichen Temperaturen lagen nahezu ein Grad unter jenen der Gegenwart und haben zu deutlichen Ernterückgängen geführt. Die wachsende Bevölkerung hatte nun mit äußerst ungünstigen Witterungsbedingungen zu kämpfen. Die Korrespondenz des Stamser Zisterzienserklosters aus den 1660er Jahren zeugt von außerordentlich schlechten Ernten; aufgrund der fehlenden Mittel konnten keine Ordensbrüder mehr aufgenommen werden.25 Für das Frühjahr 1692 ist aus dem Unterengadin überliefert, dass zahlreiche Arme wie das Vieh Gras aßen oder sich mit gesottenen Kräutern ihren Magen verdarben.26
Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges (1648) und im Gefolge der Reunionskriege in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zogen deshalb aus dem Oberland Jahr für Jahr tausende Männer auf Saisonarbeit in die zerstörten Gebiete nördlich der Alpen, im 19. Jahrhundert dann immer häufiger in die Schweiz. Selbst im Jahr 1868 wurden aus dem „Oberinntal, Paznaun und Stanzertal“ 3.000 Männer gemeldet, die Jahr für Jahr in die Fremde zogen.27 Trotz dieser sehr mobilen, im bäuerlichen Milieu verwurzelten Gesellschaft gab es aber ein durch Mobilität bedingtes Außenseitertum marginalisierter Gruppen, in der wichtigsten Quelle der Kirchenbücher lange Zeit als „Vagabundus“, „Vagus“ oder „Vagi“ bezeichnet. Dieser Umstand wurde auch immer wieder im Landtag thematisiert. So verwies z. B. in der Sitzung vom 5. Oktober 1868 der Südtiroler Landtagsabgeordnete Anton Kemenater darauf, dass „in jenen Gegenden, wo die schrankenlose Zerstückelung des Grundes und Bodens existiert“, die größte Armut herrsche und sich das „Proletariat mit dem Vagabundenwesen“ einstelle, wie im Oberinntal und im Vinschgau mit den sogenannten „Lahningern“ und „Dörchern“.28
Anteil der Landfahrerkinder an der Gesamtzahl der Geburten im Stanzertal29
| Zeitraum | Landfahrerkinder | Anteil % |
| Bis 1650 | 2 | - |
| 1651–1700 | 33 | 0,5 |
| 1701–1750 | 52 | 0,7 |
| 1751–1800 | 107 | 1,4 |
| 1801–1850 | 62 | 0,8 |
Die ersten Jenischen, die sich nachweisbar über einen längeren Zeitraum hinweg im Stanzertal aufhielten, waren Peter Freiseisen und seine Gattin Maria Farcherin30, „sich überall herumtreibende Vagabunden“. Im Taufbuch von Grins sind zwischen 1653 und 1660 die Geburten von vier Kindern verzeichnet.31 Jakob, einer der Söhne, wird mit seiner Gattin Elisabeth Gartzangerin im Jahr 1681 als „Khramer folkh“, angesiedelt in Strengen, genannt.32 Sein Bruder Johannes, geboren in Stams, heiratete im Jahr 1672 in Stanz Anna Brenngruber aus Laas.33 Erst im Jahr 1752 taucht dann in den Unterlagen ein Felix Freiseisen auf, der mit Theresia Jäger verheiratet war und aus Telfs stammte. Er starb 1802 in Quadratsch (Gemeinde Pians), „wo er sich meistentheils aufhielt.“34
Sein Sohn Johann Anton heiratete im Jahr 1785 in Pettneu Magdalena Seitz aus Prad.35 Ihr Sohn Anton unternahm als Geschirrhändler weite Fahrten und verehelichte sich 1839 in Varaždin (Kroatien) mit Anna Maria König aus Grins. Aufgrund der Geburts- und Sterbeorte der Kinder sind Aufenthalte in Grins, Dalaas, Lustenau und Matrei am Brenner nachgewiesen.36 Oft blieb das Heimatrecht, das man durch seine Abstammung erworben hatte, das einzige Band, das die Jenischen mit einem bestimmten Ort verknüpfte. Von den elf Kindern der Veronika Freiseisen, einer Tochter des Anton, sind nur zwei in Pettneu zur Welt gekommen, die übrigen wurden im mittleren Inntal geboren oder sind dort schon in frühester Kindheit verstorben. Als Vater wird nur in einem Fall Jakob Glatz aus Mötz genannt.37
Die Gegenwartsüberlieferung hat wie in Schönwies auch für Pettneu die Wurzeln der jenischen Familien Freiseisen, Lei und Gabelon darauf zurückgeführt, dass Landfahrer für einheimische Bessergestellte Militärdienst leisteten, sich aber ausbedungen hätten, im Gegenzug von der Gemeinde Wohn- und Heimatrecht zu erhalten.38 Besonders nachhaltig in Erinnerung blieb einem betagten Zeitzeugen der im Jahr 1870 in Roppen geborene Jenische Leonhard Gabelon, ein Sohn des Pfannenflickers Alois Gabelon und der Maria Anna Falatina.39 Der Korbflechter heiratete 1898 in Vilpian die in Winnebach gebürtige Maria Tschaup.40
Der Zeitzeuge41 erinnert sich an Erzählungen, Leonhard habe der Gemeinde Pettneu gedroht, dass er mit der Frau „einfach so“ zusammenleben werde, wenn er nicht heiraten dürfe. Als Pfarrer Johann Weber dann doch endlich das Aufgebot in Pettneu bekanntgab, habe er von der Kanzel verkündet: „Zum Sakrament der Ehe haben sich entschlossen: Leonhard Gabelon, Korbflechter und Dörcher von Pettneu.“ Leonhard sei danach zum Pfarrer gegangen und habe sich furchtbar über diese despektierliche Bezeichnung aufgeregt.
Als er noch weniger Kinder hatte, sei er mit seinem Karren mehr auf den Straßen unterwegs gewesen. Er stellte vor allem Besen und Körbe her, letztere für das Auftragen der abgeschwemmten Erde auf die steilen Hänge im Frühjahr und für das Tragen von Holz, und wurde vor allem mit Lebensmitteln bezahlt. Kurze Zeit arbeitete er auf der Bahn, dort habe es ihm aber nicht gefallen, weil er in der Früh länger schlafen wollte. An einem drückend heißen Tag sei er im Schatten unter einem Baum gelegen, während die Bauern schwitzend ihr Heu einbrachten. Als ihn einer ansprach: „So schian wie du mecht I’s ah hoben!“, sei seine Erwiderung gewesen: „I schiss dr auf d’Ormut, wenns mar nit besser gang wie dir!“42 Wenn er im Winter Holz brauchte, sei er einfach Erlen schlagen gegangen, während die Bauern natürlich für diese Jahreszeit Vorsorge getroffen hätten.
Da der Weg am Wohnzimmer von Haus Nr. 10 in Garnen vorbeiführte, habe man die Steigen mit den eingefangenen Vögeln bewundern können, Leonhard habe Kontakte zu den Imster Vogelhändlern unterhalten. Seppl, ein Bub, hätte einmal eine Amsel gefangen und liebevoll abgerichtet: Zum Gaudium der Dorfbewohner habe sie den ganzen Tag „O du lieber Augustin“ gepfiffen. Bis sie dann aber eines schönen Tages von einer Katze erwischt wurde, die der Seppl dann auch gleich erschlagen habe. Im Erdgeschoß dieses Hauses wohnte die Jenischenfamilie Lei, der man seitens der Gemeinde das Essen vorbeibringen musste. Ansonsten galt im Ort die Regelung: Wer nicht mehr arbeiten konnte und nicht von den Kindern versorgt wurde, ging von Haus zu Haus auf Kost.
„Nazl“, der Bruder von Leonhard, habe 21 Kinder mit seiner Frau Gretl gehabt. Einmal wurde beobachtet, wie sie in einem Pillen43 ein Kind auf die Welt brachte. Sie ging zum nächsten Bauern und bat „um ein Lackele Milch für das Kind.“ Sie habe auch öfters glaubhaft erklärt: „Für einen Wecken Brot würde ich jederzeit ein Kind auf die Welt bringen, so leicht ist das!“ Fast alle Kinder wurden bei anderen Familien in Pflege gegeben. Nazl fand kurz als Straßenarbeiter Beschäftigung, landete später beim Militär und erhielt im Ersten Weltkrieg eine Kriegsauszeichnung. Für die Ortsgröße Postmeister Geiger, der einrücken musste, sei es eine Demütigung gewesen, ausgerechnet „vom Nazl abgerichtet zu werden.“ Die vielen Kinder seien verschwunden, etliche gefallen.

Abb. 5: Schirmemacher und Pfannenflicker aus Tirol
Der Pfannenflicker Seppl Freiseisen hauste in einem elenden Verschlag aus Steinen, Kasten und Tür im Pettneuer Ortsteil Reith. Er sei ein feiner Mensch gewesen, habe aber viel Schnaps getrunken. Im vorgerückten Alter habe er sehr schlecht gesehen und die Pfannen nur mehr neben dem Lock geflickt. Immer wieder habe er Hunde und Katzen verschwinden lassen, lebend in einen Sack gesteckt, geschlachtet und dann gegessen. Katzenfleisch schmecke gut, wie Hasen, Hundefleisch sei aber schlecht, habe gestunken und wäre nur mit vielen Kräutern als Würze genießbar. Seppl starb noch vor dem Krieg, „der Hitler hätte ihn glei aso …“.

Abb. 6: Rudolf Wenzel, genannt „Rudl Vater“, ca. 1950. Er übte das Korbflechtergewerbe aus und zog mit seinem Karren bis nach Bludenz. Seine Körbe waren bei der bäuerlichen Bevölkerung sehr begehrt.
Was den Gottesdienst betrifft, habe es in Pettneu geheißen: „Am Heiligen Abend gehen alle Dörcher!“ Ansonsten habe man sie das ganze Jahr nicht in der Kirche gesehen.
Bei vielen Jenischen war ein von der Institution Kirche unabhängiger privat praktizierter Glaube verankert. Die schwierigen Lebensumstände wurden religiös reflektiert und Sinn, Rechtfertigung und Schutz auf der persönlichen Ebene gesucht. Dies bringt auch noch in den 1980er-Jahren ein jüngerer Jenischer im Feature von Bert Breit auf den Punkt:
Ich sage jetzt so, dass die Religion liegt in jedem Mensch selber, der eine läuft jeden Tag in die Kirche und speisen und beichten und wenn er von der Kirche herauskommt, dann schimpfen sie über andere Leute. Ist das für mich eine Religion? Ich habe auch einen Glauben und ich tu auch, wenn ich am Abend beten will, dann bete ich am Abend, aber mir hat der Herrgott noch kein Stückl Brot gegeben, wofür soll ich da beten, in die Kirche laufen, Modenschau machen? Nein. Schau, ich bin jahrelang in die Kirche hineingeprügelt worden von meinen eigenen Leuten und von den Bauern, wo ich aufgewachsen bin, musste ministrieren und wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich meine Fotzen bekommen. Religion liegt am Mensch selber.44
Ökonomischer Wandel
Industrialisierung und die Erschließung durch Bahnlinien entzogen den Jenischen einen Teil ihrer bisherigen Existenzgrundlage, die Zahl der Fahrenden ging zurück. In den Zeitungen wurde nach der Jahrhundertwende nahezu nostalgisch auf das Leben soeben verstorbener jenischer Originale zurückgeblickt:
Die „Steirerkatl“ Katharina Monz starb 1907 in Mötz nach „Abschluss eines abenteuerlichen Lebens“. Die gebürtige Steirerin war nach St. Leonhard im Passeier zuständig:
Nach Dörcherart wechselte sie Dörfer und Länder; fehlte ein Quartier, so wurde mit dem Anhang im Freien kampiert. So wird erzählt, dass sie drei Winter in der Höhle auf der Martinswand zugebracht habe. Auch in der sogenannten Streichenhöhle oberhalb Mötz hauste sie, und, weil die Dorfjugend sie plagte, übersiedelte sie im Winter in die sogenannte Lag bei Silz. 45
Ebenfalls in Mötz verstarb am Neujahrstag 1909 im Gemeindearmenhaus mit Gottlieb Glatz der „letzte seiner Gattung“ im Alter von 76 Jahren. Er
handelte mit Hunden und Vögeln und flickte alles, was zerrissen war […]. Wegen seiner drolligen Einfälle und ulkigen Streiche war er bei Jung und Alt beliebt. […] Mit ihm verschwand der Typus der Laninger, wie ihn kein Schönherr charakteristischer auf die Bühne bringen könnte.46
Größere Teile der Bevölkerung hatten nun nur mehr wenig oder gar keinen Kontakt mehr mit den Landfahrern. Informationen über die Jenischen entnahmen sie daher vor allem den Medien, während die Sesshaften früher durchaus ein differenzierteres Bild vom nichtsesshaften Leben gehabt hatten. Die Berichte der Tiroler Zeitungen sind fast durchwegs negativ und vermitteln das Bild von rauflustigen und streitsüchtigen Menschen, die ständig in Konflikt mit der Obrigkeit geraten. Außenstehende sollten sich vor ihrer Gewalttätigkeit, ihren Betrügereien und ihrer Rache in Acht nehmen.47
Ganz typisch ist zum Beispiel ein Bericht vom christlichsozialen Tiroler Anzeiger über einen Streit „unter Karrnern“ in der Imster Oberstadt am 7. September 1935. Josef Winkler aus Mieming und Klement Monz aus Reith bei Seefeld hatten gemeinsam in einigen Wirtshäusern gezecht. Im Gefolge eines Streits durchstach Monz mit einem Messer die linke Wange von Winkler und verletzte diesen zudem hinter dem Ohr. Auch er selbst erlitt im Zuge der Rauferei eine Verletzung und schoss sich schließlich mit einem Trommelrevolver durch den linken Handteller. Beide Beteiligten wurden dem Gericht übermittelt.48
Die Zeitungsberichte sollten das Bild, das sich viele Bürger von den Jenischen machten, prägen: „Jenische sind zwanghafte Gewalttäter und Diebe.“
Etwas einfühlsamer informierte zum Teil die sozialdemokratische Volks-Zeitung, der wir auch den Bericht über einen bemerkenswerten Fall verdanken:
Am 21. November 1929 hatte der Jenische Alfons Monz mit seiner hochschwangeren Frau in einem Gasthaus in Reith bei Seefeld gezecht. Das Nachtquartier wurde ihnen aber verweigert, der Fahrende warf einen Bierstutzen nach dem die Sperrstunde verkündenden Gendarmen. Der Beamte zog daraufhin den Säbel und brachte das Paar in ein Stallloch. Im Jänner 1930 wurde Monz durch einen Schöffensenat des Innsbrucker Landesgerichts zu sechs Wochen schwerem verschärftem Kerker verurteilt.
Der Verteidiger brachte für seinen Mandaten folgende Argumente vor:
Vor Jahrhunderten zwang die Not Tiroler Landsleute zum Herumziehen – und sie wurden mit der Zeit zu dem, als was wir sie heute kennen: Karner! Dem Karnerwesen könnte man wohl abhelfen, indem man die Karner sesshaft macht. Ihre Ahnen waren ja einst alle sesshaft. Statt dem verachtet man sie aber. Der Angeklagte hat nicht einmal in seiner Heimat mit seiner schwangeren Gattin ein Obdach erhalten! […] Auch Karner sind Menschen! 49

Abb. 7: Anna und Josef Haslacher, ca. 1965 am Pillersee. Nach getaner Arbeit spielte Josef auf der Ziehharmonika, die er ausgezeichnet beherrschte.
Nationalsozialismus
In der NS-Zeit wurde Friedrich Stumpfl im Mai 1939 auf die Professur für Erb- und Rassenbiologie der Universität Innsbruck berufen. Armand Mergen unterstützte ihn bei seinen Untersuchungen an den „Karrnern“. Nach dem Krieg traten sie als deren Retter auf. Tatsächlich waren aber die Vorarbeiten der Nationalsozialisten schon weit gediehen, um jederzeit eine flächendeckende Vernichtungswelle einleiten zu können.50 Die Lehrerin Maria Spiss erzählt, dass sie im Jahr 1940 beauftragt worden ist, im Sommer in Haiming Erhebungen anzustellen. Alle jenischen Familien mussten ihr die Vorfahren bis zu den Großeltern zurück anführen, so wie das alte Mariele:
Eine alte Frau, die hat so lange Pfeifen geraucht, die hat sich mit ihren Ersparnissen ein Häuschen gebaut, ein nettes Haus. Die ist damals schon alt gewesen, wie ich diese Aufnahmen gemacht habe. […] Auf meine Frage, wo die Kinder auf die Welt gekommen sind, hat sie gesagt, dass sie von München bis nach Rom gekommen ist. […] Die hat die Namen alle gewusst, aber die Geburtstage hat sie nicht gewusst: „Jo, des woaß i nimma!“, hat sie gesagt. 51
Ein älterer Jenischer aus dem Oberland erinnerte sich bei Bert Breit noch in den 1980er-Jahren:
Wir haben schon gewusst, dass es uns Jenische auch putzt. Wir haben ja eine Verschnaufpause gehabt, weil man viel Arbeit mit den Juden und den Zigeunern gehabt hat. Da haben wir eine längere Lebensdauer bekommen, eine Gnadenfrist will man sagen. Das haben wir aber gewusst. […] Das war ja ein ausgesprochener Diktaturstaat und wenn du nicht genau spurst, wie es ihnen passt, dann warst du außer ihrer Gesellschaft gestellt und das hat dann bedeutet einsperren, Strafkompanien, Zuchthaus wegen einer Kleinigkeit, KZ, politisch unzuverlässig, wehrunwürdig usw. … 52
Die nationalsozialistischen Gruppenetiketten wie „Arbeitsscheue“, „asoziale Elemente“, „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“ bedrohten auch Jenische. Opfer der „Euthanasie“ wurde zum Beispiel der nach Pettneu zuständige Hermann Freiseisen, der im Alter von 39 Jahren am 10. Dezember 1940 nach Schloss Hartheim in Oberösterreich deportiert wurde.53 Ein Zeitzeuge erzählt von einem sozial handelnden Arzt, der eine jenische Familie vor einem schlimmen Schicksal bewahrte:
Ich weiß nur von einem in Zirl, der hat „Monzen Peter“ geheißen, den hat der Zirler Arzt, der Doktor Pfurtscheller, der Gemeindearzt, hat ihn während und nach dem Krieg, hat er den als Kutscher hergenommen. Der hat ein Rössl gehabt und der hat ihm dann ein paar Schilling dafür gegeben, dass er ihn zu den Patienten gebracht hat. Der Pfurtscheller der hat keinen Menschen leiden sehen können. Während der Nazizeit hat auch er ihn und seine Familie gedeckt. Sie wären weggekommen, ob ins KZ das weiß ich nicht, aber sie wären weggekommen und das hat der Doktor Pfurtscheller immer versucht zu verhindern. 54

Abb. 8: Die Eltern von Alois Lucke mit drei ihrer Kinder hinter dem Soldatenfriedhof in Amras, ca. 1946
Letztlich versetzten die Nationalsozialisten den Landfahrern in Tirol den Todesstoß: Jene Jenischen, die nicht in Lagern verschwanden, wurden sesshaft.
Weiterhin am Rand der Gesellschaft
Auch nach dem Ende des Krieges änderte sich an der Außenseiterposition nichts. Selbst auf universitärem Boden dominierten bis Anfang der 1980er-Jahre nach wie vor erbund rassebiologische Denk- und Argumentationsschemata. Nichtbürgerliches oder von den strengen Normen der katholischen Kirche abweichendes Verhalten wurde pathologisiert. In den Schulen, Gerichten und Fürsorgeeinrichtungen agierten von der NS-Zeit geprägte Beamte, die häufig sogar Parteimitglieder gewesen waren.
Die jenischen Kinder saßen in der Schule auch noch in den 50er-Jahren in einer eigenen Bank entweder ganz vorne oder ganz hinten, wie eine Zeitzeugin aus Nassereith erzählt:
Man hat sie nicht beachtet, auch nicht der Lehrer, das ist mir heute so bewusst. Es war egal, ob sie da waren oder nicht! […] Zuerst hatten sie von der Gemeinde eine Wohnung im alten Schulhaus. Später bekamen sie am Ende des Dorfes einen Bauplatz. Der Platz war außerhalb der Siedlung, also noch weiter weg vom Dorf. […] Der Mann war als Hilfs- bzw. als Gelegenheitsarbeiter tätig. 55
In kinderreichen jenischen Familien wurde weiterhin wie z. B. in Haiming ein Teil der Kinder zu Pflegeeltern gegeben. Diese kamen dort immer im Februar auf das Gemeindeamt, um dafür das Pflegegeld zu kassieren.56 Dabei konnte man Glück oder Pech haben, wie der Fall eines Jenischen vor Augen führt:
Mit acht Wochen hat man mich verschenkt wie einen kleinen Hund, meine richtigen Eltern. Meine Ziehmutter ist zu meinem Vater eine Schwester. So wie sie mir erzählt haben, haben sie mich mit acht Wochen angenommen. Bei mir sind im Kinderbettstattl die Würm aus dem Buckel herausgekrochen, so sauber bin ich gewesen. Die Ziehmutter hat mir erzählt, dass man mich zwei Jahre hindurch hochpäppeln hat müssen. […] Die Mutter ist mit die Strümpfe und mit diesen Sachen hausieren gegangen. Der Ziehvater hat Körbe gemacht. Dann haben beide eine Linke gedreht und dann haben sie beide eingesperrt. Mich hat man dann wieder geschoben, zu meinen richtigen Eltern. Da haben sie gesehen, dass man da wieder eine Kinderbeihilfe kassieren kann. Hiaten57 geht er auch, weil dem Trottel nehmen wir das Geld eh ab, aber dass ich schlauer war als die alle miteinander, das haben sie vergessen und so bin ich hin- und hergewandert. […] Bis zum 21. Lebensjahr war das so, bis kurz vor dem Einrücken. Beim Bundesheer bin ich dann schlauer geworden. Dann habe ich gesagt, dass sie von mir nichts mehr bekommen. 58
Der Zeitzeuge Franz Götsch, in der Gemeindepolitik von Haiming zwischen 1946 und 1986 aktiv, konnte sich bei einem Gespräch im Jahr 1999 noch besonders gut an das Lisele erinnern, die in Haiming Vorsitzende der Kommunistischen Partei war. „Die Lisl war eine rasante Frau. Ich habe sie nicht ungern mögen, weil sie aufrichtig war. […] Mit der Lisl habe ich viele Auseinandersetzungen, aber nicht im bösen Sinn gehabt, sondern eigentlich …“59. Viele Jenische seien in Magerbach geblieben:
Da ist immer die Sonne gewesen, das ist ein bevorzugtes Platzl von denen gewesen, von den Karrnern. […] Auf dem Nikolausmarkt haben die Kastanien gebraten zum Verkaufen und die Glatzen Rosl ist hochschwanger gewesen […]. Dann ist sie heimwärts gegangen, dann hat sie noch einen Pudel Schnaps getrunken. Dann sind sie heimgekommen, hat ein Kind geboren und am nächsten Tag ist sie auf dem Markt gestanden und hat wieder Kastanien verkauft. 60
Die letzten Behausungen der Jenischen in Magerbach seien im Zuge des Autobahnbaus abgerissen worden. Er wisse schon noch, wer im Ort eigentlich jenischer Abstammung sei, aber: „Das darfst du in Haiming heute gar nicht mehr sagen. Die haben sich heute schon alle akklimatisiert.“61
Karl Schatz, ein weiterer Gesprächspartner im Jahr 1999, führte Anfang der 1970er-Jahre mit einer Theatergruppe das Stück „Die Karrnerleut“ von Karl Schönherr auf. Man habe damals schon gesehen, dass die Zahl der Jenischen stark zurückging. Es seien Gesetze beschlossen worden, die es verunmöglichten, dass Mütter mit ihren Kindern einfach in andere Gemeinden abgeschoben werden konnten. Als Vorbereitung auf das Stück hielt er sich drei Monate lang im Sommer jeden Tag von 17 bis 22 Uhr bei Jenischen auf, die am Inn zwischen Inzing und Zirl ein Zelt aufgeschlagen hatten und Holzkörbe und Ruckkörbe flochten sowie Besen banden.
Ich weiß es nur so von den 60er-Jahren. Da haben sie fünf Schilling für so einen Korb bekommen und im Geschäft hättest du 50 Schilling bezahlt. Für mich ist so etwas beschämend. Von denen habe ich seinerzeit eine Wiege bauen lassen. Die hat damals 150 Schilling in den 70er-Jahren gekostet. Im Kaufhaus hätte dieselbe Wiege 600 Schilling gekostet. […] Lorenz war der Familienname. Das waren insgesamt vier Leute. Er, seine Frau, zwei Kinder und vier Hunde. Die werden halt mit der Zeit aufgegessen. Die gibt es heute nicht mehr. Die sind schon gestorben. Die Kinder sind verzogen. So wie damals, das gibt es nicht mehr, dass sie so wild hausen dürfen, zumindest nicht im Inntal. Die Behörde ist da schon dahinter. Wenn sie länger in der Gemeinde angesiedelt waren, dann haben sie von ihr Notunterkünfte zur Verfügung gestellt bekommen. 62
Die Pfannen wurden von den Jenischen im Inn gewaschen, sie hätten sehr viel Alkohol getrunken: „Sie sind gerne angeheitert, als möchten sie ihr Dasein leicht ertränken. Das ist mir auch bei denen aufgefallen, dass sie täglich ihren leichten Spiegel gehabt haben.“63 Der Speiseplan war sehr karg:
Bei denen gibt es kein Schnitzel. Wenn es Fleischgerichte gibt, sind es Bratln. Wenn sie einen Raben fangen, dann wird eben der als Hendl gegessen. Wenn ein Hund Junge bekommt, dann wird der alte verrammt, als Bratl. (…) Wo ich bei ihnen war, da hat es einen Hasen gegeben, ob es ein Hase oder ein Dachhase war wie man so schön sagt, also eine Katze, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es eher eine Katze war oder sie haben eben mit der Schlingen einen Hasen gefangen. Dazumal gab es in den Innauen schon noch solche Tiere. Das ist jetzt alles durch die Autobahn zurückgedrängt worden. Hauptsächlich war es eben was Gestohlenes, wie Erdäpfel, die sie eben ausgegraben haben, Türkenkolben und so weiter. 64
Untereinander verwendeten sie das Wort „Dörcher“ als Schimpfwort, z. B. „Du verfluchter Dörcher du!“, „Du Schweindörcher!“ oder „So ein dreckiger Dörcher!“, niemals aber das Wort „Karrner“.
Die Solidarität der meisten Bauern gegenüber den Armen in der Gesellschaft habe sich in sehr engen Grenzen gehalten:
Ich weiß zum Beispiel von Zirl, Erdäpfel herausnehmen und die Gagl, das waren die kleinen Erdäpfel, die für die Schweine, und manche sind dann eben noch in der Erde geblieben und da gab es Leute, die auf die Felder nachpecken gegangen sind, eben dass sie etwas zum Essen hatten. Ich weiß das von vielen Bauern, die lieber die Erdäpfel in der Erde haben wollten, als dass sie ihnen erlaubt haben, diese Winzlinge herauszuarbeiten. Die haben lieber das Obst auf dem Boden verfaulen lassen, bevor sie einem Kind etwas über den Gartenzaun hinausgereicht hätten. Das war der Geiz. Von mir ein Onkel, das war ein Großbauer, der hat einen Traktor noch mit einem Schwungrad gehabt. Den haben einmal die Gendarmen aufgehalten, weil ein Licht nicht funktioniert hat. Dann hat er sich vor den Gendarmen niedergekniet und hat gesagt, dass er ein armer Bauer ist und dass man einen so armen Bauern doch nicht strafen kann. Die Strafe wären 5 Schilling gewesen. Dann haben sie ihn gehen lassen. Das musst du erst einmal zusammenbringen, dass du dich als Großbauer, mit 30 Stück Vieh im Stall vor der Polizei niederkniest, damit sie dir 5 Schilling Strafe erlassen. 65
Bert Breit besuchte in den 1980er-Jahren auch die jenische Familie Mungenast in Zams. Die in bitterster Armut in einer kleinen Hütte lebende Familie war eigentlich nur vom Kapuzinerpater Ludwig vom Kloster in Landeck-Perjen regelmäßig unterstützt worden, der neben Essbarem auch immer wieder Kerzen vorbeibrachte:
Wir sind froh gewesen um diese Kerzen. Man muss aber auch sagen, dass das kalte Winter waren. Ich kann mich erinnern, dass der Vater die Wasserkübel oben auf dem Wasserbankerl gehabt hat, da haben wir den alten Eisenherd geheizt, die ganze Nacht. Die halbe Nacht hat der Vater geheizt und die andere halbe Nacht habe ich geheizt und in der Früh war das Wasser in die Kübel gefroren, so eine Hütte war das. 66

Abb. 9: Die „jenische Musikgruppe Haslacher“ beim Gelände hinter dem Pradler Friedhof. Josef Haslacher (Ziehharmonika), der Vater von Alois Lucke, Franz Haslacher (Gitarre), ca. 1930
Wer von Kindheit an wandern musste, wollte sich ein Stück Freiheit bewahren und verzichtete auch zu diesem Zeitpunkt noch auf eine Wohnung von der Gemeinde, wie ein anderer Jenischer erzählte:
Sicher, andere fühlen sich in einer Gemeinschaft drinnen wohl, aber ich möchte in einem Parteienhaus nicht einmal einigmolen sein, auch nicht wenn ich die Wohnung umsonst bekommen würde. Jenisch, wenn du heute etwas auf dich selber gibst, dann möchtest du allein sein. Mir ist eine Baracke ohne Strom lieber als das schönste Miethaus. Da herinnen kann ich hupfen, tanzen und wenn ich mit dem Schädel da oben am Dachboden ein paar Mal anschlage, dann regt sich keine Sau auf. Wenn du dich in der Küche ein paar Mal schneller umdrehst wird schon geschrien. 67
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.