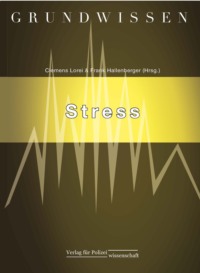Kitabı oku: «Grundwissen Stress», sayfa 7
62 Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2011). Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE. Poster. Bonn: DGE.
63 Zulley, J. (2008). So schlafen Sie gut. München: Zabert Sandmann.
64 Schommer, N. & Hellhammer, D. (2003). Psychobiologische Beiträge zum Verständnis stressbezogener Erkrankungen. In: H. Reinecker (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie. Modelle psychischer Störungen. 62-72. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
65 a. a. O.
66 Rutenfranz, J. & Knauth, P. (1982). Schichtarbeit und Nachtarbeit. Probleme, Formen, Empfehlungen. München: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung.
67 Wirtz, A. (2010). Gesundheitliche und soziale Auswirkungen langer Arbeitszeiten. Dortmund, Berlin, Dresden: BauA.
68 Nollmann, A. (2009). Stress bei Schichtarbeit. München: Grin.
69 Techniker Krankenkasse (2005). Gesund bleiben mit Schichtarbeit. Informationen für Mitarbeiter und Führungskräfte. Hamburg: Techniker Krankenkasse.
70 a. a. O.
71 Hofmeister, M. (2010). Der Vergleich vom Dreischichtdienst gegenüber dem Einsatz im Zweischichtdienst mit Dauernachtwachen unter sozialen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. München: Grin.
72 a. a. O.
73 Janke, W., Erdmann, G. & Kallus, W. (1985). Der Streßverarbeitungsfragebogen (SVF). Handanweisung. Göttingen: Hogrefe.
Stress & Leistung
Clemens Lorei
Prof. Dr. rer. nat,. Dipl.-Psych., Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung
Vorbemerkung
Für die Stress-Leistungs-Beziehung kann festgestellt werden: Stress ändert Leistungen oder lässt sie unbeeinflusst – es kommt darauf an! Dies ist weder als Kapitulation vor der Realität, als wissenschaftliche Diffusität noch als Aussageverweigerung aufgrund von Unwissenheit zu sehen. Diese, auf den ersten Blick wertlose Aussage, wird aber der Komplexität des Sachverhalts gerecht: Sowohl Stress als auch Leistung sind umfangreiche Konzepte und beinhalten diverse unterschiedliche Aspekte und Prozesse. Deshalb kann keine pauschale Aussage wie „Stress wirkt leistungssenkend“ gemacht werden. Die nachfolgenden Ausführungen sollen deshalb vorrangig diese Komplexität darstellen. Damit soll der Leser befähigt werden, über unwissenschaftliche oder populärwissenschaftlich stark vereinfachte Aussagen hinaus, die vielschichtigen Zusammenhänge zu begreifen und differenzierter betrachten zu können.
1 Einführung
Es ist bereits Alltagswissen, dass Stress Folgen hat. Einerseits wird dabei häufig an die gesundheitlichen Folgen gedacht (siehe Kapitel Stress & Gesundheit in diesem Band). Andererseits wirkt sich Stress aber auch auf das Leistungsverhalten aus. Dabei werden häufig unterschiedliche Begriffe wie Stress, Angst, Belastung und Arousal1/Erregung verwendet. Die Trennung dieser in voneinander deutlich abgegrenzte wissenschaftliche Konzepte, stellt eine scheinbar kaum bewältigbare Herausforderung dar. Sie werden häufig bedeutungsähnlich und synonym gebraucht, bezeichnen an anderer Stelle aber wieder Verschiedenes. Sie sind oft wenig oder gar nicht trennscharf definiert und kaum eindeutig operationalisiert.2 Da dieses Kapitel im Wesentlichen einen Überblick über den Zusammenhang zwischen diesen Zuständen und Prozessen einerseits und Verhalten, im Sinne von Leistungen, andererseits aufzeigen will, soll auch hier auf eine scharfe Abgrenzung der Konzepte verzichtet werden.3 Dabei darf nicht übersehen werden, dass Leistung ein umfassendes Konzept von Verhaltensbereichen umschließt. Menschliche Leistung setzt verschiedene kognitive Bereiche und Prozesse voraus, beinhaltet unterschiedliche motorische Aspekte und ist abhängig von diversen sensorischen Perspektiven. Einfach nur von Leistung zu sprechen, vereinfacht diese Bandbreite sträflich.
Im Folgenden sollen zunächst einige unterschiedliche Modelle für den Zusammenhang von Stress und Leistung vorgestellt und kurz diskutiert werden. Dieser Überblick soll ansatzweise die Komplexität der Thematik darstellen und vor übertriebenen, teilweise unnützen oder sogar gefährlichen Vereinfachungen, wie sie sich häufig in der stark verkürzenden Literatur finden, schützen. Anschließend an die Modellvorstellungen werden einige konkrete Forschungsergebnisse zu Effekten von Stress auf das Leistungsverhalten erörtert. Abschließend werden verschiedene Erkenntnisse für polizeiliche Leistungssituationen angeführt.
2 Theorien zur Wirkung von Stress auf die Leistung
2.1 Drive Theorie von Hull
Bei der Theorie von Hull (1943, [zitiert nach Jarvis, 1999]) sind die Faktoren Aufgabenkomplexität, Arousal/Erregung (also Stress) und gelernte 'Habits' (also Gewohnheit) zentral. Je höher das Arousal, desto eher finden dominante Gewohnheiten Eingang in das Verhalten. Ist die dominante Gewohnheit der (relativ einfachen) Aufgabenstellung adäquat, kann gefolgert werden, dass bei ansteigendem Arousal auch die Leistung ansteigt (Jarvis, 1999, S. 70). Es ist dann ein linearer Zusammenhang zwischen Arousal und Leistung zu proklamieren (siehe Abb. 1): Routine zahlt sich aus!
Im Fall einer komplexen oder schwierigen Aufgabe, und wenn die dominante Gewohnheit inadäquat ist, d. h. die Routine nicht zur Lösung des Problems dient, soll Arousal dann leistungsmindernd wirken. Die Leistung ist also nicht nur abhängig vom psychischen Zustand, in dem sich der Akteur befindet, sondern von dessen Gewohnheiten bzw. dem Niveau seiner Fertigkeiten. Experten können demnach von einem erhöhten Arousal profitieren, während Ungeübte Leistungseinbußen erfahren (Cox, 1998, S. 113; Jarvis, 1999, S. 70). Damit lassen sich Unterschiede zwischen Personen aufzeigen. Verschiedene Leistungsniveaus für unterschiedliche Handlungen einer einzelnen Person werden dadurch aber nicht verständlich. Ebenso kann der Ansatz von Hull keine Zusammenhänge erklären, die nicht linear sind, sondern eher ansteigen und nach einem Maximum wieder abfallen (siehe nachfolgender Abschnitt).
Abbildung 1

Abbildung 2

2.2 Yerkes & Dodson Regel
Die sicherlich bekannteste Regel ist die sog. Yerkes & Dodson Regel. Hier wird ein umgekehrt-U-förmiger Zusammenhang zwischen Stress bzw. Angst und Leistung propagiert (Abbildung 2). Mit zunehmender Erregung bzw. ansteigendem Stress/Angst nimmt zunächst die Leistung zu. Ab einem gewissen Punkt jedoch verschlechtert sich die Leistung mit weiter ansteigendem Stress. Die Regel geht zurück auf Yerkes & Dodson (1908), obwohl deren klassische Studie wenig damit zu tun hatte (Raglin, 1992). Es wird davon ausgegangen, dass für jede Aufgabe ein optimales Stressniveau existiert, jenseits dessen die Leistung suboptimal ausfällt. Es sollen also Über- und Untererregung existieren. Bei sehr niedrigem Stress erbringt der Organismus nur geringe Leistung. Eine Erhöhung des Stresses bringt auch eine Leistungsverbesserung mit sich, bis zu einem Punkt, an dem die optimale Leistung erreicht wird. Von dort an schmälern Erregungszunahmen die Leistung wieder. Dabei bewirken geringe Arousaländerungen auch nur (mehr oder minder) geringe Leistungsveränderungen. Das optimale Arousalniveau hängt von der Aufgabenkomplexität ab (vgl. Cox, 1998, S. 106; Jarvis, 1999): Anspruchsvolle, hochkomplexe Aufgaben, die z. B. feinmotorische Bewegungen beinhalten, sollen ein eher niedriges optimales Niveau erfordern, während die Bearbeitung einfacher Aufgaben, wie z. B. grobmotorische Bewegungen, eher durch ein erhöhtes Arousalniveau begünstigt werden. Somit ergibt sich für unterschiedliche Aufgaben auch ein unterschiedlicher Verlauf der Zusammenhangskurve. Ebensolches ist für unterschiedliche Fertigkeitsniveaus der Akteure festzustellen (Cox, 1998).
Das Yerkes-Dodson-Gesetz erlaubt die Bestimmung optimaler Leistungsvoraussetzungen für unterschiedliche Aufgabentypen. Es erklärt außerdem sowohl intraindividuelle als auch interindividuelle Leistungsunterschiede auf Grund verschieden ausgeprägter Erregung und Fertigkeitenniveaus. Jedoch scheitert es an der differenzierten Bestimmung der beteiligten Faktoren und psychischen Zustände. Weiterhin erlaubt es nur dann eine Leistungsvorhersage, wenn für entsprechende Aufgaben und bestimmten Personen die Zusammenhangskurve eindeutig bestimmt ist. Nitsch (1981b, S. 111) sieht in der Regel zum umgekehrt-U-förmigen Zusammenhang ausschließlich einen deskriptiven Ansatz, der nicht die zugrunde liegenden Mechanismen aufzeigt. Erklärungen von Fehlleistungen im Nachhinein, mit dem Argument des suboptimalen Arousalniveaus, ähneln einem Zirkelschluss. Man kann daher beim Yerkes-Dodson-Gesetz von einer Art Faustregel sprechen, die jedoch mitunter zu grob ist und nicht in jeder Situation zutrifft.
Viele empirische Befunde sprechen für einen umgekehrt-U-förmigen Zusammenhang von Arousal und Leistung.4 Gleichsam häufen sich aber auch Untersuchungen und Überlegungen, die diese Regel nicht bestätigen können und andere Zusammenhänge aufzeigen.5 Kritiker dieses Modells meinen, dass „diese Regel zumindest eine unzulässige Vereinfachung ist“ (Beckmann & Rolstad, 1997, S. 23), der „lediglich noch ein Platz in der Geschichte der Psychologie einzuräumen“ sei (Beckmann & Rolstad, 1997, S. 34). Andere betiteln sie sogar als eine „Katastrophe für die Sportpsychologie“ (Hardy & Fazey, 1987 [zitiert nach Jones, 1993, S. 25]). Beckmann & Rolstad (1997, S. 23) sehen in dem umgekehrt-U-förmigen Zusammenhang nicht mehr als „eine recht grobe Faustregel (…), die sich in vielen Leistungssituationen nicht bestätigen lässt“. Ebenso findet Häcker (1983, S. 54) die Beziehung zwischen Aktivierung und Leistung durch die invertierte U-Funktion „nur partiell abgedeckt“. Vielmehr sei der Zusammenhang sehr viel komplexer und bestehe aus einem „Wechselspiel zwischen energetisierenden und kognitiven Variablen auf der einen Seite und Aufgabenmerkmalen auf der anderen Seite“ (Beckmann & Rolstad, 1997, S. 23; vgl. Jones, 1993; vgl. Jones & Hardy, 1989). Grundlegende Probleme der Yerkes-Dodson-Regel seien deren Annahme eines eindimensionalen Erregungskonzeptes und die mangelnde Differenzierung zwischen Aufgaben mit verschiedenen Leistungscharakteristika, ausgenommen der Aufgabenschwierigkeit. Genau dies kritisieren auch Mozrall & Drury (1996, S. 1181), die die Annahme, dass menschliche Leistung nur von einem Faktor abhängt, anzweifeln und darauf hinweisen, dass menschliches Verhalten hierfür viel zu komplex ist (ebenso Jones & Hardy, 1989).6
2.3 Theorie der Zone des optimalen Funktionierens
Hanin (1986, [zitiert nach Javis, 1999]) führte an, dass bei der Diskussion um den Zusammenhang von Arousal und Leistung häufig individuelle Differenzen bzgl. der Reaktion auf Angst vernachlässigt würden. Er kritisiert die Annahme eines universellen Zusammenhangs und postuliert, dass für jeden Akteur eine individuelle Relation zu bestimmen sei. Er nennt den Bereich „Zone des optimalen Funktionierens“, den ein Akteur vorzieht und in dem er optimale Ergebnisse zeigt. Akteure unterscheiden sich in ihrer „Zone“. Sie erbringen deshalb bei interindividuell unterschiedlichem Angstniveau ihre maximale Leistung (siehe Abb. 3). Weiterhin sollten unterschiedliche Zonen für verschiedene Sportarten auch in Abhängigkeit vom erreichten Fertigkeitenniveau des jeweiligen Sportlers existieren (Raglin, 1992). So kann z. B. ein bestimmtes Angstniveau beim Gewichtheben optimale Leistungen ermöglichen, während es beim Pistolenschießen zu deutlichem Leistungsverlust führt.
Während einige empirische Studien die Theorie nur wenig oder gar nicht bestätigen konnten, was evtl. auf das Versäumnis von Hanin zurückzuführen ist, der nicht zwischen somatischen und kognitiven Anteilen der Angst differenzierte, unterstützten andere Studien die Theorie oder zumindest Teile von ihr erheblich (vgl. Raglin, 1992; vgl. Cox, 1998, S. 119 f.).7
Abbildung 3

2.4 Reversal Theory
Die Reversal Theory geht auf Apter (1982 [zitiert nach Cox, 1998 und Kerr, 1993, 1997]) zurück und stellt eine Persönlichkeits- und Motivationstheorie dar. Zentral sind Umkehrungen (reversals) in der motivationalen Ausrichtung eines Individuums und die Betonung des Erfahrens von eigener Motivation (metamotivationaler Zustand). Es wird im Zusammenhang mit sportlichen Leistungen vor allem zwischen zwei Zuständen unterschieden.8 Die eine ist „telisch“ und damit ernst, planend und zielorientiert im Leben. Die „paratelische“ hingegen ist eine „hier-und-jetzt“ Einstellung, die spontan ist, eine lustbetonte Lebensweise beinhaltet und eine Vorliebe für Aufregung besitzt. Dabei sind in diesen Orientierungen keine andauernden Persönlichkeitsmerkmale zu sehen. Vielmehr dominiert eine Ausprägung dann, wenn die Möglichkeit besteht, zwischen beiden Orientierungen zu wechseln.
Abbildung 4

Ausgangspunkt ist, dass es einem Individuum möglich ist, sich seiner eigenen Erregung bewusst zu werden. Bedeutsam ist hierbei, wie dieser Zustand aufgrund des metamotivationalen Zustandes vom Individuum interpretiert wird. Dabei versucht das Individuum, einer Angst zu entrinnen und Entspannung zu finden, jedoch auch Langeweile zu vermeiden und Aufregung zu erleben (siehe Abb. 4). Hohe Erregung kann also dann als Aufregung positiv empfunden werden, wenn man sich zuvor eher langweilt. Kommt man aber aus dem Zustand der Entspannung, kann sie auch ängstigend sein.
Ziel des Individuums ist es also, den angenehmst möglichen Zustand zu erreichen. Es versucht also nicht das Arousal, sondern die „Angenehmheit“ zu erhöhen, wobei sich dann das entsprechende Arousalniveau nach dem metamotivationalen Zustand (telisch vs. paratelisch) richtet. Personen in einem telischen Zustand präferieren ein geringes Arousalniveau im Sinne von Entspannung. Personen in einem paratelischen Zustand bevorzugen ein hohes Arousalniveau als Aufregung. Eine Erhöhung des Arousals geht also in der paratelischen Orientierung mit (angenehmer) Aufregung einher, während sie bei telischer Orientierung unangenehm und ängstigend empfunden wird.
Der Zusammenhang zwischen Zustand und Leistung ergibt sich im Rahmen der Reversal-Theory nicht aus einer direkten Verbindung von Arousal und z. B. der Motorik, sondern wird durch die kognitive Erfahrung des Arousals unter metamotivationalem Einfluss bestimmt. Kerr (1997, S. 92) schlussfolgert aus mehreren Studien, dass erfolgreiche (sportliche) Leistungen mit dem Empfinden von hohem Arousal verbunden waren, welches als positiv, angenehm und nicht stressend erfahren, also als aufregend bewertet wurde. Außerdem konnten die erfolgreichen Akteure ihr bevorzugtes Arousalniveau eher erreichen und beibehalten. Nach der Reversal-Theory ist also z. B. kein mittleres Arousalniveau (Yerkes-Dodson-Regel) oder eine einzelne Zone (Zonen-Theorie) optimal für Leistungen. Für Kerr (1997, S. 107) ist vielmehr entscheidend, dass es erfolgreiche Akteure gelernt haben, sich in den „richtigen mentalen Rahmen“ zu bringen.
2.5 Easterbrook-Hypothese
Die Theorie von Easterbrook (1959) zum Einfluss von „emotionalem“ Arousal auf den Umfang der Nutzung von perzeptiven Reizen oder Informationen („cue“) kann ebenfalls einen umgekehrt-U-förmigen Zusammenhang zwischen Arousal und Leistung, der jedoch auch von der Aufgabe abhängt, erklären. Easterbrook geht zunächst davon aus, dass bei einem Schrumpfen der Reiznutzung die Verwendung peripherer Reize vermindert und gleichzeitig der Gebrauch zentraler und unmittelbar relevanter Reize beibehalten wird. Solche Veränderungen sollen mit einer zentralen Leistungsverbesserung oder Aufrechterhaltung der Leistung unter Stress einhergehen (Easterbrook, 1959, S. 183).
Abbildung 5

Den umgekehrt-U-förmigen Zusammenhang zwischen Arousal und Leistung erklärt Easterbrook (1959, S. 193) als Resultat zweier Funktionen. Die eine beinhaltet den positiven Zusammenhang zwischen Leistung und Anzahl von Informationen, die genutzt werden. Die andere beschreibt den negativen Einfluss von Arousal auf die Nutzung von Informationen. Weiterhin geht er von der Annahme aus, dass der simultane Gebrauch von irrelevanten und relevanten Informationen die Effektivität verringert, und dass bei einer Schrumpfung der Informationsnutzung zunächst die Verwendung irrelevanter Informationen eingeschränkt wird. Bei geringem Arousal erfasst das Individuum durch eine hohe Aufmerksamkeitsbreite eine große Bandbreite von Informationen. Hierbei sind einige leistungsirrelevant und behindern deshalb. Wird die Nutzung von perzeptiven Informationen mit steigendem Arousal eingeengt, werden zunächst weniger irrelevante Informationen erfasst und die Leistung steigt an. Ab einem gewissen Arousalniveau werden aber auch mehr und mehr relevante Reize nicht mehr erfasst. Infolgedessen sinkt die Leistung. Nimmt man an, dass schwierige Aufgaben auch eine höhere Anzahl von relevanten Reizen beinhalten als leichte Aufgaben, ergibt sich der von der Yerkes-Dodson-Regel bekannte Zusammenhang zwischen Aktivierung und Leistung.
Eysenck (1984 [zitiert nach Jones, 1993, S. 23]) bezweifelt, dass die Einschränkung der Informationsnutzung bei zunehmendem Arousal automatisch geschieht und schlägt vor, dies eher als aktive Copingreaktion anzusehen, bei der sich der Akteur infolge zu hoher Anforderungen an die Informationsverarbeitung auf eine kleine Anzahl von Informationen beschränkt. Dies wäre eine Strategie, um die Leistung für die Primär- bzw. Hauptaufgabe zu sichern.
Etliche empirische Laborergebnisse (vgl. Häcker, 1983, S. 50; vgl. Cox, 1998, S. 109), aber auch wenige Felduntersuchungen (Landers, Qi & Courtet, 1985) unterstützen die Theorie der Aufmerksamkeitseinengung. Allerdings konnten aber auch einige Studienergebnisse Easterbrooks Hypothese nicht stützen oder fanden sogar gegenteilige Ergebnisse, d. h. nicht eine verstärkte Zuwendung der Wahrnehmung oder Verarbeitung auf zentrale, sondern auf periphere Reize (vgl. Raglin, 1992).
Landers, Qi & Courtet (1985) prüften die Easterbrook-Hypothese bei Gewehrschützen mittels Doppelaufgabe. Die Schützen sollten einerseits Schießen und andererseits auf akustische Reize reagieren. Ihr Ziel war es, einerseits Leistungseinbußen in der Sekundäraufgabe (akustische Aufgabe) unter Stress, bei gleichzeitiger Beibehaltung oder sogar Steigerung des Leistungsniveaus in der Primäraufgabe (Schießen) festzustellen. Weiterhin wollten sie Unterschiede hinsichtlich dieser Veränderung für erfahrene und unerfahrene Schützen prüfen. Ihre Ergebnisse konnten die Hypothesen bzgl. des Einflusses von Arousal zumindest teilweise bestätigen.9 Differentielle Unterschiede aufgrund von Schießerfahrung hinsichtlich der Leistungsveränderung in der Sekundäraufgabe wurden nur tendenziell, nicht signifikant festgestellt.
Vrij, van der Steen & Koppelaar (1995) prüften die Easterbrook-Hypothese bzw. aus ihr abgeleitete Konsequenzen für das Verhalten von Polizeibeamten in simulierten Einsatzsituationen, die einen Schusswaffengebrauch erforderten. Sie fanden die Einengung der Nutzung von Informationen unter Einfluss von situationsadäquatem Lärm sowie Leistungseinbußen in Sekundäraufgaben (Schießgeschwindigkeit, Aufsuchen der Deckung). Verbesserung der Leistung in Primäraufgaben, die hier dichotom als Tätertreffer erfasst wurde, konnte nicht immer gefunden werden. Vrij, van der Steen & Koppelaar (1995) führen dies auf einen Deckeneffekt zurück, d. h. sie sahen keine Möglichkeit, dass diese Leistung unabhängig vom Einfluss des Zustandes verbessert werden könnte, sondern diese bereits maximal ausgeprägt war.
Die Easterbrook-Hypothese könnte auch als Erklärung für den sog. Tunnelblick herangezogen werden. Von diesem Phänomen wird häufig berichtet, dass sich im Stress das Blickfeld einenge. Man würde dann quasi, wie durch einen Tunnel, nur noch die zentralen Elemente wahrnehmen. Es stellt sich dabei aber die Frage, ob dies ein visuelles Phänomen oder eines der Aufmerksamkeit ist. Dieser Unterschied ist nicht nur wissenschaftlich relevant, sondern von äußerst praktischer Bedeutung: Ist es ein visuelles Phänomen, können bestimmte periphere Reize nicht wahrgenommen werden. Man muss die Augen aktiv bewegen, um den Fokus des Blickes entsprechend schweifen zu lassen. Die Blindheit für periphere Reize wäre also ein räumliches Problem.
Ist das Phänomen aber durch die Aufmerksamkeit bedingt, werden periphere Reize zwar zur Verfügung gestellt und bis zu einer gewissen Stufe auch verarbeitet, durch den Vorgang der selektiven Aufmerksamkeit aber „ausgefiltert“. Dabei ist peripher nicht mehr räumlich bedingt, sondern durch kognitive Elemente bestimmt: Zentral ist das, was „interessiert“. Peripher ist das, was der zentralen (aber subjektiv gewählten) Aufgabenerfüllung weniger dient. Entspricht dabei die Zentralität eines Objektes oder Sachverhaltes nur der subjektiven und nicht der objektiven Wichtigkeit, ist man abgelenkt. Reine Blickbewegungen helfen hier wahrscheinlich wenig.
Hinweise darauf, dass der Tunnelblick doch eher ein Aufmerksamkeitsphänomen sein könnte, liefern Simons & Chabris (1999): Ein Video zeigt 2 Baskettball spielende Mannschaften und einen Affen, der über das Spielfeld zwischen den Spielern hindurchläuft. Von ca. der Hälfte der Versuchspersonen wird der Gorilla, der von rechts nach links durch das Bild läuft, nicht wahrgenommen. Er ist damit räumlich sicherlich sowohl peripher als auch zentral sichtbar. Somit kann hier eine visuelle Blindheit durch die räumliche Anordnung keine Erklärung liefern. Vielmehr ist der Gorilla aber bzgl. der Aufgabe (nämlich die Spieler mit den weißen T-Shirts zu beobachten) peripher. Es scheint also eher ein Aufmerksamkeitsproblem denn ein visuelles zu sein. Ähnliches kennt man aus dem Einsatztraining. Bei der intensiven Beschäftigung mit einer Person, z. B. bei einer Personenkontrolle, kann es sein, dass eine Waffe, die in der Nähe der Person liegt, übersehen wird. Dabei ist sie nicht visuell peripher (weil in der Nähe der handelnden Person). Es kann aber sein, dass sie bzgl. der Aufmerksamkeit peripher ist, da für die einschreitenden Polizeibeamten zunächst die Person zentral erscheint. Eine starke Fokussierung auf die Person bzw. die Interaktion mit dieser, lässt dann die Waffe „unsichtbar“ werden, obwohl sie eigentlich höchst relevant ist.
Parallel zum Tunnelblick kann das Tunnelgedächtnis gesehen werden. Bestes Beispiel hierfür ist der „Waffen-Fokus-Effekt“ (vgl. Hulse & Memon, 2006): Tritt in einer Situation eine Waffe auf, fokussieren sich die bedrohten Personen auf diese. Als Konsequenz können im Gegensatz zur Waffe weniger bedeutsame Details bzw. periphere Reize schlechter erinnert werden (z. B. schlechtere Täterbeschreibung, vermindertes Wiedererkennen).
2.6 Das Modell von Humphreys & Revelle
Humphreys & Revelle (1984) entwerfen ein integratives Struktur-Modell, das weit über einen eindimensionalen Ansatz hinausgeht und auch die Prozesse näher beschreibt, die einem Zustands-Leistungs-Zusammenhang zugrunde liegen sollen. Sie stellen die Persönlichkeitsdimensionen der Introversion-Extraversion, der Leistungsmotivation und der Ängstlichkeit in Bezug zur kognitiven Leistung unter Berücksichtigung situativer Moderatoren (Erfolg-Misserfolg, Zeitdruck, Anreize, Tageszeit und Stimulanzien) und der motivationalen Konstrukte Arousal (unidimensional) und Anstrengung (siehe Abbildung 6).
Abbildung 6

Anmerkungen: Durchgezogene Pfeile bedeuten monoton positive Effekte, gestrichelte Pfeile stehen für monoton negative Effekte. Abwesenheit von Pfeilen bedeutet, dass keine direkte Beeinflussung gegeben ist. Kreise stehen für latente Variablen, Dreiecke stehen für experimentelle Manipulationen und X steht für Interaktionseffekte
Dabei sehen sie die verwendeten Konstrukte und Prozesse als nicht erschöpfend für die Beschreibung des Zusammenhangs an, messen ihnen jedoch aufgrund von vielen empirischen Belegen einen überragenden Erklärungswert bei. Humphreys & Revelle (1984) gehen davon aus, dass die Persönlichkeitsmerkmale mit aktuellen Persönlichkeitszuständen („personality states“) und motivationalen Zuständen („motivational direction and intensity“) in Zusammenhang stehen, welche durch situative Umstände moderiert werden. Die motivationalen Zustände beeinflussen die Informationsverarbeitungsprozesse des „anhaltenden Informationstransfers“ („sustainedinformation-transfer“; das Subjekt verarbeitet einen Reiz, verbindet mit diesem eine Reaktion und führt diese Reaktion aus, wie z. B. einfache Reaktionszeitaufgaben) und Ressourcen des Kurzzeitgedächtnisses durch Kapazitätszuweisung („allocation“) und Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen („availability“). Für Humphreys & Revelle (1984) besteht die Bearbeitung kognitiver Aufgaben aus einer Kombination (mehr oder minder) dieser beiden kognitiven Prozesse. Jeder dieser Prozesse für sich ist über einen monotonen Zusammenhang mit den motivationalen Zuständen verbunden (siehe Abb. 7.1 und Abb. 7.2), der durch die zur Verfügung stehenden Ressourcen bestimmt und durch eine „Datenlimitierung“ nach oben begrenzt wird. Durch Kombination dieser Prozesse können sich kurvilineare Zusammenhänge, wie der nach Yerkes & Dodson propagierte umgekehrt-Uförmige, ergeben (siehe Abb. 7.3).
Humphreys & Revelle (1984) sehen in ihrem Strukturmodell die Möglichkeit, unterschiedliche und scheinbar selbst zunächst widersprüchliche empirische Befunde zu erklären. Sie stellen mit ihrem Modell einerseits die Individualität der Beziehung von psychischem Zustand/Motivation und der Leistung in Bezug zum Akteur und dessen Aufgabe heraus. Andererseits betrachten sie auch die Komplexität der Beziehung.
Revelle (1987) bestätigte einige der Zusammenhänge des Modells von Humphreys & Revelle (1984). Er erweitert es um die kognitiven Prozesse des Langzeitgedächtnisses und um vier Arten der Zuweisung von Ressourcen („resource tradeoffs“) bei der Aufgabenbearbeitung. Er betont abschließend die Komplexität menschlichen Verhaltens (Revelle, 1987, S. 448) und stellt heraus, dass Leistungen nur verständlich sein können, wenn individuelle Differenzen unter dem moderierenden Einfluss der Situation und der verschiedenen Aufgabeneigenschaften betrachtet werden.
Abbildung 7.1

Abbildung 7.2

Abbildung 7.3

Abbildung 8

Anmerkung: Der graue Bereich ist unerreichbar.
2.7 Katastrophen-Modell
Kirkcaldy (1983) sah unvorhersehbare Leistungsspitzen („performance peaks“) und Leistungseinbrüche („performance flops“) im Sport weder durch die Drive-Theorie Hulls noch durch die Yerkes-Dodson-Regel erklärt. Er stellte deshalb die Katastrophen-Theorie als deskriptives Modell multidimensionalen Systemverhaltens in den Dienst des Sports, um eine Erklärung für explosionsartige Leistungsänderungen durch relativ geringe Arousaländerungen zu finden. Kirkcaldy (1983) fügte den Dimensionen Arousal und Leistung die Dimension der Angst hinzu. Auch Fazey & Hardy (1988, [zitiert nach Jarvis, 1999]) zweifelten an der Hypothese, dass Arousal und Leistung stets umgekehrt-U-förmig zusammenhängen sollen. Sie kritisieren insbesondere die Aussage, dass geringe Änderungen des Arousal auch immer nur geringe Leistungsverschiebungen hervorrufen sollen. Auch sie sahen eine Erklärungsmöglichkeit in einem Katastrophen-Modell (siehe Abb. 8).
Fazey & Hardy gehen davon aus, dass bei einer Person, die sich im Zustand ausgeprägter kognitiver Angst befindet (Abb. 8: vordere Kante der Leistungsoberfläche), eine nur geringe Arousalsteigerung über den Punkt der optimalen Ausprägung hinaus die Leistung deutlich einbrechen lässt (Katastrophe). Hingegen bewirkt eine Verringerung des Arousalniveaus über den selben Punkt zurück keinen ebenso dramatischen Wiederanstieg der Leistung. Vielmehr sei eine drastische Reduzierung nötig, um das ehemalige Leistungsniveau auch in Form eines sprunghaften Leistungsanstieges erneut zu erreichen (siehe Abb. 8), was als Hysterese („hysteresis“) bezeichnet wird.
Hingegen soll der umgekehrt-U-förmige Zusammenhang gelten, solange der Akteur nur geringe kognitive Angst empfindet (Abb. 8: hintere Kante der Leistungsoberfläche). Weiterhin fände sich bei konstant hohem Arousal mit abnehmender kognitiver Angst eine Leistungssteigerung (Abb. 8: rechte Kante der Leistungsoberfläche) und umgekehrt, bei konstant niedrigem Arousal (Abb. 8: linke Kante der Leistungsoberfläche) mit zunehmender kognitiver Angst eine Leistungsverbesserung (Hardy & Parfitt, 1991, S. 167). Damit sind die 4 Charakteristiken der Angst-Leistungs-Beziehung, die in der Literatur zu finden sind, im Modell enthalten (Hardy & Parfitt, 1991, S. 166). Fazey & Hardy erweitern somit den 2-dimensional umgekehrt-U-förmigen Zusammenhang um die Dimension der kognitiven Angstkomponente (Hardy & Parfitt, 1991, S. 165).
Hardy & Parfitt (1991) und Hardy, Parfitt & Pates (1994) führten experimentelle Belege für das Katastrophen-Modell an. Sie konnten zeigen, dass die kognitive Angstkomponente den Zusammenhang Arousal-Leistung moderiert und dass die Leistung bei ausgeprägter kognitiver Angst dramatisch abfällt, sobald das optimale Erregungsniveau überschritten wird. Weiterhin fanden sie heraus, dass die Leistung insgesamt am höchsten war, wenn die Akteure sich im Zustand ausgeprägter kognitiver Angst befanden. Die kognitive Komponente der Angst stellt also nicht einen leistungsmindernden Faktor an sich dar, sondern wirkt in Abhängigkeit von der Erregung.
2.8 Aufmerksamkeits-Richtungs-Hypothese und Aufmerksamkeits-Kontroll-Theorie
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.