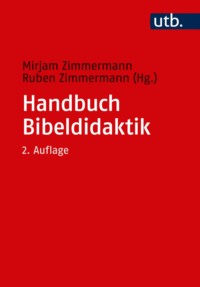Kitabı oku: «Handbuch Bibeldidaktik», sayfa 7
Biblische Archäologie
Wolfgang Zwickel
Biblische Archäologie im Kontext der Geschichtswissenschaft
Biblische Archäologie ist kein unmittelbares Thema im Religionsunterricht. Sie wird nicht explizit in den Lehrplänen vorausgesetzt, und die meisten Lehrenden haben keine Ausbildung in diesem Bereich. Und trotzdem ist in der modernen Geschichtswissenschaft eine Rekonstruktion der Geschichte ohne die Heranziehung von Archäologie eigentlich unmöglich. Gab es vor 30 Jahren nur vereinzelte Grabungen, finden heute jährlich etwa 300 Ausgrabungen in den Staatsgebieten Israel, Jordanien und Westbank/Palästina statt, mit deren Hilfe inzwischen die |47|kulturelle Entwicklung des Landes sehr gut aufgezeigt werden kann. Kein anderes Land der Welt dürfte so intensiv und genau erforscht sein wie die südliche Levante und dabei insbesondere das Staatsgebiet Israels. Waren vor 30 Jahren die gängigen Lehrbücher zur Biblischen Archäologie noch nahezu ausschließlich auf die Bearbeitung und Bewertung der biblischen und außerbiblischen Texte ausgerichtet, so kann eine zeitgemäße Geschichte Israels diese Tradition heute nicht mehr aufnehmen. Inzwischen wurde erkannt, dass selbst die vertrauenswürdigsten historischen Quellen immer auch einseitig sind und eine gewisse Aussageabsicht haben, ganz abgesehen von der – eigentlich nicht neuen – Erkenntnis, dass viele biblische Texte mit einem mehr oder weniger großen Abstand zu den berichteten Ereignissen verfasst wurden. Die Archäologie bietet Relikte der realen Welt, mit deren Hilfe es möglich ist, ein Bild der realen Gegenwart einer bestimmten Zeit jenseits der Texte zu zeichnen. Allerdings ist auch die Interpretation archäologischer Quellen immer von der Sichtweise des Interpreten abhängig und damit alles andere als objektiv. Während in den letzten Jahren innerhalb der historischen Forschung zum Alten und Neuen Testament die Interpretationen einiger weniger archäologischer Forscher stark im Mittelpunkt standen, zeigt die Diskussion doch zunehmend, dass auch andere Sichtweisen möglich sind und einige Befunde noch einmal kritisch überdacht werden müssen.
Forschungsfelder der vergangenen Jahre
Zentrale Bedeutung hat in den letzten beiden Jahrzehnten die Biblische Archäologie bei der Rekonstruktion der sog. Landnahme Israels gespielt. Die biblischen Quellen, insbesondere das Josuabuch, haben einen Abstand von mindestens 500 Jahren zu den berichteten Ereignissen und können heute nicht mehr als historisch zuverlässige Quelle angesehen werden. Mit Hilfe der Archäologie gelang es zu zeigen, dass ein Großteil des späteren Israel aus den Bewohnern des Landes gebildet wurde. Die sog. Landnahmezeit ist nicht als eine Epoche zu verstehen, in der ein aus Ägypten ausgewandertes Volk in das Gebiet Palästinas kriegerisch eindringt, die ansässige Bevölkerung komplett beseitigt und einen neuen Staat bildet. Vielmehr ergaben sich um 1200 v. Chr. starke gesellschaftliche Umschichtungsprozesse, bedingt durch klimatische und politische Veränderungen. Diese führten dazu, dass die bis dahin dominanten Stadtstaaten zusammenbrachen und weitgehend verlassen wurden. Die Menschen, die in den Städten keine ausreichende Lebensgrundlage mehr finden konnten, gründeten kleine und kleinste Siedlungen im Bergland, aus denen sich dann allmählich Clans und schließlich die Stämme entwickelten. Die aktuelle Forschung verlagert sich sehr stark auf die persische und hellenistische Zeit (539–333 bzw. 333–40/37 v. Chr.) – bislang von der Geschichtswissenschaft stark vernachlässigte Perioden.
Auch im Bereich der Religionswissenschaft haben sich durch die archäologischen Untersuchungen viele neue Erkenntnisse ergeben. Schwerpunkt der Diskussion war hierbei die Frage nach einer Partnerin Jahwes, da an zwei Orten aus dem 9. und 8. Jh. v. Chr. Inschriften gefunden wurden, die Aschera als Göttin |48|an der Seite Jahwes erwähnen. Dies hat das traditionelle Bild der Religionsgeschichte völlig auf den Kopf gestellt – mit erheblichen Auswirkungen auch auf die Theologie des AT. Hinzu kamen Aufarbeitungen des ikonographischen Materials Palästinas, das neue Einsichten in die Religionsgeschichte und Theologie erbrachte.
Insbesondere im deutschsprachigen Kontext wurden mehrere wichtige Kartenwerke zur historischen Topographie vorgelegt. Damit ist es heute auch möglich, in Verbindung mit der Geschichtswissenschaft die historische Entwicklung einzelner Regionen wesentlich besser aufzuzeigen.
Biblische Archäologie im Religionsunterricht
Biblisch-archäologische Funde spielten seit der Phase des hermeneutischen RUs eine wichtige Rolle bei der Ausgestaltung der Religionsbücher. Allerdings ist dabei zu bemängeln, dass die Illustrationen häufig nicht den aktuellen Stand der Forschung widerspiegelten, sondern diesem sogar häufig widersprachen.[1] Bilder von Funden und Rekonstruktionszeichnungen haben jedoch eine sehr prägende Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler. Bildmotive werden in der Regel vom Gedächtnis viel besser gespeichert als Texte. Da in den Religionsbüchern die Bilder meist als Zugabe zum Text verwendet werden, nicht aber der Ausgangspunkt der Darstellung sind, kommt die didaktische Wirkung der Bilder wenig oder kaum zum Zuge. Hier wäre es notwendig, Bilder viel stärker als Ausgangspunkt der Darstellung zu verwenden.
Verwertbarkeit von archäologischen Funden für den Unterricht
Archäologische Funde können jedoch nicht unreflektiert eingesetzt werden für die Illustration eines Unterrichtswerkes oder für die Gestaltung einer Unterrichtsstunde. Das reine Artefakt bietet viele Informationen nicht, die aber für die Umsetzung im Unterricht notwendig sind. Pfeilerfigurinen, wie sie inzwischen mit weit über 1000 Exemplaren aus dem 8. und 7. Jh. v. Chr. in Juda vorhanden sind, geben keine Auskunft, ob diese nackten Frauenfigurinen Beleg für einen ausgeprägten heidnischen Kult, für eine Integration einer weiblichen Göttin in den Jahwekult oder aber für eine polytheistische Religion sind. Die Benutzung einer solchen Figurine setzt die Auseinandersetzung mit den gängigen religionsgeschichtlichen Theorien voraus. Andererseits ist ein Mauerzug, der von Archäologen der Zeit der Omriden (9. Jh. v. Chr.) zugeschrieben wird, in einem Religionsbuch eigentlich ohne jegliche Bedeutung. Wird ein solches Bild von den Verfassern des Unterrichtswerkes eingesetzt, kann es eigentlich nicht mehr aussagen als die Tatsache, dass es auch außerbiblische Beweise gibt, die die Existenz |49|des 9. Jh.s v. Chr. (und noch nicht einmal die Existenz von Omri und seinen Nachfolgern) nachweisen. Archäologie wird nur dann aussagekräftig, wenn sie entsprechend aufgearbeitet wird. Dieselbe Mauer als Teil einer Rekonstruktionszeichnung des Palastes Omris in Samaria, verbunden mit den Nachweisen für eine intensive Verwaltungstätigkeit im 9. Jh. v. Chr., belegt durch die zahlreichen Verwaltungstexte von diesem Ort und den Nachweis von Schreiberkammern im Palastbereich, und verbunden mit den zahlreichen Elfenbeinfunden an diesem Ort, kann die Zeit der Omriden verständlich machen. An dem genannten Beispiel kann exemplarisch aufgezeigt werden, dass mit der Zeit der Omriden eine völlig neue, stark auf Verwaltung basierende und durch mächtige Bauten und deren luxuriöse Ausgestaltung manifestierte Herrschaftsform auftrat, die man in dieser Ausprägung aus der Zeit Davids oder Salomos etwa noch nicht kannte. So wird, indem man archäologische Fakten als Grundlage nimmt, nicht nur die geschichtliche Entwicklung einer Epoche anschaulicher und einprägsamer. Auch biblische Texte können auf diese Weise anschaulicher vorgestellt werden. Das Interesse etwa des Königshauses am Erwerb von Grundstücken in unmittelbarer Palastnähe, wie es die Grundlage für 1 Kön 211 Kön 21 bildet, kann damit verständlich aufgezeigt werden, aber auch die prophetische Kritik an dem Luxus des Königshauses (z.B. Am 3,15Am 3,15).
Methodische Schwierigkeiten und Chancen
Ein methodisches Problem dabei ist jedoch, dass die in den Lehrplänen angesprochenen Themenfelder eine in der Regel völlig andere Zugangsweise voraussetzen als es die archäologische Forschung macht. Die Lehrpläne orientieren sich an bestimmten Themenfeldern, die nach Ansicht von Religionslehrern elementar bedeutsam sind für ein „Grundwissen Christentum“. Das Thema „Religiöse Gruppen zur Zeit Jesu“, bei dem auf Pharisäer, Sadduzäer, Essener etc. eingegangen werden soll, lässt sich nicht ohne Weiteres mit archäologischen Artefakten beschreiben, obwohl für diese Zeit viele Artefakte zur Verfügung stehen. Die Qumran-Handschriften können inzwischen nicht mehr problemlos mit den Essenern verbunden werden. Pharisäer und Sadduzäer dürften vielfach dieselben Gerätschaften im Alltagsleben verwendet haben usw. Mit Hilfe der Archäologie ließe sich sehr schön der Alltag in neutestamentlicher Zeit illustrieren, aber die Funde sind nicht unmittelbar übertragbar auf die typischen Themenstellungen der Lehrpläne. Dies erfordert entweder einen viel weiteren Zugang zu der Themenstellung, was häufig aus Zeitproblemen im Unterricht nicht realisierbar ist, oder aber ein bewusstes Abweichen von den Lehrplänen mit einer Neuakzentuierung.
Außerschulische Lernorte, wie z.B. das Bibeldorf Rietberg oder das Bibelmuseum Frankfurt, können hingegen handlungsorientiert die Einsichten der biblischen Archäologie nahebringen und ermöglichen gerade so das kritische Gespräch mit Schülerinnen und Schülern über die Chancen und Grenzen archäologischer Arbeit.
|50|Die Stärken der Archäologie
Auf Grund der Konzentration auf Artefakte und ihre Situierung bzw. ihre Datierung kann die (Biblische) Archäologie ein recht zuverlässiges Bild der Entwicklung der Kulturgeschichte in den biblischen Ländern zeichnen. Diese Lebenswelt in biblischer Zeit ist aber nicht automatisch Illustration der biblischen Texte, nur selten lassen sich archäologische Artefakte und Textinformationen direkt aufeinander beziehen (z.B. Pilatus-Inschrift). Texte und archäologische Funde stehen vielmehr in einem Verweisverhältnis, bei dem sie sich wechselseitig interpretieren helfen. Sei es, dass die archäologisch konstruierte Lebenswelt mit ihren vielfältigen Bereichen die kulturgeschichtlichen Grundkenntnisse liefert, mit denen die Texte angemessener zu verstehen sind; sei es, dass die aus den Texten generierten ‚Meta-Erzählungen‘ den geschichtlichen Rahmen erzeugen, in den die archäologischen Funde eingeordnet werden können. Diese Informationen sollten eine Basis für die religionsdidaktische Umsetzung bilden und sind damit für den Religionsunterricht unverzichtbar. Leider werden diese Bereiche im Rahmen der Ausbildung bisher sehr stark vernachlässigt und in Zukunft möglicherweise im deutschsprachigen Bereich sogar ganz wegfallen.
Leseempfehlungen
Obermann, Andreas, Steine erzählen Geschichten … Unterrichtseinheiten zum Religionsunterricht rund um die Biblische Archäologie für das 3. und 4. Schuljahr. Düsseldorf 2009.
Schefzyk, Jürgen/Zwickel, Wolfgang, Judäa und Jerusalem. Leben in römischer Zeit. Die Welt und Umwelt der Bibel erschlossen und vorgestellt mit Schätzen aus Israel. Stuttgart 2010.
Schroer, Silvia, Die Ikonographie Palästinas/Israels und der Alte Orient. Eine Religionsgeschichte in Bildern 1–4. Bisher Bde. 1–3. Fribourg 2005, 2008, 2011. Der 4. Band erscheint voraussichtlich 2018/19.
Themenheft „Landnahme Israels“. Religion betrifft uns (2/2015).
Tilly, Michael/Zwickel, Wolfgang, Religionsgeschichte Israels. Von der Vorzeit bis zu den Anfängen des Christentums. Darmstadt 22015.
Vieweger, Dieter, Archäologie der biblischen Welt. Gütersloh 2012.
Ders. et al., Das Geheimnis des Tells. Eine archäologische Reise in den Orient. Mainz 2005. (Archäologie für Kinder von 10–12 Jahren).
Zwickel, Wolfgang, Einführung in die biblische Landes- und Altertumskunde. Darmstadt 2002.
Ders., Die Welt des Alten und Neuen Testaments. Ein Sach- und Arbeitsbuch. Stuttgart 22002.
Ders., Leben und Arbeit in biblischer Zeit. Eine Kulturgeschichte. Stuttgart 2012.
Ders. et al. (Hg.), Herders Bibelatlas. Freiburg i.Br. et al. 2013.
Zeitschrift „WUB“. Stuttgart ab 1996.
Fußnoten
1
Vgl. zu einer Kritik der bisherigen Verwendung von Bildern Zwickel, Wolfgang, Bilder zur biblischen Welt in Religionsbüchern. Eine Problemanzeige. Waltrop 1995.
|51|Neutestamentliche Sozial- und Kulturgeschichte der Umwelt Jesu und der frühchristlichen Gemeinden
Susanne Luther
Die antike Welt als ‚fremdes Land‘
„The past is a foreign country. They do things differently there“.[1] Diese Erfahrung machen auch SuS bei der Begegnung mit Zeugnissen antiker Kulturen. Für die SuS wirken die biblischen Texte und die Welt, in der sie verankert sind, fremd: „Das schwierigste didaktische Problem, aber auch die vielversprechendste Aufgabe theologischer Arbeit besteht darin, die Fremdheit der Texte als Chance für den Unterricht zu nutzen und sie zumindest ansatzweise vom Makel des Uncoolseins zu befreien. (…) Texte (…) sollten grundsätzlich als fremde Welten gelesen werden, die wir ganz neu erkunden müssen (…). Wir kennen die Gesetze der fremden Welten nicht, und wir müssen unbedingt damit rechnen, dass die Gesetze und Regeln, die in diesen fremden Welten herrschen, andere sind, als die, die unsere Welt bestimmen. Das Lesen jedes Textes und erst recht das Lesen biblischer Texte muss zu einer Entdeckungsreise werden“.[2] Diese Entdeckungsreise, die auf eine Überwindung der historischen wie kulturellen Distanz zielt, kann durch die Beschäftigung mit dem sozialen und kulturellen Kontext der Verfasser und der Erstrezipienten in der antiken mediterranen Welt erfolgen.
Die Sozial- und Kulturgeschichte untersucht die sozialen, kulturellen, ökonomischen und politischen Gegebenheiten, die die frühen Christen und somit die Verfasser der ntl. Schriften geprägt haben. Bereits zu Beginn des 20. Jh.s erschienen Untersuchungen zur antiken Volkskultur und Palästinakunde sowie zur Ausbreitung des frühen Christentums,[3] die formgeschichtliche Schule verortete Textformen und ihre Entwicklung in bestimmten sozialen Situationen („Sitz im Leben“). Einen Aufschwung erlebte die Beschäftigung mit der Sozial- und Kulturgeschichte der Antike im Rahmen der Leben-Jesu-Forschung: Das sozialgeschichtliche Interesse der „Third quest“ gründete in dem Bestreben, Jesus in seinem historischen Kontext zu situieren und somit die Bedeutung der Jesusbewegung und ihrer sozialen und religiösen Botschaft sowie Jesu Stellung zum antiken Judentum und zur Besatzungsmacht besser kontextualisieren zu können. |52|Voraussetzung dafür war die Erforschung der sozialen, kulturellen und religiösen Gegebenheiten und der Lebenswirklichkeit in der jüdischen Gesellschaft des 1. Jh.s n. Chr. im östlichen Römischen Reich. Unter dem Einfluss der „Cultural Turn“ ist seit den 1960er Jahren ein Wandel in der Sozial- und Kulturgeschichte zu erkennen, der die sich parallel zu der Geschichte der politisch-kulturellen Eliten entwickelnde Sicht des ‚kleinen Mannes‘ betont und die Grundlagen einer ‚Geschichte von unten‘ eruiert.[4] Im Bereich der ntl. Wissenschaft wurde verstärkt der prägende Einfluss der historischen Gegebenheiten berücksichtigt und Erkenntnisse der Anthropologie, der Alltags- und Geschlechtergeschichte rezipiert. In diesem Zusammenhang sind v.a. die sozialgeschichtlichen Analysen von G. Theißen[5] sowie E.W. und W. Stegemann[6], der feministisch-befreiungstheologische Ansatz von L. Schottroff[7] und der sozialanthropologische Ansatz von B.J. Malina zu nennen.[8] Die „Context Group“[9] erweiterte den deskriptiven Ansatz der Sozialgeschichte um sozialwissenschaftliche und soziokulturelle, theoriegeleitete Fragestellungen und analysierte die Verhaltensmuster und Einstellungen in antiken Gesellschaften („honor-shame“, „kinship“, „purity codes“, „gender“, „patron-client relationship“ etc.). In den letzten Jahren wurden insbesondere kulturanthropologische Fragestellungen im Rahmen feministischer, postkolonialer, befreiungstheologischer Hermeneutiken vermehrt an die ntl. Texte herangetragen.
Sozial- und kulturgeschichtliche Aspekte im Religionsunterricht
Aspekte der Lebenswelt
Bereits in der Orientierungsstufe wird die Zeit und Umwelt Jesu thematisiert. Dieses Themengebiet soll die SuS nicht nur in die Beschäftigung mit dem geographischen, politischen und religiösen Kontext der neutestamentlichen Zeit (→ Art. Politische Geschichte und religiöser Kontext), sondern auch in sozialgeschichtliche und kulturanthropologische Fragestellungen der antiken Gesellschaft einführen. Hier spielt die Einordnung Jesu in das antike Judentum (Traditionen, |53|Lehren und Feste) und seine Verortung im Spektrum der religiösen Parteien eine bedeutende Rolle. Aber auch Aspekte des alltäglichen Lebens im Römischen Reich des 1. Jh.s n. Chr. sind zu beleuchten. Die SuS sollen erkennen, dass sich die gesellschaftlichen, sozialen und religiösen Gegebenheiten der Zeit im Leben Jesu und in den biblischen Texten widerspiegeln und dass die Kenntnis des historischen Kontexts zum Verstehen der biblischen Texte beiträgt.[10] Die Lehrpläne unterschiedlicher Bundesländer sehen vor, den „garstigen Graben“ zwischen dem historischen Jesus und dem geglaubten Christus zu thematisieren. Hier kann gerade die Darstellungsweise in den Evangelien eine Hilfe sein, deren Verfasser den historischen Jesus aus der Perspektive des Glaubens beschreiben, ihn aber dennoch im sozialen und historischen Kontext seiner Zeit verorten. Auch Paulus und die Entwicklung der frühen Gemeinden werden in der Sekundarstufe I behandelt. Im RU kann nach Aspekten des sozial- und kulturgeschichtlichen Kontexts der christlichen Missionare und der frühen Gemeinden im Römischen Reich gefragt werden, nach innergemeindlichen Konflikten und deren Auslösern, nach der Einbindung bzw. Abgrenzung der frühen Gemeinden gegenüber dem hellenistisch-römischen bzw. jüdischen Umfeld und der Herausbildung einer frühchristlichen Identität.
Lebensbedingungen der kleinen Leute
Im RU kann die Geschichte der ‚kleinen Leute‘ der Jesusbewegung sowie der frühen christlichen Gemeinden im Rahmen folgender Dimensionen erschlossen werden: Zu den Lebensbedingungen der Menschen im antiken Palästina zählen zunächst die Gegebenheiten des Landes, das aus fruchtbaren, landwirtschaftlich nutzbaren Gebieten und trockenen Steppen und Wüsten besteht, zu großen Teilen aus Bergland, das nur als Viehweide genutzt werden konnte. Einen Kontrast bildet zudem die städtische Lebenswelt in Jerusalem gegenüber dem dörflichen Kontext, in dem der Großteil der Bevölkerung lebte – als Kleinbauern (Viehzucht, Getreide-, Wein-, Obst- und Olivenanbau), Hirten und in den Küstenebenen und am See Genezareth auch als Fischer, als Handwerker (Weber, Färber, Töpfer, Schmiede, Schreiner), als Händler, Zöllner oder Tagelöhner. Die dörfliche Wohnsituation der Großfamilien in einräumigen, flachgedeckten Häusern aus Lehm und Stroh gemeinsam mit den Tieren (Ziegen, Schafe, Hühner, Esel, Kühe) und die Kleidung der Menschen, die Ernährung der Familie v.a. mit Brot, Obst und Gemüse und Milchprodukten sowie das Bildungswesen (und die Rolle der Wissenschaften wie z.B. der Medizin, des Bauwesens) spielen in Hinblick auf das Verständnis der Gesellschaft im 1. Jh. n. Chr. eine bedeutende Rolle. Die jüdische Religion mit Gebet und Synagogenbesuch, Lehrhaus für die |54|Schulkinder, religiösen Traditionen und Geboten, Festkalender und Wallfahrten zum Tempel in Jerusalem bestimmte das Leben.[11] Die vielfältigen Aspekte des Alltagslebens – insbesondere der Kinder im antiken Palästina – können von den SuS auf unterschiedliche Weise erschlossen werden, z.B. durch Freiarbeit,[12] durch Ganzschriftlektüre,[13] durch erzählende und beschreibende Textquellen, Bilder und Filme,[14] durch praktisches Erleben z.B. im Bibeldorf,[15] in Synagoge[16] oder Mikwe, durch Kochen und Backen,[17] Basteln, Töpfern und Werken.[18]