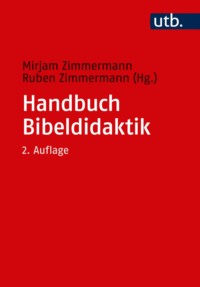Kitabı oku: «Handbuch Bibeldidaktik», sayfa 8
Auseinandersetzung mit soziokulturellen und kulturanthropologischen Modellen
Das NT nennt häufig Menschen am unteren Ende der Sozialpyramide:[19] Fischer (Mt 4,18Mt 4,18), Hirten (Lk 2,8Lk 2,8; Joh 10Joh 10), Tagelöhner (Mt 20,1–16Mt 20,10096>16), Bettler (Lk 18,35Lk 18,35; |55|Joh 9,8Joh 9,8) und Witwen (Lk 21,2f.) figurieren sowohl in den Wundern als auch in der Bildwelt der Verkündigung Jesu an prominenterer Stelle als Reiche wie z.B. Landbesitzer (Lk 12,16f.), Weinbergbesitzer (Mt 20,1–16Mt 20,10096>16), Sklavenbesitzer (Mt 24,45–51Mt 24,450096>51; PhlmPhlm) oder reiche Gemeindeglieder (Jak 2,1–9Jak 2,10096>9).[20] Neben den sozialen Bezügen in der Familie, im Haus oder Dorf, sind die religiösen und politischen Gruppierungen und Machtstrukturen in den Blick zu nehmen. Im Rahmen der Thematisierung sozialer Schichten[21] in der Gesellschaft ist auch die Bedeutung Kranker und Behinderter – der Ausgestoßenen der Gesellschaft – besonders in den Wundern Jesu hervorzuheben. Drei Ebenen sozialer Relationen können beispielhaft vertieft thematisiert werden:
1 Die Rolle der Frauen: Die Diskussion der Rolle der Frau (z.B. 1 Kor 111 Kor 11.141 Kor 14; Pastoralbriefe) verweist darauf, dass die positive Einstellung bei Jesus und Paulus zur Mitarbeit der Frauen einerseits und der traditionelle Kontext der antiken Umwelt andererseits den Umgang mit traditionellen Rollenmodellen in den Gemeinden problematisch machte.
2 Die Stellung der Sklaven: Sklaven bedienen häufig den bildspendenden Bereich der Gleichnisse (z.B. Lk 12,41–48Lk 12,410096>48), jedoch wird auch konkret ihre Unterordnung in der Hierarchie bestärkt (vgl. Mt 10,24f.; aber auch PhlmPhlm; 1 Kor 7,20–231 Kor 7,200096>23).[22]
3 Wohltäter und Patrone: Röm 16,1f. nennt die in der Hafenstadt Kenchreä wohnende Phoebe, der wahrscheinlich ein Hauswesen unterstand und die als Patronin der Gemeinde (Gastgeberin, Unterstützerin, Bürgin etc.) gedeutet werden kann. In diesem Themenfeld kommt es v.a. darauf an, dass die SuS die Bildwelt der Verkündigung Jesu und die soziale Struktur der Jesusbewegung und der frühen Gemeinden kennen lernen, um so – in Auseinandersetzung mit den kulturellen und religiösen Verhaltenskonventionen und Denkmustern der antiken Welt[23] – zu einem vertieften Verständnis der ethischen Argumentation |56|der ntl. Texte zu gelangen. Die Art und Weise, in der die Jesusbewegung und die ntl. Schriften die in der Welt des 1. Jh.s üblichen kulturanthropologischen Modelle übernahmen bzw. variierten ist von den SuS in Hinsicht auf die Interpretation und Wirkungsgeschichte der Texte zu berücksichtigen.
Kontrafaktische Gegenwelten in der Gleichnisinterpretation
In der Orientierungsstufe sieht der Lehrplan die Beschäftigung mit den Gleichnissen vor, die einen zentralen Inhalt der Verkündigung Jesu transportieren: seine Vision vom Reich Gottes. Die Bildwelt der Gleichnisse knüpft an die Erfahrungen der Hörer, an ihnen bekannte soziale Verhältnisse und alltägliche Lebensbedingungen an, die illustrierend und kontrastierend mit der Botschaft vom Gottesreich verknüpft werden.[24] L. Schottroff geht im Rahmen ihres befreiungstheologisch-feministischen Ansatzes davon aus, dass die Lebenswelt (besonders die Arbeits- und soziale Welt) der Menschen im Römischen Reich des 1. Jh.s n. Chr. realistisch in die Gleichnisse aufgenommen wurde; zugleich dienen diese aber nicht lediglich der ‚neutralen‘ Darstellung, sondern werden transparent für die Wirklichkeit der Gottesherrschaft, die Gleichnisse vermitteln gleichzeitig eine sozialpolitische und eine theologische Botschaft.[25] Dies ist im RU zu verdeutlichen, indem die SuS herausarbeiten, dass Jesu Botschaft neue Handlungsmöglichkeiten, neue Sichtweisen auf die alltägliche Wirklichkeit eröffnet (z.B. Mk 3,1–6 parMk 3,10096>6 par..; Mt 8,5–13 parMt 8,50096>13 par..; Lk 10,38–42Lk 10,380096>42; Mk 2,13–17 parMk 2,130096>17 par.. etc.). Die SuS sollen erkennen, dass Jesus mit seiner Botschaft die Hoffnung auf eine bessere Welt weckt: Er erzählt vom Gottesreich (z.B. Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, Mt 20,1–16Mt 20,10096>16; vom großen Gastmahl, Lk 14,15–24Lk 14,150096>24; vom Senfkorn, Mt 13,31f. parMt 13,31f. par..), er fordert von seinen Hörern die Überprüfung und Veränderung ihrer Einstellungen und ruft zu neuem Handeln auf (z.B. Gleichnis vom barmherzigen Samariter, Lk 10,25–37Lk 10,250096>37).
|57|E. Schüssler Fiorenza betont auch in Bezug auf Gleichnisse die Bedeutung der ‚kritischen Pädagogik‘: Die Beschäftigung mit biblischen Texten soll die Fähigkeit zu kritischem Denken anregen und einen Prozess des sozialen Wandels anstoßen. Ungerechtigkeit soll nicht nur erkannt, sondern auch bekämpft werden.[26] Dieser bibeldidaktische Ansatz ist in der Beschäftigung mit dem Thema der sozialen und politischen Verantwortung in der Sekundarstufe II fruchtbar zu machen: Die SuS sollen sich mit dem christlichen Staatsverständnis auseinandersetzen und dies in Bezug auf die christliche Ethik reflektieren. Soll man sich dem Staat unterordnen oder kann man unter Berufung auf das christliche Gewissen gegen staatliche Vorgaben handeln? Dieser Aspekt berührt die Thematik der sozialkritischen Prophetie sowie die Rückfrage nach dem Streben für Gerechtigkeit und der Entwicklung der Gesellschaft (vgl. hierzu Mk 12,13–17Mk 12,130096>17; Mt 20,1–16Mt 20,10096>16; sowie die Besitzkritik in Lk).
Leseempfehlungen
Berg, Horst Klaus, So lebten die Menschen zur Zeit Jesu. Freiarbeit Religion. Stuttgart 21998.
Crüsemann, Frank (Hg.), Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur Bibel. Darmstadt 2009.
Erlemann, Kurt et al. (Hg.), Neues Testament und Antike Kultur. 5 Bde. Neukirchen-Vluyn 2004–2008 (Nachdruck Neukirchen-Vluyn 2011).
Göhrum, Volker/Fuchs, Martin, Bei Jesus zu Hause: wohnen und arbeiten im alten Palästina dargestellt an einem Hausmodell mit Ausschneidebogen und Kopiervorlagen. Stuttgart 1998.
Horsley, Richard A., Die ersten Christen. Sozialgeschichte des Christentums. Bd. 1. Gütersloh 2007 (engl. Original: A People’s History of Christianity. Vol. 1 Christian Origins. Minneapolis 2005).
Stegemann, Wolfgang/Stegemann, Ekkehard W., Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Judentum und in den Christusgemeinden in der mediterranen Welt. Stuttgart et al. 1995.
Tilly, Michael, So lebten Jesu Zeitgenossen. Alltag und Frömmigkeit im antiken Judentum. Stuttgart 2008.
Zimmermann, Ruben (Hg.), Kompendium der Gleichnisse Jesu. Gütersloh 22015.
Fußnoten
1
Der erste Satz aus dem Roman The Go-Between von Leslie Poles Hartley (London 1953).
2
Alkier, Stefan/Dressler, Bernhard, Wundergeschichten als fremde Welten lesen lernen. Didaktische Überlegungen zu Mk 4,35–41. In: Dressler, Bernhard/Meyer-Blanck, Michael (Hg.), Religion zeigen. Religionspädagogik und Semiotik. Münster 22003, 163–187, 166f.
3
Vgl. u.a. die Arbeiten von Adolf Deißmann, Joachim Jeremias und Adolf von Harnack.
4
Vgl. dazu Horsley, Richard A., Jesus in Context. Power, People, and Performance. Minneapolis 2008.
5
Vgl. z.B. Theißen, Gerd, Studien zur Soziologie des Urchristentums. Tübingen 31989; ders., Die Jesusbewegung. Sozialgeschichte einer Revolution der Werte. Gütersloh 2004.
6
Vgl. z.B. Stegemann/Stegemann, 1995.
7
Vgl. z.B. Schottroff, Luise, Lydias ungeduldige Schwestern. Feministische Sozialgeschichte des frühen Christentums. Gütersloh 1994.
8
Vgl. z.B. Malina, Bruce J., The New Testament World. Insights from Cultural Anthropology. Louisville 1981 (deutsch: Die Welt des Neuen Testaments. Stuttgart 1993).
9
Vgl. Esler, Philip F., The Context Group Project. An Autobiographical Account. In: Lawrence, Louise J./Aguilar, Mario I. (Hg.), Anthropology and Biblical Studies. Avenues of Approach. Leiden 2004, 46–61.
10
Z.B. exemplarisch Neumüller, Gebhard (Hg.), Lernzirkel Jesus der Nazarener. Sekundarstufe II. Speyer 1999; Röser, Winfried, Jesus: Geschichte – Bedeutung – Aktualität. 5.–8. Klasse. Buxtehude 2008. Leben und Botschaft Jesu können in den historischen Kontext eingeordnet werden, z.B. anhand von Jesu Steckbrief, Herkunftsland, Arbeit und Beruf, Religionszugehörigkeit, Leben im Dorf, Wanderungen etc.
11
In fachwissenschaftlicher Hinsicht vgl. Scherberich, Klaus (Hg.), Neues Testament und Antike Kultur. Bd. 2. Neukirchen-Vluyn 2005; zur Didaktik vgl. dazu Braun, Sonja, Wie und wo hat Jesus gelebt? Die Umwelt Jesu kennenlernen. Klassen 1 bis 3. Religion erleben 48 (2012), 1–22; Bühlmann, Walter, Wohnräume von Arm und Reich zur Zeit Jesu. RL – Zeitschrift für Religionsunterricht und Lebenskunde 35 (2006), 17–23; Landgraf, Michael, Jesus begegnen: seine Zeit – sein Leben – seine Worte und Taten. ReliBausteine primar. Stuttgart 2011; Obermann, Andreas, Steine erzählen Geschichten. Unterrichtseinheiten zum Religionsunterricht rund um die Biblische Archäologie für das 3. und 4. Schuljahr. Düsseldorf 2009.
12
Vgl. Oelmann, Doreen, Palästina vor 2000 Jahren. Ein Lernzirkel zur Zeit und Umwelt Jesu. RAAbits Religion. Stuttgart 2009; Schmid, Ilka, Leben und Umwelt Jesu. 5./6. Klasse. In: Kirchhoff, Ilka (Hg.), Religionsunterricht mit Stationen. Göttingen 2009, 9–23.
13
Vgl. z.B. Berg, Horst Klaus/Weber, Ulrike, Benjamin und Julius. Geschichte einer Freundschaft zur Zeit Jesu. Stuttgart 1996; Sohns, Ricarda/Zimmermann, Mirjam, Gerd Theißen. Der Schatten des Galiläers. Zur Arbeit mit einer Ganzschrift im RU. Religion betrifft uns 2 (2010).
14
Z.B. Stürmer, Silke, Spuren entdecken (DVD; ein Dokumentarfilm mit Aufnahmen aus Zink, Jörg, Das Land, aus dem Jesus kam, 1974 und Golden Globe: Israel – Heiliges Land zwischen drei Meeren, 2006, hg. von Komplett Media, 2010); Bleiholder, Andreas/Müller, Markus, Wenn Sand und Steine erzählen könnten … DVD 4 Jesus (hg. v. Evangelisches Medienhaus GmbH 2012).
15
Vgl. zu Rietberg http://www.bibeldorf.de/; Zugriff am 30.08.2017.
16
Hier sind z.B. die Architektur und Ausstattung der Synagogengebäude, Kultgegenstände, Feste und religiöses Leben (Gebetsriemen, Kippa, Gebetsmantel, Tora etc.) zu berücksichtigen, die den SuS medial durch Bastelbögen (z.B. Synagoge, Schriftrolle), Bildbetrachtung, Lieder oder eine Sabbatfeier in der Klasse erschlossen werden können.
17
Vgl. z.B. Kavermann, Claudia, Frühstück bei Miriam, Ester und Daniel. Grundschule 34 (2002), 54–57.
18
Vgl. Göhrum, Volker/Fuchs, Martin, Bei Jesus zu Hause. Wohnen und Arbeiten im alten Palästina dargestellt an einem Hausmodell mit Ausschneidebogen und Kopiervorlagen. Stuttgart 1998; Rock, Lois, Bibel Bastelbuch. Die Zeit Jesu wird lebendig im Basteln, Kochen, Kleben, Nähen und Spielen. Stuttgart 62012. Vgl. zudem die Böckmühler Bastelbögen im Aue-Verlag.
19
Vgl. Stegemann/Stegemann, 1995, 127.
20
Vgl. Herrmann-Otto, Elisabeth, Reiche und Arme. In: Scherberich, 2005, 86–90, bes. 89.
21
In der sozialgeschichtlichen Exegese wurde die Jesusbewegung als innerjüdische Widerstands- und Erneuerungsbewegung gedeutet und im Kontext der ländlichen sozialen Unterschicht verortet und Jesu Hinwendung zu den Armen und Ausgestoßenen betont. Vgl. v.a. Schottroff, Willi/Stegemann, Wolfgang, Der Gott der kleinen Leute: Sozialgeschichtliche Bibelauslegungen. 2 Bde. München 1979.
22
Vgl. Harrill, J. Albert, Slaves in the New Testament. Literary, Social, and Moral Dimensions. Minneapolis 2006; Byron, John, Slavery Metaphors in Early Judaism and Pauline Christianity. A Traditio-Historical and Exegetical Examination. WUNT II/162. Tübingen 2003.
23
Denkmuster und Verhaltenskonventionen der antiken Welt werden z.B. mit Hilfe kulturanthropologischer Modelle aus den neutestamentlichen Texten erhoben, vgl. Malina, Bruce J., Christian Origins and Cultural Anthropology. Practical Models for Biblical Interpretation. Atlanta 1986. Zu den grundlegenden Werten des Mittelmeerraumes in der Antike gehören Ehre und Scham, die ein bestimmtes sozial angemessenes Verhalten in einem bestimmten kulturellen Raum gewährleisten und durch Machtverhältnisse, sozialen Status und Geschlechterrollen bedingt sind. Soziale und religiöse Grenzziehungen wie z.B. die zwischen rein und unrein (kultische vs. ethische Reinheit; Juden- vs. Heidentum; Krankheit/Besessenheit vs. Gesundheit; Sexualität/Ehescheidung etc.), die damit verbundenen Klassifizierungssysteme für Menschen, Tiere, Dinge, Raum, Zeit etc. sowie die Reinheitsvorschriften, die dem Erhalt des Ordnungssystems dienen sollten, gaben genaue Grenzen für die Strukturierung und Wahrnehmung der Umwelt vor.
24
Bibeldidaktisch kann hier die befreiungstheologische Hermeneutik von Carlos Mesters herangezogen werden, der von der Lebenswirklichkeit im lateinamerikanischen Kontext ausgeht und betont, dass die Erfahrungen der Hörer der Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit dem Bibeltext sein sollten, vgl. Mesters, Carlos, Vom Leben zur Bibel – von der Bibel zum Leben. Ein Bibelkurs aus Brasilien für uns. Bd. 1. Mainz/München 1983.
25
Vgl. Schottroff, Luise, Die Gleichnisse Jesu. Gütersloh 2005; vgl. auch dies., Sozialgeschichtliche Gleichnisauslegung. Überlegungen zu einer nichtdualistischen Gleichnistheorie. In: Zimmermann, Ruben (Hg.), Hermeneutik der Gleichnisse Jesu. Methodische Neuansätze zum Verstehen urchristlicher Parabeltexte. WUNT 231. Tübingen 2008, 138–149.
26
Vgl. Schüssler Fiorenza, Elisabeth, Democratizing Biblical Studies. Toward an Emancipatory Educational Space. Louisville 2009.
|58|Opfer, Kult und Fest im Judentum
Michael Tilly
Jede menschliche Gemeinschaft braucht Feste als besondere Zeiten, die den Alltag und den Jahreslauf rhythmisieren. In regelmäßig wiederkehrenden religiösen Festen, Gottesdiensten, Ritualen und Kultformen realisiert sich die Gottesbeziehung und drückt sich das identitätsstiftende kollektive Bewusstsein aus, indem das Festgeschehen die Gruppenidentität erneuert, bekräftigt und zugleich für den einzelnen Menschen Orientierung stiftet. Sowohl der Ursprungsanlass als auch der Glaubensinhalt vieler jüdischer und christlicher Feste sind unlösbar mit der biblischen Tradition verbunden und spiegeln die hohe Bedeutung wider, die bestimmten Schriften aus der Geschichte Israels durch die feiernde Gemeinschaft zuerkannt wird. Neben der kognitiven Vermittlung von lehrstoffbezogenem Sachwissen vermag die didaktische Applikation des Themas insbesondere an eine Reihe affektiver Bedingungen und Prozesse anzuknüpfen. So ermöglichen gerade biblische Feste als Unterrichtsgegenstand die Verknüpfung von geistigen Anforderungen und erlebnishaften Erfahrungen. Ihre gemeinsame Feier provoziert Kreativität, macht die eigene religiöse Gemeinschaft tatsächlich erfahrbar und vermag ebenso interreligiöses Lernen anzubahnen.
Kult und Fest in der Bibel
Auf der Grundlage gemeinsamer Feiern und Opferdarbringungen einzelner Familien und Sippenverbände gewann während der Königszeit Israels der regelmäßige Opfergottesdienst am Jerusalemer Tempel als dem materiellen und empirisch fassbaren Zentrum der gemeinschaftlichen Gottesverehrung Gestalt und Bedeutung. In der nachexilischen Zeit wurde der Aspekt der allgemeinen Sühnefunktion des Opferkultes (Lev 17,11Lev 17,11; Ps 65,2–5) immer wichtiger und das Streben nach Sühne und Sündenvergebung zum Beweggrund und Zweck vieler Opferhandlungen. Beides wurde der Festgemeinde durch fortwährende und korrekt vollzogene rituelle Tieropfer immer wieder von neuem vermittelt. Im Mittelpunkt des täglichen Opfergottesdienstes in Jerusalem, der am frühen Morgen und am späten Nachmittag stattfand, standen die Darbringung des Brandopfers auf dem Altar im Priestervorhof (Lev 1Lev 1; 6Lev 6) und des Räucheropfers im Heiligtum (Ex 30Ex 30). An Sabbat- und Festtagen fanden zusätzliche Opfer statt (Num 28Num 28). Besonders zu den drei großen Wallfahrtsfesten (Pesachfest, Wochenfest, Laubhüttenfest; vgl. Ex 23Ex 23; 34Ex 34; Dtn 16Dtn 16) wurden die täglichen Opfer um private Dank- und Schuldopfer der Festpilger ergänzt (Lev 7Lev 7). Im Rahmen ihrer heilsgeschichtlichen Bedeutung dienten die Wallfahrtsfeste der Vergegenwärtigung des Bundes, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hatte. Dabei wurde die Festtagsfreude als unverzichtbarer Bestandteil der Festtage hervorgehoben (Dtn 16,14f.).
|59|Seit der Makkabäerzeit (s.u.) wurde der Jerusalemer Tempel zum zentralen Identifikationssymbol und zum religiösen Mnemotop, an das sich die geschichtlichen Ursprungserfahrungen des Judentums knüpften. Die besondere Bedeutung des Opferbetriebs blieb kennzeichnend für die gesamte hasmonäische Ära, obwohl der Tempelkult bald auch zum umstrittenen Symbol für gruppenspezifische Interessenlagen wurde. Gerade die Hasmonäerherrschaft (160–63 v. Chr.) bedeutete für Teile des Judentums eine bedrohliche Infragestellung der Traditionsbindung des praktizierten Tempelkultes. Seine Suffizienz wurde deshalb von traditionstreuen und antipriesterlichen Kreisen mehrfach bestritten bzw. durch die utopische Konzeption eines idealen endzeitlichen Tempelkultes negiert. In der christlichen Evangelienüberlieferung wurde der jüdische Opferkult wiederholt vorausgesetzt (Mk 1,44parMk 1,44parr..; Mt 23,18–20; Lk 17,14Lk 17,14); auch die ersten christlichen Gemeinden nahmen am Tempelkult in Jerusalem teil (Apg 2,46Apg 2,46; 3,1; 5,21Apg 5,21).
Die jüdischen Feste waren ursprünglich zumeist mit Naturerfahrungen wie dem Lauf von Sonne, Mond und Sternen oder dem Vegetationszyklus und dem agrikulturellen Jahreslauf der Bauern und Hirten verbunden. Sie wurden erst sekundär durch die Erinnerung an ein göttliches Erscheinen und Handeln (insbesondere im Exodusgeschehen) begründet, die ihre ursprüngliche Bedeutung überlagerte und verdrängte. In mehreren Schüben erfolgte ihre Verbindung mit kulturell gewachsenen Symbolen, um fortan die regelmäßig wiederkehrende Erneuerung und Vergegenwärtigung dieser Heilsereignisse darzustellen.
Das Neujahrsfest Rosch ha-Schana (September/Oktober) gilt als Gerichtstermin und als Zeit der Verkündigung der Königsherrschaft Gottes (vgl. Lev 23Lev 23; Num 29Num 29). Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht das Blasen auf einem Widderhorn (vgl. Lev 23,24Lev 23,24). Es gilt als Pflicht, den Ruf des Schofars bewusst zu hören. Zu den populären Festbräuchen gehört das Eintauchen von Brot und Apfelstücken in Honig, was die Hoffnung auf ein „süßes Jahr“ symbolisiert. Der Versöhnungstag Jom ha-Kippurim, der in biblischer Zeit mit einem besonderen Opferritual verbunden war (vgl. Lev 16Lev 16), ist Höhepunkt und Abschluss der zehn Bußtage, die mit dem Gericht Gottes am Neujahrsfest eingeleitet werden. Sein Ritual soll durch aufrichtige Reue und Läuterung des Menschen seine Versöhnung mit Gott bewirken. Der Versöhnungstag ist traditionell durch Fasten und Selbstprüfung gekennzeichnet. Die Kasteiungen symbolisieren die Abwendung vom Alltäglichen und Materiellen. Während des Laubhüttenfestes Sukkot (September/Oktober), das mit der göttlichen Bewahrung der Israeliten während der Zeit des Exodus (Lev 23,42f.) verknüpft wurde, errichtet man zur Erinnerung an Gottes Bewahrung beim Auszug aus Ägypten auf Balkonen, Höfen oder in Gärten Laubhütten. In den festlich geschmückten Hütten wird geschlafen und gegessen. Das Fest vergegenwärtigt den Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Thema des Chanukkafestes (Dezember), des jüngsten Festes im jüdischen Kalender, ist die Wiedereinweihung des durch die Syrer entweihten Jerusalemer Tempels durch die Makkabäer im Jahre 164 v. Chr. (vgl. 1 Makk 41 Makk 4). Es ist heute ein beliebtes Familienfest. Zentrales Gebot ist das Anzünden der |60|Festlichter. Das Aufstellen des Chanukkaleuchters eröffnet die achttägige Festzeit. Das Purimfest (Februar/März) erinnert an die im biblischen Buch Esther erzählte Bewahrung der persischen Juden. Es wird als ein Tag der Freude und der Heiterkeit gefeiert. Kinder verkleiden sich. Ein Festmahl mit ausgiebigem Essen und Trinken, vor allem von Wein, ist an diesem Festtag ein Gebot. Das Pesachfest (März/April) geht auf einen kanaanäischen Nomadenbrauch zurück. In der Tora wurde das Fest mit der Erinnerung an das wichtigste Heilsereignis in der Geschichte Israels verknüpft, dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten (Ex 12,1–28Ex 12,1–28; Dtn 16,1Dtn 16,1) und als Wallfahrtsfest am Jerusalemer Tempel gefeiert. Der Termin des Wochenfestes Schavuot (Mai/Juni) markierte ursprünglich das Ende der Weizenernte. Bereits in der Zeit kurz nach dem babylonischen Exil wurde die Sinaioffenbarung von den Priestern auf den Termin des Wochenfestes gelegt (vgl. Ex 19,1Ex 19,1). Im 2. Jh. wurde es zu einem allgemeinen Fest des Gedenkens der Sinaioffenbarung und der Erwählung Israels. Traditionell werden die Synagogen und Häuser mit Blumen und Früchten geschmückt. Der Sabbat als wichtigster jüdischer Feiertag, entstanden als Bundeszeichen und identitätsstiftendes Gruppenmerkmal wahrscheinlich zur Zeit des babylonischen Exils, wurde durch seine Verankerung im Schöpfungs- (Ex 20Ex 20) und im Exodusgeschehen (Dtn 5Dtn 5) zum erinnernden Zeichen der Treue Gottes und gilt als ein wöchentlicher Tag der körperlichen und seelischen Ruhe, der Freude, des Torastudiums und des Gebets.