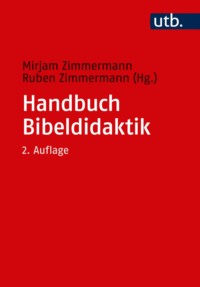Kitabı oku: «Handbuch Bibeldidaktik», sayfa 9
Die Bibel in Kult und Fest
In biblischer Zeit wurden die Kenntnisse von Inhalten religiös autoritativer Schriften vor allem durch die familiäre Sozialisation und durch die persönliche Teilnahme an Wallfahrtsfesten am Jerusalemer Tempel vermittelt. Daneben hatte sich bereits seit der Zeit des babylonischen Exils mit dem öffentlichen Toravortrag in der Synagoge (vgl. 2 Kor 3,14f.; CIJ 1404CIJ 1404) eine eigenständige (allerdings noch nicht fest strukturierte) Form des jüdischen Gottesdienstes herausgebildet, die zum zentralen Kennzeichen jüdischer Religion und Frömmigkeit wurde und in der – als die biblische Tradition vermittelndes Element – bis heute die Zukunft verheißende Geschichte mit Gott gefeiert wird. Auch Jesus und seine Anhänger nahmen an synagogalen Gottesdiensten teil (Mk 1,21.23Mk 1,21.23par.; 3,1Mk 3,1par.; 6,2Mk 6,2par.; Joh 6,59Joh 6,59); ebenso begegnet die Synagoge in stereotyper Weise als Ausgangspunkt der paulinischen Mission (Apg 13,5Apg 13,5.14Apg 13,14; 14,1Apg 14,1; 17,1f. u.ö.).
Nach der Tempelzerstörung des Jahres 70 n. Chr. und dem Ende des jüdischen Opferkultes wurden zahlreiche Attribute des Tempelopfers auf die Tora als Medium des Gottesverhältnisses Israels übertragen. Dieser Übertragung entspricht die Entwicklung, dass die nun entstehenden Netzwerke rabbinischer Gelehrter das Studium, die aktualisierende Auslegung und die Applikation der Tora sukzessive an die Stelle des Tempelopfers gesetzt hatten und beidem eine vergleichbare religiöse Bedeutung beimaßen. Die zentrale Stellung der Tora kommt auch in der synagogalen Liturgie und in der Einrichtung des Synagogenraumes |61|zum Ausdruck. Von den während des regelmäßigen Gottesdienstes zur Lesung aufgerufenen Gemeindegliedern wurden Abschnitte der Tora vorgetragen (vgl. Apg 15,21Apg 15,21). Erst im frühen Mittelalter entwickelten sich feste Lesezyklen, wobei die gesamte Tora in traditionellen Gemeinden in 52 fortlaufenden Wochenabschnitten in einem Jahr (babylonische Tradition), in Reformgemeinden in kürzeren Abschnitten in drei Jahren (palästinische Tradition) zum melodiösen Vortrag kommt. Die einzelnen Wochenabschnitte sind mit einem Stichwort aus dem ersten Vers der jeweiligen Toralesung benannt. Mit der babylonischen Leseordnung korrespondiert ein besonderer Feiertag (Simchat Tora), der den Beginn des jährlichen Zyklus markiert. Dem (anfangs wohl freien) Toravortrag folgte bereits in der Antike eine Auslegung in Gestalt der Übertragung des hebräischen Bibeltextes in die Alltagssprache; eine regelmäßige begleitende Prophetenlesung (vgl. Lk 4,15–20Lk 4,15–20) ist indes unsicher.
Auch nachträgliche explizite oder implizite Bezugnahmen auf die biblische Tradition konnten konstitutive Bedeutung für das jüdische Festgeschehen erlangen. Nach der Tempelzerstörung wurde die gemeinsame häusliche Mahlzeit, der Sederabend, zum Hauptereignis des Pesachfestes. Die Pesach-Haggada enthält die genaue Beschreibung einer solchen Mahlfeier, bei der verschiedene Nahrungsmittel mit zeichenhafter Bedeutung gereicht werden, wobei die Feiernden gemeinsam den Weg der Exodusgeneration in symbolischen Handlungen mitgehen. Gerade an Pesach wird so die lebensstiftende religiöse Tradition des Judentums mittels generationenübergreifender Kommunikation erfahrbar. Das Fest ermöglicht, gemeinsam den Weg der Exodusgeneration in symbolischen Handlungen mitzugehen, und gibt zugleich der Hoffnung auf die zukünftige Erlösung Ausdruck. Übergreifenden Bezug auf die biblische Geschichte (2 Kön 252 Kön 25, KlglKlgl) nimmt der 9. Av, der seit rabbinischer Zeit (Juli/August) als ein Tag tiefster Trauer und strengen Fastens begangen wird. Der Tag dient der Erinnerung an die Zerstörung beider Tempel im Jahre 587/586 v. Chr. und 70 n. Chr. sowie aller weiterer Unglückstage. Seine Bedeutung liegt im gemeinschaftlichen Gedenken an das Leiden des Gottesvolkes in seiner Geschichte. Durch die Festlegung aller katastrophalen Ereignisse auf einen einzigen Termin verlieren diese ihren zufälligen Charakter. Als Teile des – auf Bewahrung und Erlösung zielenden – Geschichtsplans Gottes gelten sie vielmehr in tröstender Weise als seinem Willen untergeordnet.
Biblische Feste im Religionsunterricht
Biblische Feste im Jahreskreis und der jüdische Festkalender gehören zu den obligaten Themen des christlichen Religionsunterrichts. Zum einen geht es dabei um ihren Ursprung, ihre Legende, ihren Verlauf und ihre Funktion, insbesondere im Hinblick auf ihre Bedeutung als eine generationenübergreifend erinnernde Vergegenwärtigung heilsgeschichtlicher Ursprungserfahrungen und als eine Entfaltung der biblischen Tradition im Leben der Menschen. Zum anderen ermöglicht die hohe Bedeutung der Gemeinschaft und der sinnhaften |62|Erfahrung im Festgeschehen einen grundlegend positiven emotionalen Bezug der Schülerinnen und Schüler zum Lerninhalt und bietet in gleicher Weise einen Ansatzpunkt zahlreicher Ideen zu schülerorientierter Unterrichtsgestaltung. Die ritualisierenden Elemente im Festverlauf vermögen der Orientierung und der psychischen Stabilisierung zu dienen. Erlebte Festfreude und gemeinsames Essen und Trinken als symbolhafte Grunderfahrungen des Lebens schaffen eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis christlicher Gemeinschaft. Gerade in der symbolischen Verwirklichung von Gerechtigkeit durch die temporäre Aufhebung sozialer Grenzen (Dtn 5,14Dtn 5,14; 16,11Dtn 16,11; vgl. Mk 2,15–17parMk 2,15–17parr..; 6,35–44parMk 6,35–44parr.. u.ö.) formulieren biblische Feste einen kritischen Anspruch an die Realität.
Die Behandlung jüdischer Feste im christlichen Religionsunterricht vermag sich zunächst dadurch zu legitimieren, dass Jesus aus Nazareth die jahreszeitlichen Feste des Judentums mitgefeiert hat. Die synoptische Tradition stellt das letzte Abendmahl Jesu als Pesachmahl dar (vgl. Mk 14,12–25parMk 14,12–25parr..); der vierte Evangelist verbindet die Kreuzigung Jesu mit der Pesachtradition (Joh 18,28Joh 18,28; 19,14Joh 19,14.33–36). Die ersten Christen separierten sich erst allmählich von den Synagogengemeinden und übernahmen dabei jüdische Festmotive und -traditionen, markierten jedoch ihre Differenz durch eigene Festätiologien und -inhalte. So wird in der liturgischen Gestaltung des Osterfestes das Verständnis des Leidens, Sterbens und Auferstehens Jesu Christi im Licht der Erlösung im Exodusgeschehen erfahrbar. An den Termin des Wochenfestes rückte (unter Übertragung der Motive des Empfangs des Wortes Gottes und seines Geistes) das Pfingstfest. Chanukka und Weihnachtsfest entsprechen sich hinsichtlich der Lichtsymbolik als Ausdruck der Nähe des Wintersolstitiums (vgl. Joh 10,22Joh 10,22) sowie hinsichtlich der hier zum Ausdruck kommenden Gewissheit der rettenden Bewahrung durch das Eingreifen Gottes in die Weltgeschichte. Der im Ostergeschehen verankerte Sonntag als wöchentlicher christlicher Fest- und Ruhetag am ersten Tag der jüdischen Woche trat an die Stelle des Sabbats (1 Kor 16,21 Kor 16,2; Apg 20,7Apg 20,7; Offb 1,10Offb 1,10).
Juden und Christen teilen bis heute eine Reihe liturgischer Traditionen. Ebenso gehört der Erwerb religionskundlicher Kenntnisse über die biblische Lebenswelt und den jüdischen Festkalender zu den Lernzielen des Religionsunterrichts. Der Vergleich jüdischer und christlicher Feste vermag zugleich zur Entstehung eines Bewusstseins der eigenen Identität als auch zur Toleranz und zur Anerkennung der religiösen Differenz beizutragen. Besonders das Motiv der gemeinschaftlichen Festfreude gestattet hier positiv besetzte emotionale Zugänge zum „anderen“ Glauben. Eine Problemanzeige betrifft die vordergründig handlungsorientierte Übernahme jüdischer Festbräuche und Praktiken im Unterricht (z.B. die Simulation eines Sederabends), die sowohl als unzulässige Vereinnahmung des Judentums als auch als eine zu starke christliche Identifikation mit dieser eigenständigen und gleichberechtigten Weltreligion empfunden werden kann.
|63|Leseempfehlungen
Beilharz, Richard, Feste. Erscheinungs- und Ausdrucksformen, Hintergründe, Rezeption. Weinheim 1998.
Büchner, Frauke, „Wenn du weißt, was du tust, bist du gesegnet!“. Schabbatfeiern im christlichen Religionsunterricht? ZPT 3 (1998), 354–366.
Dschulnigg, Peter/Müllner, Ilse, Jüdische und christliche Feste. NEB.Themen 9. Würzburg 2002.
Ebner, Martin et al. (Hg.), Das Fest. Jenseits des Alltags. JBTh 18. Neukirchen-Vluyn 2004.
Galley, Susanne, Das jüdische Jahr: Feste, Gedenk- und Feiertage. München 2003.
Otto, Eckart/Schramm, Tim, Fest und Freude. Stuttgart et al. 1977.
Pusch, Magdalene, Wie Weihnachten? Drei Religionen und ihre Freudenfeste. Religionsunterricht primar. Göttingen 2007.
Rüpke, Jörg, Zeit und Fest. Eine Kulturgeschichte des Kalenders. München 2006.
Safrai, Shmuel, Die Wallfahrt im Zeitalter des Zweiten Tempels. Neukirchen-Vluyn 1981.
Sieg, Ursula, Feste der Religionen. Werkbuch für Schulen und Gemeinden. Düsseldorf 2003.
Themenheft „Feste feiern und erinnern“. Grundschule Religion 5 (2003).
Themenheft „Feste feiern wie sie fallen“. Religion 5–10 (2/2016).
Themenheft „Judentum heute“. KatBl 140 (2015).
Tilly, Michael/Mayer, Reinhold, Art. Feste. TBLNT 1 (1997), 451–455.
Tilly, Michael, Das Judentum, Wiesbaden 62015.
Trepp, Leo, Der jüdische Gottesdienst. Gestalt und Entwicklung. Stuttgart 22004.
Wick, Peter, Die urchristlichen Gottesdienste. BWANT 150. Stuttgart 22003.
Wilms, Franz-Elmar, Freude vor Gott. Kult und Fest in Israel. Regensburg 1981.
Jerusalem
Katja Soennecken/Dieter Vieweger
Die Bedeutung Jerusalems für die Geschichte und Kultur, besonders aber die Religion ist kaum zu überbieten. In dieser Stadt befinden sich herausragende heilige Stätten der drei großen monotheistischen Weltreligionen – des Judentums, des Christentums und des Islam. Sie galt und gilt noch heute vielen Menschen als Mittelpunkt der Welt. Didaktisch wäre mit Jugendlichen und Erwachsenen grundsätzlich zu diskutieren, was eigentlich „heilig“ und „Heiligkeit“ bedeutet? Was macht einen Ort „heilig“ und einen anderen nicht? Ändert der Besuch einer „heiligen Stätte“ etwas, verändert er den Glauben des Besuchers oder diesen selbst? Warum hat es für viele Menschen eine große Bedeutung, die Orte zu besuchen, an denen die Erzählungen „heiliger Texte“ spielen?
|64|Frühe Geschichte
Der älteste Stadtteil Jerusalems liegt außerhalb der heutigen Altstadt auf dem Südosthügel (hebr. ‘īr dawid/arab. Silwan). Die Jebusiter, eine kanaanäische Volksgruppe, gründeten diese Stadt um 1800 v. Chr. an der Gihon-Quelle (Jos 15,63Jos 15,63; Ri 1,21Ri 1,21; 1 Kön 1,331 Kön 1,33.381. Kön 1,38) und gaben ihr den Namen Uruschalim („die Stadt von Schalim“, dem Gott der Morgenröte).
Die biblische Erzählung in 2 Sam 5,6–102 Sam 5,6–10 berichtet, dass König David Jerusalem 998/7 v. Chr. mit List eingenommen habe, wobei Joab mit seinen Kämpfern durch einen Wassertunnel in die Stadt eingedrungen sei und so die jebusitischen Einwohner überraschen konnte. Seither nannten die Israeliten Jerusalem auch „Stadt Davids“ (2 Sam 5,72 Sam 5,7). Jerusalem, die Hauptstadt des judäischen Reichs, wurde zum Symbol für Eigenständigkeit und Freiheit im verheißenen Land, die David erkämpft und erfolgreich etabliert haben soll. Wie genau allerdings das davidische und salomonische Jerusalem aussah, lässt sich schwer sagen. So konnten beispielsweise diverse bisher unternommene Grabungen in Jerusalem – trotz bisweilen anderslautender Interpretation – keinen königlichen Ausbau, ja nicht einmal größere Bauten aus dem 10. Jh. v. Chr. sicher nachweisen.
Jerusalem selbst wurde vielleicht bereits von David und Salomo (2 Kön 6+2 Kön 672. Kön 7), entscheidend aber erst später durch König Hiskija im 8. Jh. v. Chr. nach Norden und (Nord-)Westen erweitert. Hiskija ließ einen neuen Stadtteil bauen, vermutlich um die Flüchtlinge aus dem von den Assyrern besiegten Nordreich aufzunehmen, und den Schiloa-Tunnel (2 Kön 20,202 Kön 20,20; 2 Chr 32,302 Chr 32,30) anlegen. Dieser Tunnel und die bald folgende assyrische Belagerung 701 v. Chr. sind seltene Fälle, bei denen sich biblische und außerbiblische Texte sowie archäologische Befunde unmittelbar ergänzen und ein klareres Bild der Vergangenheit schaffen. Dies bietet die Möglichkeit, über das Verhältnis von biblischem Text und außerbiblischen Quellen zu sprechen. Auch lässt sich an diesem Beispiel in einem Vergleich der biblischen Erzählungen über die Rettung Jerusalems aus der assyrischen Belagerung einerseits und dem Tenor der assyrischen Nachrichten Sanheribs (Hiskija wurde in Jerusalem wie ein „Vogel im Käfig“ eingeschlossen; er zahlte Tribut) andererseits über die historische „Wahrheit“ und Aussageabsicht von Texten sprechen.
Als sich etwa 100 Jahre später König Zidkija weigerte, Tribut an die Babylonier zu zahlen, zögerte Nebukadnezar II. nicht, Jerusalem ein erstes Mal im Jahr 598/97 v. Chr. (JerJer; 2 Kön 24,10–172 Kön 24,10–17) und endgültig 587/86 v. Chr. (2 Kön 252 Kön 25) zu erobern. Die Oberschicht wurde ins babylonische Exil geführt und Jerusalem bewusst zerstört. Nachdem Kyros II. mit der friedlichen Einnahme Babylons dem neubabylonischen Reich 539 v. Chr. ein Ende bereitet hatte, gewährte er den Exilierten, in ihre Heimat zurückzukehren (Kyros-Edikt; Esra; mehrere Rückkehrwellen). Es sollte aber noch bis 440 v. Chr. dauern, bis Jerusalem wieder eine Stadtmauer erhielt (Nehemia). Die Größe der Stadt des Königs Hiskija wurde erst unter den Hasmonäern (2./1. Jh. v. Chr.) wieder erreicht. Herodes d. |65|Gr. fügte dieser Stadt im Norden ein neues Viertel hinzu. Erst Herodes Agrippa I. (41–44 n. Chr.) dehnte die Stadt bis zur heutigen Nordmauer der Altstadt aus.
Der Tempel und jüdische Traditionen
In Kapitel 24 des zweiten Buches Samuel wird berichtet, dass der Jerusalemer Tempel an der Stelle erbaut wurde, an der David den Engel Gottes gesehen hatte, welcher seine Hand über Jerusalem ausstreckte, um die Stadt mit der Pest zu schlagen. Außerdem verbindet sich im Judentum mit dem Tempelberg die Erzählung von der beabsichtigten Opferung Isaaks durch Abraham auf einem Berg im Land Morija (Gen 22Gen 22). Eine dritte, jüngere Mitteilung im AT (2 Chr 3,1 f.)2 Chr 3,1f. verschmolz den Bericht über den Bau des Tempels in Jerusalem auf der ehemaligen Tenne Arawnas im Nachhinein mit der davon ehemals unabhängigen Erzählung vom Opfer Abrahams, da der Schauplatz dieser Sage, der Berg im Land Morija, offenbar nicht (mehr) bekannt war.
Die Tenne Arawnas hat aber nicht allein der Tradition des Berges Morija eine neue Heimat gegeben, sondern im Judentum wird auch behauptet, der Fels habe schon bei der Schöpfung der Welt eine Rolle gespielt. Von diesem „Fels der Gründung“ soll Gott die Erde genommen haben, aus der er Adam bildete. In diesem Zusammenhang legt es sich nahe, vergleichend die additionale Zusammenstellung von Heiligtumslegenden moderner Wallfahrtsorte (christlicher wie dem „Jakobsweg“ oder säkularer wie „Woodstock“) zu reflektieren.
Der Jerusalemer Tempel wird in 1 Kön 6–81 Kön 6–8 beschrieben. Nach den Angaben des AT wurde der Bau von König Salomo Mitte des 10. Jh.s v. Chr. begonnen und dauerte sieben Jahre. Er soll etwa 30 m lang, 10 m breit und 15 m hoch gewesen sein. Die Vorhalle war noch einmal 5 m lang. Seit der Kultreform Josias im Jahr 622/621 v. Chr. war der Jerusalemer Tempel der einzige legitime Ort, um Gott zu opfern (2 Kön 22–232 Kön 22–23). Was bedeutet es, nur an einer Stelle opfern zu können? Warum, wie oft und wie weit pilgern Menschen? Hierbei lassen sich auch die jüdischen Pilgerfeste (Pascha, Schawuot, Sukkot) und deren Zusammenhang mit dem orientalischen Jahreszyklus besprechen. Außerdem erscheint hier die Verbindung zum christlichen Ostern, Pfingst- und Erntedankfest relevant.
Im August 587 v. Chr. wurde der Tempel vom babylonischen König Nebukadnezar II. zerstört; wenige Jahrzehnte später, zwischen 520 und 516 v. Chr., wieder aufgebaut (Esra). Die Bundeslade und der Cheruben-Thron waren verbrannt. Seither blieb das Allerheiligste leer.
Die „Glanzzeit“ des Tempels begann mit dessen Umbau durch Herodes d. Gr. im Jahr 21 v. Chr. Damals erhielt das Jerusalemer Heiligtum unter Wahrung seiner biblischen Vorgaben ein zeitgemäßes griechisch-römisches Gepräge und befand sich nun innerhalber einer gewaltigen Tempelanlage, deren Größe man heute noch an der Umfassungsmauer des Haram asch-Scharif nachvollziehen kann.
|66|Während der Regierung des römischen Kaisers Titus wurde im Jahre 70 n. Chr., am Ende des Jüdischen Kriegs, trotz heftiger Gegenwehr der Juden auch der Tempel von den Römern erobert. Danach legten diese ganz Jerusalem, einschließlich seines Heiligtums, in Schutt und Asche. Einige Kultgegenstände transportierten sie als Siegestrophäen nach Rom, wo sie dem römischen Volk in einem gewaltigen Triumphzug gezeigt wurden. Noch heute sieht man diese Szene in Stein gemeißelt auf dem im Jahre 81 n. Chr. von Kaiser Domitian, dem Bruder des Titus, errichteten „Titusbogen“ nahe dem Kolosseum in Rom.
Der Jerusalemer Tempel wurde auch von Jesus aus Nazareth besucht. Im NT wird beschrieben, dass er dessen baldige Zerstörung voraussagte: Mt 24,1 f.Mt 24,1f.; Mk 13,14Mk 13,14; Lk 21,5 f.Lk 21,5f. Viele Juden hatten bis zuletzt geglaubt, Gott selbst würde vor der Entweihung des Tempels durch die Römer zu ihren Gunsten in den Kampf eingreifen, was aber nicht geschah.
Wieso können solche Hoffnungen enttäuscht werden? Falsche Hoffnungen? Gottes Wille oder Unfähigkeit? Was geschieht im persönlichen Glauben mit enttäuschten Hoffnungen? Zum Aussehen des Jerusalemer Tempels sei auf den Möckmühler Arbeitsbogen „Tempel in Jerusalem zur Zeit Jesu“ verwiesen.
Das Jahr 70 n. Chr. bedeutete für das Judentum einen tiefen Einschnitt. Mit der Tempelzerstörung endeten alle kultischen Opferhandlungen. An deren Stelle traten u.a. die täglichen Gebete, die zu den Zeiten verrichtet werden, zu denen einst im Tempel die Opfer dargebracht wurden, das Studium der Tora sowie der Auftrag zu „Taten der Barmherzigkeit“.
Im Bar Kochba-Aufstand 132 bis 135 n. Chr. lehnten sich die Juden gegen die Entscheidung Hadrians auf, das in Trümmern liegende Jerusalem als römische Colonia Aelia Capitolina neu zu erbauen. Nach der Niederschlagung des Aufstandes mussten sie Jerusalem und dessen unmittelbares Umland verlassen. Auf dem ehemaligen jüdischen Tempelareal wurde ein Heiligtum zu Ehren Jupiters gegründet.
Seit dem 3., spätestens aber dem 4. Jh. n. Chr. gedenken fromme Juden in Jerusalem am 9. Tag des jüdischen Monats Av mit einem Fast- und Gedenktag der Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar II. und durch die Römer. Was bedeutet ein zentraler Ort der Erinnerung? Welche Funktion haben Mahnmale, Gräber, Gedenkorte und -tage? Welche vergleichbaren Orte des geschichtlichen Gedenkens besuchen Schüler noch heute?
Die Juden beten heute außerhalb des ehemaligen herodianischen Tempelbereichs an der Westmauer, der sogenannten Klagemauer. Als einziger für sie verbliebener Teil des ehemaligen Tempelareals wurde die westliche Umfassungsmauer des früheren Tempelberges angesichts ihrer Nähe zum zerstörten Allerheiligsten zum wichtigsten heiligen Ort des Judentums. Der Legende nach hat die Gegenwart Gottes (hebr. šekῑnā) diesen Ort auch nach der Tempelzerstörung nicht verlassen. Hier könne man deshalb Gott räumlich so nahe sein wie nirgends sonst auf der Welt. Daher stecken Gläubige bis heute ihre auf Zettel geschriebenen Anliegen in die Mauerritzen der Westmauer, um sie Gott nahe zu bringen. Es würde sich ein Vergleich verschiedener Orte und Formen des |67|Gottesdienstes anbieten. Tempel, Synagoge, Kirche, Moschee – was ist ähnlich, was ganz anders?
Christliche Traditionen
Als Kaiser Hadrian um das Jahr 135 n. Chr. auf dem Schutt des zerstörten Jerusalem die römische Stadt „Colonia Aelia Capitolina“ neu erbauen ließ, befahl er, auf dem ehemaligen jüdischen Tempelplatz ein Jupiterheiligtum und nördlich der heutigen Erlöserkirche ein Forum sowie einen großen römischen Tempel zu errichten. Häufig wird darauf hingewiesen, dass Hadrian den jüdischen Glauben durch seine Entweihung des Tempelberges in Vergessenheit bringen wollte und folglich auch den „anderen Juden“, den christlichen „Sektierern“, Gleiches antun musste, indem er das von ihnen schon früh verehrte Grab durch seinen Tempelbau überdeckte. Wieso konnte Hadrian die Christen als „jüdische Sekte“ ansehen?
Dennoch wurde Jerusalem zum Zentrum der frühen Christenheit – die Stadt gewann ihre Bedeutung als Ort der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Hier lebten die Urgemeinde und viele Apostel. Möglicherweise waren die ersten Christen angesichts der von ihnen erhofften Wiederkunft Jesu zu ihren Lebzeiten (1 Thess 4,13–181 Thess 4,13–18) weit mehr mit dem himmlischen Jerusalem beschäftigt als damit, lokale Marksteine des irdischen Lebens Jesu zu sichern.
Was die Evangelien über die Topografie der Kreuzigungsstelle berichten, lässt sich schnell übersehen. Diese lag nahe der Stadt (Joh 19,17Joh 19,17.20Joh 19,20), außerhalb der Stadtmauer (Mk 15,20Mk 15,20), nahe bei Gärten (Mk 15,21) und an einer gut sichtbaren Stelle (Mk 15,40Mk 15,40). Das Wort Golgota (Mk 15,22Mk 15,22; Mt 27,33Mt 27,33; Joh 19,17Joh 19,17) verweist auf einen sichtbaren Hügel oder gar auf einen „schädelförmigen“ Felsen. Das Grab Jesu lag nahe des Golgota-Felsens. Es handelte sich um ein in den Fels geschlagenes Grab, das mit einem Rollstein verschlossen werden konnte (Mk 15,46Mk 15,46). Es sei zudem neu gewesen (Mt 27,59f.) und unbenutzt (Lk 23,53Lk 23,53; Joh 19,41Joh 19,41).[1]
Bereits im 3. und vor allem im 4. Jh. n. Chr. wurde Jerusalem Ziel christlicher Pilgerreisen. Die bedeutendste der Pilgerinnen war die Kaisermutter Helena, die 326 n. Chr. nach Jerusalem reiste und der Legende nach viele christliche Erinnerungsorte wiederfand (u.a. auch das Kreuz Jesu). Nach dem Konzil von Nicäa 325 n. Chr. gab Kaiser Konstantin den Befehl, den von Hadrian errichteten Tempel abreißen zu lassen und an dessen Stelle die Grabeskirche zu errichten, weil man hier Golgota und das Grab Jesu vermutete.
638 n. Chr. wurde Jerusalem vom christlichen Patriarchen Sophronius friedlich an den Kalifen Omar übergeben. Es begann die mehr als hundert Jahre andauernde tolerante Herrschaft der Omayyaden. Die folgenden muslimischen Herrscher (Abbasiden, Fatimiden und Seldschuken) zeigten weniger Toleranz |68|gegenüber den „Ungläubigen“ und die Restriktionen nahmen zu. Die Zerstörung der Grabeskirche durch den Kalifen al-Hakim gab letztlich einen Anstoß für die Kreuzzüge. 1099 gelang es den Kreuzfahrern, Jerusalem einzunehmen (wobei sie ein Massaker anrichteten) und das Königreich von Jerusalem zu gründen. Im Jahr 1187 fand dieses durch die Eroberung Saladins ein Ende.