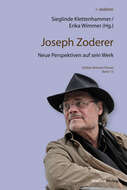Kitabı oku: «Hermann Broch und Der Brenner», sayfa 2
II. Kontext: „Anima naturaliter Christiana“ – Erweiterung des Ethik-Konzepts
Auch Dante verstand Vergils Dichtungen – und besonders die Aeneis – als Ausdruck einer „anima naturaliter Christiana“. In einem Selbstkommentar von 1942 zu seinem Roman hat Hermann Broch (im Sinne Haeckers) Dante als einen Dichter bezeichnet, der Vergil als den „ahnenden Künder des Christentums“ (KW 4, 467) verstanden habe. Die partielle Identifikation von Broch mit Dante hatte nicht zuletzt mit dem gemeinsamen Schicksal von Vertreibung und Exil zu tun. Das Motto aus dem „Inferno“, das Broch seinem Roman voranstellte, ist ein Hinweis auf den Subtext von Dantes Commedia.25
Haeckers Erinnerung an Vergil als „anima naturaliter Christiana“ hat Broch nicht einfach übernommen, sondern angereichert. Dabei ist es ihm besonders um die Individualisierung von Freiheit und Menschenwürde zu tun, woraus die Forderung nach Abschaffung der Sklaverei folgt. Parallel zum Vergil-Roman hat Broch in den frühen 1940er Jahren an seiner Massenwahntheorie (KW 12) gearbeitet. In ihr erkannte der Autor, dass in Hitlers Staat eine „neue Sklavenschicht“ im Entstehen begriffen war (KW 12, 40). Im nationalsozialistischen Deutschland sei der Zustand der „Vollversklavung“ für Juden und politische Gegner bereits eingetreten. Ihr konkreter Ausdruck wie ihr „Symbol“ sei das „Konzentrationslager“ (KW 12, 468). Wenn Broch das Konzentrationslager beschreibt, nimmt er Formulierungen vorweg, die sich ein halbes Jahrhundert später in Giorgio Agambens Studien26 finden. Broch schreibt:
Das Konzentrationslager ist die letzte Steigerung [...] jeder Versklavung. Der Mensch wird seines letzten Ich-Bewußtseins entkleidet; statt seines Namens erhält er eine Nummer und soll sich auch nur mehr als Nummer fühlen. Er ist zur Leiche geworden, bevor er noch gestorben ist [...]; der magische Gott der Versklavung ist [...] ein Aasfresser, der zehntausende, hunderttausende von Leichen braucht und auch nach Millionen noch unbefriedigt bleibt, der Nimmersatt, dem Hitler diente und mit dem er sich identifizierte [...]. Dies ist die Magie-Religion der Versklavung, und Hitlers Schatten geht in jedem Totalitärstaat um. (KW 12, 485).
Nach Broch ist man nur mit Hilfe des „Menschenrechts“ in der Lage, „Versklavung“ als „Rechtswidrigkeit“ (KW 12, 508) zu definieren. Die Menschenrechte, meinte er, müssten international anerkannt werden und global einklagbar sein. In der „Massenwahntheorie“ fasst Broch zusammen: „Der Satz von der unbedingten Verwerflichkeit der menschlichen Versklavung“ habe „als ‚irdisch absolut‘“ zu gelten und sei „an die Spitze des empirischen Menschenrechtes“ zu stellen (KW 12, 472). Er forderte die Etablierung eines internationalen Gerichtshofes für Menschenrechte, der den Vereinten Nationen, der UNO, zugeordnet werden solle (KW 11, 390).
Auch im Tod des Vergil steht das Thema der Versklavung im Vordergrund. Gleich zu Beginn seines Romans schildert Broch den Arbeitsalltag der Sklaven in der Hafenstadt Brundisium:
[...] die [..] Sklaven [waren] in langer Schlangenreihe [...] wie Hunde paarweise mit Halsringen und Verbindungsketten aneinandergekoppelt [...]. [D]ie beaufsichtigenden Schiffsmeister [schwangen] [...] auf gut Glück die kurze Geißel über die vorbeiziehenden Leiber, ohne Wahl und einfach drauflos, hinschlagend mit der sinnlosen [...] Grausamkeit uneingeschränkter Macht, bar jedes eigentlichen Zweckes, da die Leute ohnehin hasteten, was ihre Lungen hergaben, kaum mehr wissend, wie ihnen geschah [...]. (KW 4, 26)
In der Mitte von Brochs Roman kommt der Erzähler erneut auf das Elend der Sklaven zu sprechen, wenn Vergil eine „Menge“ beobachtet, die „jubelnd vor Lust, ein Kreuz umdrängte, an das schmerzbrüllend, schmerzwimmernd, ein unbotmäßiger Sklave angenagelt“ war, ein Anblick, der die apokalyptische Vision vom Ende des antiken Roms evoziert:
[...] und er sah, wie der Kreuze mehr und mehr wurden, wie sie sich vervielfältigten, fackelumzüngelt, flammenumzüngelt, ansteigend die Flammen aus dem Geprassel des Holzes, aus dem Geheul der Menge, ein Flammenmeer, das über die Stadt Rom zusammenschlug, um abebbend nichts zurückzulassen als geschwärzte Ruinen, zerborstene Säulenstümpfe, gestürzte Statuen und überwuchertes Land. (KW 4, 234)
Der erinnerten Realität der „Tragsklaven“ (KW 4, 34) und dem imaginierten Untergang Roms stehen hoffnungsvolle Traumgesichte des sterbenden Vergil gegenüber. In ihnen bildet sich die „Stimme“ eines Sklaven heraus. Der Sklave in den Fieberphantasien des Brochschen Vergil ist keine im Kontext des Romans als real vorzustellende Person wie etwa Augustus oder der Dichterfreund Plotius Tucca. Der Sklave artikuliert neue ethische Vorstellungen, die sich im Bewusstsein des sterbenden Autors formen. Es artikuliert sich eine innere Stimme der Hoffnung auf eine Zeitenwende, in der sich die Wertmaßstäbe Roms verkehren. In seinen politischen Schriften hält Broch fest, dass „das Christentum“ anfänglich eine „Sklavenreligion“ war, „vielfach verbunden mit einer ausgesprochenen [...] Non-Resistance-Bewegung“ (KW 12, 479). Dem Sklaven in Brochs Roman ist die „Gnade“ zu teil geworden, „den Bruder im Bruder zu wissen“. „Held“ sei nicht, wer „mit klirrender Waffengewalt“ auftrumpfe, sondern derjenige, „der die Entwaffnung erträgt“ (KW 4, 252). Die Stimme des Sklaven weist Vergil die Position zwischen den Epochen zu: „Du sahest den Anfang, Vergil, bist selber noch nicht der Anfang, du hörtest die Stimme, Vergil, bist selber noch nicht die Stimme: [...] noch nicht und doch schon, dein Los an jeder Wende der Zeit“ (KW 4, 253). Vergils besondere kulturhistorische Stellung als „anima naturaliter Christiana“ zwischen den Epochen wird durch die Formel „noch nicht und doch schon“ unterstrichen.
In seinen Fieberträumen hört Vergil das Gebet des Sklaven, das christliche Erwartungen ausspricht und Bildsymbole der Evangelisten benutzt: „Unbekanntester, Unerschaubarster, Unaussprechlichster [...]. Löwe und Stier sind zu Deinen Füßen gelagert, und der Adler schwebt auf zu Dir. [...] Du schickst den aus zum Heile, der sich nicht auflehnt.“ (KW 4, 253) Der Engel wird nicht eigens erwähnt, wenn die Bildsymbole der Evangelisten genannt werden, aber die Stimme des Sklaven selbst steht für den Engel, der als „Mittler“ zu dem bezeichnet wird, „der den Ruf empfangen“ (KW 4, 399) soll. In den religiösen Kontext gehört auch das Bekenntnis des Sklaven: „wir werden auferstehen im Geiste“ (KW 4, 346). Die Sklavenstimme deutet nicht nur auf den neuen Glauben hin, der die kommende Kulturepoche Roms bestimmen wird, sondern markiert auch einen revolutionären politischen Kurswechsel: Abgewertet wird die soziale Ordnung des cäsaristischen Roms, wenn „der Staat“ als „lächerlich und irdisch“ (KW 4, 342) bezeichnet wird gegenüber dem „Ewigen“ des Glaubensreiches, das „ohne Tod“ sei (KW 4, 344). In den Fiebervisionen erteilt der Sklave dem Cäsar Augustus „die Erlaubnis zum Sprechen“ (KW 4, 389), und die Verkehrung der Rolle von Herr und Knecht ist evident, wenn der Cäsar als verelendeter Sklave geschildert wird. Da heißt es: „Nun erhob sich der Augustus von seinem Lumpenlager; er wankte unsicheren Schrittes daher, an seinem Halsring baumelte [...] ein Kettenende“. Vergil sieht den „zwergig“ gewordenen „Cäsar“ ins „Nichts“ schrumpfen (KW 4, 397).
Das sind Fieberphantasien, und man könnte sie in einem Zusammenhang mit den Saturnalien im antiken Rom sehen, bei denen – mit Bachtin27 zu sprechen – „karnevalistisch“ die Standesunterschiede aufgehoben und die Rollen von Herren und Knechten vertauscht werden. Augustus verweist in Brochs Roman während seines Gesprächs mit Vergil die „Freiheit“ des Staatsbürgers auf den befristeten Zeitraum der „Saturnalien“ (KW 4, 342). Das sieht Vergil anders. Er formuliert sein Testament um, dessen Neuerung in der Freilassung seiner Sklaven besteht. Der Cäsar weiß die Geste seines Autors nicht zu würdigen, wenn er feststellt, dass zur „Wirklichkeit Roms“ der Sklavenstand gehöre. Er habe zwar „das Los der Sklaven gebessert“, aber „der Wohlstand des Reiches“ benötige „Sklaven“, die „sich in diese Wirklichkeit einzuordnen“ hätten. Gegen jene, die „die Ordnung trotzig zu stören wagen“, müsse „hart“ vorgegangen werden (KW 4, 346), wobei er an das Schicksal des Spartacus erinnert. Vergil bleibt aber bei seinem Vorsatz, den der Cäsar zwar missbilligt, aber als Ausnahme genehmigt. So enthält denn das zweite Testament des Vergil, das es – wohlgemerkt – nur in Brochs Roman gibt,28 die zusätzliche Klausel: „Der Erlaubnis des Augustus gemäß, bin ich befugt meine Sklaven freizulassen; dies soll sofort nach meinem Ableben geschehen, und jeder dieser Sklaven hat für jedes Jahr, das er in meinen Diensten verbracht hat, ein Legat von hundert Sesterzen ausbezahlt zu erhalten.“ Im Tod des Vergil ist von einem „ersten“ und einem zweiten „Testament“ die Rede, wobei man erfährt, dass das „erste [...] ungeschmälert in Kraft“ bleibe (KW 4, 410). Hier wird auf das alte und das neue Testament der christlichen Religion angespielt, nach der das „alte“ ebenfalls Gültigkeit behält.
III. Kontext: Tod, Ruhm und Unsterblichkeit
Schaut man Brochs Schriften zur Ästhetik und Philosophie durch, stößt man oft auf Stellen, die seine Beschäftigung mit den Themen Tod, Ruhm und Unsterblichkeit belegen. „Jede Philosophie zielt auf den Unsterblichkeitsgedanken“ (KW 9/1, 353), heißt es da. Oder: „Die Geschichte ist noch nicht die absolute Unsterblichkeit“ (KW 9/2, 155). Broch hielt viel von Sigmund Freuds Psychoanalyse, doch war er kein unkritischer Anhänger der Freudschen Theorien und in der Auffassung vom Tod wich er von ihnen ab. Das hing mit einem unterschiedlichen Kulturverständnis zusammen. Kulturelle Aktivität ist bei Broch nicht primär als Triebsublimierung, sondern als etwas anthropologisch Grundsätzlicheres zu verstehen: „Denn die Natur des Menschen ist seine Kultur“, schreibt Broch (KW 9/2, 62).29 Die Absolutheit der Natur sei dem Menschen durch das Bewusstsein seiner Endlichkeit, seines Todes, präsent (KW 9/2, 125). Kultur sei zu verstehen als „die Absolutheit des Lebenswertes, die der Absolutheit des Todes entgegengesetzt“ werde (KW 9/2, 126), d.h. die Auflehnung des Lebens gegen den Tod. „Das Antlitz des Todes ist der große Erwecker!“ (KW 9/2, 124) hielt Broch fest.30 Die „religiösen Wertsysteme“ (KW 9/2, 130) der Menschheitskultur hätten „die absolute Befreiung vom Tode“ (KW 9/2, 125–130) angestrebt. Das „christlich-platonische Weltbild des Mittelalters“ habe in diesem Sinne ein „unendliches Wertziel“ (KW 9/2, 145) gekannt. Der europäischen Moderne sei jedoch die Orientierung auf ein „unendliches Wertziel“ abhanden gekommen, da jedes Partialsystem seine profanen Wertziele verabsolutiere.
In einem Selbstkommentar zum Tod des Vergil betonte Broch, dass „Unendlichkeits- und Todeserkenntnis“ im „Mittelpunkt seines Werkes“ stehen (KW 4, 494).31 In diesem Roman wird „Dichtung“ mit „Todeserkenntnis“ (KW 4, 77) bzw. „Erkenntnis des Todes“ (KW 4, 301) gleichgesetzt. Der Rat, den die Stimme des Sklaven Vergil erteilt, lautet: „[B]egreife im Leben den Tod, auf daß er dein Leben erhelle“ (KW 4, 251). Dem Roman liegt eine ethisch orientierte Ästhetik zugrunde, die auf die Ablehnung jener Kunst hinausläuft, die die Forderung nach „Todeserkenntnis“ nicht erfüllt. Zu den falschen Zielen der Kunst gehöre der „Ruhm“ als „irdische Unsterblichkeit“ (KW 4, 232).32 Die selbstkritischen Äußerungen Vergils über die Aeneis haben damit zu tun, dass er Konzessionen an den Ruhm des Imperiums gemacht habe. Die untergehende Kulturepoche des Augustus habe er fälschlich als zukunftsträchtig, ja als Beginn eines neuen Goldenen Zeitalters mit dem Kaiser als Heilsbringer gelobt. Vergils Abneigung gegen sein Hauptwerk geht so weit, dass er dessen Vernichtung erwägt, es „verbrannt“ sehen möchte (KW 4, 167).33 Die Freunde Vergils und vor allem Augustus sind in Vorstellungen von Ruhm als irdischer Unsterblichkeit befangen. „Bloß die Lüge ist Ruhm, nicht die Erkenntnis!“ (KW 4, 15) hält Vergil in strenger Entgegensetzung fest. Unerträglich wird dem Autor das Gespräch mit Augustus, der die Aeneis zur Glorifikation seiner Amtszeit gerettet und veröffentlicht sehen will. Da heißt es: „Der Cäsar war ruhmsüchtig, immer wieder sprach er vom Ruhm“ (KW 4, 308). Wegen Vergils Absicht, die Aeneis zu verbrennen, kommt es zu einem Wutausbruch Octavians.34 Eingedenk der alten Verbundenheit, die bis in die gemeinsam verbrachten Kindheitstage zurückreicht, schenkt Vergil schließlich Augustus das Manuskript der Aeneis. Das ist ein Zeichen der Freundschaft und der Versöhnung. Der Autor ist sich aber auch bewusst, dass die Aeneis in jeder Hinsicht dem Augustus – als Repräsentanten einer überholten Kultur – gehört. Eigentlich, so meint Vergil, hätte er das Werk zerstören, es als „Opfer“ (KW 4, 361, 363) darbringen sollen, ein Opfer im Dienst einer neuen, nur erahnten Religion. Im Gespräch mit Augustus hat Vergil die Grenzen von Macht und Politik benannt, die der religiösen und damit kulturellen Wiedergeburt gewiesen sind. Aber gleichzeitig hat er auch die Schranken bezeichnet, die für „Kunst“ und „Philosophie“ (KW 4, 323) gelten, wenn es um das Erkennen des „Heilbringers“ (KW 4, 358) als des „Erlösers“ (KW 4, 360) geht: Die Funktion der Religionsstiftung können sie nicht übernehmen.
Dichtung und Philosophie sollen aber einen Beitrag leisten, wenn es gilt, zwischen Ruhm und Unsterblichkeit zu unterscheiden. Dabei geht es im Tod des Vergil nicht lediglich um Projektionen eines Romanciers der klassischen Moderne, sondern um Bestimmungsversuche eines poeta doctus.35 Der „Begriff des Menschen“ ist nach Broch eine „platonische Idee“, d.h. der Mensch könne nicht auf die Zeitspanne „zwischen körperlicher Geburt und körperlichem Tod“ eingeschränkt werden, vielmehr sei „seine Würde“ im „apriori Zeitlosen“ verankert. Die menschliche „Tragik“ sei nicht „die des Sterbens“, sondern „die des Erkennens“ (KW 10/1, 34). Mit Platons Ideen- wie Seelenlehre und dessen Auffassung von der Unsterblichkeit war der Autor vertraut.36 Die hatte der griechische Philosoph im Dialog Phaidon dem Sokrates in den Mund gelegt: Vor seinem Tod erläutert Sokrates den Schülern die Unsterblichkeit der Seele. Im dritten Beweis wird postuliert, dass die Seele den Körper beherrsche und in dieser Funktion dem Göttlichen, dem Unveränderlichen und Unsterblichen ähnlich sei. Davon wusste Homer noch nichts. Bei ihm ist von einer Ähnlichkeit der Existenzweise zwischen den sterblichen Menschen und den Göttern als den Todlosen keine Rede. Den unsterblichen Göttern ist der Olymp vorbehalten, von den Menschen jedoch verbleiben auf ewig nur Schatten im Hades.37 Allerdings ist den Verstorbenen eine Surrogat-Unsterblichkeit als Nachruhm auf Erden möglich.38
Broch zitierte öfters den Ersten Korintherbrief des Apostel Paulus: Zum ersten wegen der zentralen Bedeutung, die Paulus dort der Liebe in der neuen Religion zuweist (KW 10/2, 171), zum zweiten wegen der These von der Unsterblichkeit der Seele und drittens wegen der erkenntnistheoretischen Aussage, dass man im Irdischen alles wie „durch einen Spiegel in einem dunklen Wort“ (KW 10/1, 176) nur rätselhaft und stückweise, nach dem Tode aber ganz erkennen könne.
Mit der Unsterblichkeit der Seele zum einen und mit dem irdischen, profanen, innerweltlichen Nachruhm zum anderen sind bereits jene beiden Arten vom Weiterleben nach dem Tode benannt, wie sie die europäische Geistesgeschichte prägen und wie sie in ihrer markanten Differenz auch in Brochs Tod des Vergil festgehalten werden. Die Dogmen der Kirchenlehrer von der Unsterblichkeit einer auf Erlösung ausgerichteten Seele des Einzelmenschen weicht von dem ab, was im vorchristlichen Abendland an Ideen zu diesem Komplex zirkulierte. Einflüsse von Platon und vor allem seines Wiederentdeckers Plotin auf christliche Mystiker sind jedoch nachzuweisen. Einer der Lieblingsautoren Brochs war Plotin. Dieser vertrat die Idee einer göttlichen Weltseele, deren Emanationen sich in materialen Körperwelten finden und die im Menschen eine Sehnsucht nach dem göttlichen Ursprung hinterlassen. Das sind Vorstellungen, deren Spuren man von Augustinus über Meister Eckhart und Goethe bis zu Broch verfolgen kann.39 Die Begriffe des Todes und der Unsterblichkeit bei Broch sind mystisch geprägt.40 Zu erinnern ist an Brochs frühe Faszination durch Meister Eckhart, zum zweiten an seine Beschäftigung mit der chassidischen Mystik, die bereits in den frühen 1920er Jahren begann (Martin Buber-Lektüre)41 und bis in die späten 1940er Jahre reichte (Besuch Gershom Scholems bei Broch).42 Wie der Mensch teilhat am Ewigen, auf welche Weise die Seele zur Vereinigung mit Gott drängt, ist die Frage, die Meister Eckhart beschäftigt und die auch Broch in seinem Roman stellt. Beide stimmen darin überein, dass es etwas im Menschen gibt, das ewiges Leben hat. Beide sind auch Platoniker in dem Sinne, dass sie in der vergänglichen Kreatur die unvergänglichen Urbilder zu erkennen suchen, wobei das vollkommene Sein, das Göttliche, an sich nicht zu begreifen ist. Die These Eckharts, dass man Göttliches als „Fünklein im Seelengrunde“ (KW 1, 532; KW 6, 65) schweigend erspüren könne, findet sich wiederholt im fiktionalen wie essayistischen Werk Brochs.
In einem frühen Brief von 1925 formuliert Broch Gedanken zum Zusammenhang von Tod, Unsterblichkeit und Erkenntnis. Er unterscheidet nicht lediglich zwischen Körper und Seele, sondern kennt ein Körper-Ich und ein Denk-Ich. Während ersteres sterblich sei, könne man bei letzterem nicht im gleichen Sinne von einem Ende durch den „Tod“ sprechen. Im „Ich-Bewusstsein“ liege vielmehr – das erinnert an Platons Phaidon – „der logische Rückhalt eines jeden Unsterblichkeitsglaubens“. Würde das Ich-Bewusstsein „vom Körperlichen losgelöst sein und faktisch die gesamte Wirklichkeit [...] erkennen können, so hätte es das Bewußtsein eines Gottes“ und müsste als solches „unsterblich“ sein. Das sei zwar unmöglich, doch nähere sich das Bewusstsein mit jedem Schritt „in der Erkenntnisarbeit“ diesem „Ziel“ an. Daher rühre „das unerhörte Glücksgefühl“, wenn man eine „neue Erkenntnis“ gefunden habe. „Ich bin fest überzeugt“, schreibt Broch in diesem Brief von 1925, „daß ein stetes Arbeiten um die Erkenntnis der Welt am Schluss des Lebens nicht verloren geht, nicht nur, weil man der Welt eine neue Erkenntnis gebracht hat, die unverloren bleibt, sondern weil sich das Ich eine Annäherung an die Unsterblichkeit erkämpft hat.“ (KW 13/1, 63)
Broch weicht hier offensichtlich von der Unsterblichkeitsvorstellung der christlichen Erlösungsreligion ab. Nicht gute Werke im Sinne der Parabeln und Gebote Christi oder der Gnadenakt Gottes vermitteln ein ewiges Leben der Einzelseele, sondern die Erkenntnisleistung des indivuellen Ich-Bewusstseins. Gott ist gleichsam die Totalerkenntnis, und menschlich-partielle Erkenntnisdurchbrüche bedeuten für den erkennenden Menschen eine Annäherung an Gott und seine Ewigkeit. Im Tod des Vergil hat Broch diese elitäre, den Mitgliedern von Wissenschaft und Kunst vorbehaltene Aufnahme in eine Art Erkenntnishimmel ergänzt durch einen christlichen Weg hin zur Unsterblichkeit. Da geht es um Nächstenliebe, um faktische Freiheitserweiterung für andere. Während der sterbende Vergil weiß, dass sein literarisches Werk keinen Erkenntnisdurchbruch markiert, ist er sicher, dass er mit der Sklavenbefreiung den richtigen praktischen Schritt zur Entgrenzung der Ethik seiner Zeit getan hat.
Broch kannte auch die philosophischen und literarischen Unsterblichkeits-Deutungen der Renaissance, der Aufklärung und der Klassik. Er teilte seinen Vergilroman in vier Kapitel ein, die nach den Elementen „Wasser“, „Feuer“, „Erde“ und „Äther“ benannt sind. Es ist wahrscheinlich, dass er dabei durch Paracelsus und seine Elementenlehre beeinflusst war. Wie Paracelsus von einem „Elementarleib“ des Menschen spricht, der aus Erde und Wasser besteht und ihn mit den anderen Naturwesen teilt, so kennt er einen „astralischen Leib“ aus Luft und Feuer, der den Menschen mit dem All verbindet. Darüber hinaus gesteht Paracelsus dem Menschen als geistigem Wesen die „anima“ zu.43 Wie später bei Broch ist es dem Menschen schon nach Paracelsus möglich, durch „Erkennen“ die göttlichen Kräfte wahrzunehmen und sich dadurch Gott zu nähern. Die Voraussetzung dafür liege darin, dass Gott nicht außerhalb, sondern innerhalb der Schöpfung vorhanden sei. Auch Spuren der Mikro- und Makrokosmostheorien des Paracelsus mit den postulierten Entsprechungen sind in Brochs Roman zu entdecken. Im Tod des Vergil ist vom „großen Gleichgewicht zwischen dem Ich und dem All“ (KW 4, 133) auf die eine oder andere Weise oft die Rede.
Mit Spinoza hatte sich bereits der frühe Broch auseinandergesetzt, wie seinen Philosophischen Schriften (KW 10/1, 150, 162, 199) zu entnehmen ist. Obwohl Spinozas Pantheismus von einer impersonalen Gottheit ausgeht und sich das menschliche Individuum durch den Tod ins Naturganze (natura naturans) auflöst, bestand Spinoza darauf, dass sich vom menschlichen Geist etwas erhalte, das ewig sei.44 Das ist dem 23. Lehrsatz im 5. Teil seiner Ethik, mit der Broch vertraut war, zu entnehmen.
Beeinflusst durch Paracelsus entwickelte Leibniz seine Vorstellung der Monade, die den Mikrokosmos des Universums spiegelt und die Verbindung zur göttlichen Zentralmonade garantiert. Für die Leibniz-Generation war die Unsterblichkeit der Seele eines der großen philosophischen Themen. Die menschliche Seele wird als unzerstörbare Monade verstanden, die zu Gott als „Urmonas“ ein Verhältnis hat wie das Kind zum Vater und sich im Sinne der Vervollkommnung auf das göttliche Urbild hinentwickelt. Broch steht in einer Tradition des Leibnizschen neuplatonischen Denkens über Unsterblichkeit, da hier philosophische Überlegungen die theologischen abgelöst haben, ohne die Idee der Perfektibilität der Einzelseele aufzugeben.
Moses Mendelssohn, noch unter dem Einfluss von Leibniz stehend, knüpfte an Platons Dialog Phaidon an, als er die Gespräche Phaidon oder über die Unsterblichkeit der Seele publizierte, ein Buch, das sich in Brochs Wiener Bibliothek befand.45 Sokrates ist hier ein Philosoph, der gleichsam Mendelssohnsche Theorien über die Unsterblichkeit der Seele verbreitet. Auch Mendelssohn spricht vom Erkennen der Wahrheit, die der Seele auferlegt sei. Gelöst von den körperlichen Fesseln könne dieses Erkennen nach dem Tod besser fortschreiten.46 Auch bei Mendelssohn wird die erkenntnismäßige Vervollkommnung als Glückszustand, weil als Annäherung an Gott verstanden.47 Brochs Überzeugung von der Annäherung an die Unsterblichkeit qua Erkenntnisleistung teilte er mit Paracelsus, Spinoza und Mendelssohn.
Die französischen Beiträge aus der Zeit des späten 17. Jahrhunderts zum Thema Unsterblichkeit waren viel weniger durch ein theologisches Erkenntnisinteresse bestimmt. Fontenelle, dessen Dialogues des morts in ihrer Zeit viel Aufsehen erregten, war der Meinung, dass die Seele substanzlos und somit sterblich sei.48 Solche Thesen hinterließen ihre Spuren bei den Vertretern der französischen Aufklärung. Im 18. Jahrhundert verliert der christliche Glaube bei der Intelligenz an Boden, und es setzt sich die Auffassung einer rein innerweltlichen Unsterblichkeit durch, d.h. die Vorstellung vom Weiterleben der ‚großen Tat‘ des Einzelmenschen in der Geschichte. Die Unsterblichkeit der Seele wird kaum noch diskutiert, und wenn sich Diderot und Falconet in einer umfangreichen Korrespondenz über die Vorstellungen von „Unsterblichkeit“ austauschen, geht es nur noch um Ruhm, der entweder schon zu Lebzeiten einsetzt (dann aber nicht gesichert ist) oder sich erst im Lauf der Zeit festigt und den folgenden Geschlechtern selbstverständlich erscheint. Die Nachwelt, heißt es, ist das Tribunal, auf dem über den Ruhm entschieden wird. Dieser Gedanke durchzieht auch das Gesamtwerk von Jean-Jacques Rousseau.49 Im Gespräch zwischen Kaiser Augustus und Vergil in Brochs Roman geht es dem Autor um die Profilierung des Unterschieds zwischen der irdischen Unsterblichkeit, um die es dem Cäsar zu tun ist, und Vergils Vorstellung von der metaphysischen Unsterblichkeit qua Erkenntnisleistung oder Liebestat.
Die Einflüsse Spinozas und Mendelssohns auf Goethes Gedanken zum Thema Unsterblichkeit sind bekannt. Goethe nimmt wohl ein persönliches Fortleben nach dem Tod als gegeben an, wenn er auch nicht zu wissen vorgibt, wieviel an individueller Potenz bewahrt bleiben wird. Wie Leibniz war er von der Vervollkommnung der Seele im Sinne eines ins Unendliche gehenden Progressus überzeugt. Beweisführungen in Sachen Unsterblichkeit hat Goethe vermieden, vielmehr hat er sich auf die individuelle Überzeugung berufen.50 In Sachen Unsterblichkeit hatten beide Autoren mit Platon, Spinoza und Leibniz gemeinsame Lehrmeister. Man darf annehmen, dass Broch, der ein Verehrer von Goethes Werken war,51 dessen Vorstellungen von der Unsterblichkeit zustimmend rezipiert hat.
Im Tod des Vergil werden Fragen von Schicksal und Selbstbestimmung, Exil und Heimat, Gründungsmythen und Religionskrise, Kritik und Macht, Ethik und Politik, Freundschaft und Liebe, Ruhm und Unsterblichkeit angeschnitten. Wie in anderen Romanen Brochs – den Schlafwandlern von 1932, der Verzauberung von 1935 und den Schuldlosen von 1950 – geht es Broch auch im Tod des Vergil von 1945 nicht nur um die dichterische Gestaltung eines kulturellen Zerfalls, sondern auch darum, die Konturen einer neuen Ethik auszumachen. Parallel dazu versuchte der Autor in seiner Massenwahntheorie ein neues „Ethos der Welt“ (KW 11, 202)52 zu markieren, das international relevant sein werde. Die Wendung „Ethos der Welt“ benutzte Broch ein halbes Jahrhundert bevor Hans Küng den Begriff „Welt-Ethos“ prägte, und in beiden Fällen ist Vergleichbares gemeint. Der Tod des Vergil ist ein Buch, das sich im Gewand des historischen Romans mit der europäisch-westlichen Kulturkrise auseinandersetzt, das aber mit seiner Thematik der Anti-Versklavung auf eine menschheitlich-globale Ethik verweist. Das ist bei der Massenwahntheorie nicht anders. Darin ging Broch von transatlantischen Erfahrungen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust aus, doch machte er hier Vorschläge zur globalen Einklagbarkeit der Menschenrechte. Mit beiden Werken ist dem Autor kein Ruhm zuteil geworden, vielleicht aber ein Stück Unsterblichkeit in dem von ihm verstandenen Sinne.