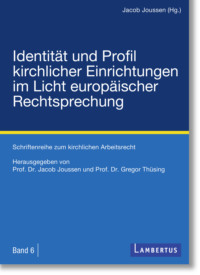Kitabı oku: «Identität und Profil kirchlicher Einrichtungen im Licht europäischer Rechtsprechung», sayfa 2
2. Unterschiedliche Rollen und Eigenlogiken von EGMR, Bundesverfassungsgericht und EuGH
2.1 Selbstverständnis des EGMR als Hüter einer pan-europäischen Grundrechtsordnung
Der EGMR ist das gerichtliche Überwachungsorgan einer derzeit 47 Mitgliedstaaten umfassenden europäischen Grundrechtsordnung.4 Diese Grundrechtsordnung reicht vom Atlantik bis hinter den Ural. Sie umfasst Staaten mit höchst unterschiedlichen Verfassungs- und Grundrechtstraditionen, die in Bezug auf das Thema „Religion“ ein laizistisches Modell wie das französische ebenso abbilden wie die Church of England oder Staatskirchen und staatskirchenähnliche Strukturen in Skandinavien, Polen, Griechenland oder Irland.5 Der EGMR hat daraus den Schluss gezogen, dass er den Mitgliedstaaten beim Umgang mit Religionsfragen einen weiten Einschätzungsspielraum belässt und diesen nur auf einen gemeinsamen Minimalstandard prüft.6 Mit einem solchen Ansatz hat er das französische Verbot der Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit ebenso für konventionskonform erklärt7 wie das Anbringen von Kruzifixen in Klassenzimmern in staatlichen italienischen Schulen.8 Außerdem hat er in drei Entscheidungen aus dem Jahr 2010 die Grundstrukturen des kirchlichen Individualarbeitsrechts in Deutschland gebilligt, aber freilich schon damals den Akzent auf die gerichtliche Überprüfung gelegt und damit in einem Fall einen Konventionsverstoß bejaht.9 Dieser besondere Akzent auf der gerichtlichen Überprüfbarkeit ist in einem spanischen Fall im Jahr 2014 nochmals bestätigt, vielleicht sogar noch verstärkt worden.10 Der Fall, in dem es um einen vom spanischen Staat beschäftigten Religionslehrer im Fach katholische Religion ging, der offen gegen das Zölibatsgebot für katholische Priester eintrat und als inzwischen verheirateter (ehemaliger) katholischer Priester auch persönlich betroffen war, wurde mit der äußerst knappen Mehrheit von 9:8 Stimmen zugunsten Spaniens entschieden, obwohl unter dem Gesichtspunkt der Verkündigungsnähe und unter Berücksichtigung der Aufgaben in der schulischen Lehre wenig Zweifel an der Rechtfertigung einer Nichtverlängerung des Beschäftigungsverhältnisses wegen der Art der konkreten Tätigkeit bestehen konnten.11 In den Gründen wird dabei ausdrücklich die Notwendigkeit der gerichtlichen Kontrolle betont, wenn der Gerichtshof zunächst das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften als Grundlage für Loyalitätsobliegenheiten anerkennt, dann aber fortfährt:
„That being said [dass aus dem Selbstbestimmungsrecht Loyalitätsobliegenheiten abgeleitet werden können, C.W.], a mere allegation by a religious community that there is an actual or potential threat to its autonomy is not sufficient to render any interference with its members’ rights to respect for their private or family life compatible with Article 8 of the Convention. In addition, the religious community in question must also show, in the light of the circumstances of the individual case, that the risk alleged is probable and substantial and that the impugned interference with the right to respect for private life does not go beyond what is necessary to eliminate that risk and does not serve any other purpose unrelated to the exercise of the religious community’s autonomy. Neither should it affect the substance of the right to private and family life. The national courts must ensure that these conditions are satisfied, by conducting an in-depth examination of the circumstances of the case and a thorough balancing exercise between the competing interests at stake.“ 12
In der Gesamtschau ist die Rechtsprechung des EGMR zur korporativen Rechtspositionen von Religionsgemeinschaften nicht zuletzt deshalb besonders bemerkenswert, weil der EGMR – anders als alle mitgliedstaatlichen Gerichte – in Religionsfragen nicht auf eine gewachsene Struktur eines „Religionsrechts“ zurückgreifen kann.13 Solche Rechtstraditionen haben sich in den meisten innerstaatlichen Rechtsordnungen herausgebildet und geben vielfach eine Grundtendenz vor. Die französische Laizität oder auch das deutsche Modell der freundlichen Kooperation sind offensichtliche Beispiele. Der EGMR musste deshalb die kirchliche Rechtsposition in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten überhaupt erst einmal als eine grund- und menschenrechtliche entwickeln, was er in den genannten Entscheidungen (und auf der Basis früherer Rechtsprechung zu ähnlich gelagerten Problemen der korporativen Religionsfreiheit) überzeugend getan hat.14
Insgesamt stellt die EMRK so einen relativ flexiblen Rahmen bereit, in den sich das deutsche kirchliche Arbeitsrecht einfügen lässt. Bei aller Flexibilität muss man allerdings eine wichtige Grenze betonen, die im Erfordernis effektiver gerichtlicher Kontrolle liegt. Schon die Formulierung des Prüfungsmaßstabs im Zitat aus der Entscheidung Fernández Martínez mahnt eine strenge gerichtliche Überprüfung an. Nimmt man die knappe Mehrheit und die deutliche Position in den Minderheitenvoten hinzu,15 so wird deutlich, dass der EGMR den Mitgliedstaaten zwar unter Heranziehung des Konzepts der margin of appreciation durchaus Spielraum bei der Ausgestaltung der arbeitsrechtlichen Beziehungen mit und durch Religionsgemeinschaften gewährt, ihnen zugleich aber auch in Bezug auf die Gewährung von Rechtsschutz klar formulierte Grenzen setzt.
2.2 Das Bundesverfassungsgericht in der Tradition des religionsoffenen und kirchenfreundlichen Grundgesetzes
Wie bereits erwähnt, stellt sich die Ausgangslage für das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich anders dar. Es operiert in einem gewachsenen und gefestigten verfassungsrechtlichen Rahmen, der im Falle des Religionsrechts bis in das Jahr 1919 zurückreicht. Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften ist in Art. 137 Abs. 3 WRV garantiert und steht dementsprechend im Mittelpunkt der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung, die bis heute maßgeblich durch eine Entscheidung aus dem Jahr 198516 geprägt wird.
Es gibt gute Gründe dafür, diese religionsoffene Tradition für die Bewältigung der gegenwärtigen Integrationsaufgaben in Deutschland fortzuschreiben.17 Es ist aber auch offensichtlich, dass dies nicht überall und ganz einhellig so gesehen wird, sondern dass vielmehr durchaus unterschiedliche Positionen über den richtigen Umgang mit dem Thema „Religion“ in den gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten in Deutschland bestehen. Man muss insoweit nur an die Diskussionen um muslimischen Religionsunterricht oder islamische Theologie an staatlichen Universitäten erinnern, von Kopftüchern in Schule oder Gerichtssaal ganz zu schweigen. Es war nicht zuletzt das Bundesverfassungsgericht selbst, das – durch seinen Zweiten Senat – in seiner ersten Kopftuchentscheidung aus dem Jahr 2004 eine auf stärkere Trennung und auf Distanz ausgerichtete Neutralitätskonzeption ins Spiel gebracht hatte,18 inzwischen aber mit der – vom Ersten Senat beschlossenen – zweiten Kopftuchentscheidung wieder den offenen und religionsfreundlichen Grundcharakter des Grundgesetzes betont.19
Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen religionsverfassungsrechtlichen Entwicklungen wirkt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum kirchlichen Arbeitsrecht aus dem Jahr 2014 merkwürdig aus der Zeit gefallen. Die spätestens seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts intensiv geführte Debatte um den richtigen Umgang mit Religion, insbesondere mit dem Islam, spiegelt sich in der Entscheidung auch nicht ansatzweise wider. Das Gericht zitiert mit großer Selbstverständlichkeit die staatskirchenrechtlichen Klassiker aus der Literatur und aus seiner Rechtsprechung aus den 1970er und 1980er Jahren. So heißt es etwa unter Berufung auf die berühmte Lumpensammler-Entscheidung aus dem 24. Band20:
„Bei der Würdigung dessen, was im Einzelfall als korporative Ausübung von Religion und Weltanschauung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 und 2 GG anzusehen ist, muss der zentralen Bedeutung des Begriffs der "Religionsausübung" durch eine extensive Auslegung Rechnung getragen werden.“21
Wenig vorher heißt es:
„Der Staat erkennt die Kirchen in diesem Sinne als Institutionen mit dem originären Recht der Selbstbestimmung an, die ihrem Wesen nach unabhängig vom Staat sind und ihre Gewalt nicht von ihm herleiten.“22
Auffällig ist auch, dass die Entscheidung – wie auch an der zitierten Stelle – fast ausschließlich von den „Kirchen“ spricht. Der Begriff der Religionsgemeinschaften wird nur sehr sparsam verwendet.23 Macht man aber mit der Gleichheit aller Religionen (und Weltanschauungen, Art. 137 Abs. 7 WRV) ernst (und diese Gleichbehandlung ist ausdrücklicher Bestandteil der Weimarer Bestimmungen, die von der „Kirche“ nur im Kontext des Verbots einer Staats “kirche“ sprechen, im Übrigen aber die Begriffe Religionsgesellschaft und Weltanschauungsgesellschaft verwenden), dann müssen sich die Aussagen für alle Religionen und Weltanschauungen verallgemeinern lassen. Aber kann man das so ohne Weiteres annehmen? Hätte das Gericht wirklich die Wendungen vom „originären Recht der Selbstbestimmung“ und von der „ihrem Wesen nach vom Staat unabhängigen Gewalt“ mit der gleichen Selbstverständlichkeit auch für Moscheegemeinden formuliert? Hätte es vor dem Hintergrund der Debatten um Kopftuch und Burka auch mit Blick auf den Islam eine „extensive Auslegung der Religionsfreiheit“ gefordert?
Mit dieser kritischen Betrachtung der Entscheidung aus dem Jahr 2014 soll in keiner Weise die Grundprämisse von der großen Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften in Frage gestellt werden und es soll auch nicht bezweifelt werden, dass dem Selbstverständnis der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine zentrale Bedeutung zukommen muss.24 Gerade wenn der Staat seinen Charakter als „säkularer Staat“ bewahren will (und dies zu tun ist in einer religiös pluralen Gesellschaft unerlässlich)25, dann darf er sich nicht zum Interpreten von Glaubenslehren machen und darüber entscheiden, „was die wahre Religion fordert oder die Religion in Wahrheit fordert.“26 Auch insoweit liefert die Chefarzt-Entscheidung aus dem Jahr 2014 zweifelhafte Passagen. Das Gericht erweckt zumindest in den Formulierungen den Eindruck als mache es sich die Konzepte der „tätigen Nächstenliebe“27 und der christlichen Dienstgemeinschaft selbst zu eigen.28
Umgekehrt führt aber eben auch kein Weg daran vorbei, dass bei kollidierenden Grundrechtspositionen am Ende eine staatliche Stelle eine Entscheidung treffen muss. Dieser Rechtsschutzaspekt wird in der zitierten Entscheidung des EGMR deutlicher akzentuiert als es das Bundesverfassungsgericht in seiner Darstellung der Rechtsprechung des EGMR wahrhaben will,29 wenn es betont, das staatliche Gericht muss „bei der Gewichtung religiös geprägter Abwägungselemente (z.B. spezifische Nähe der Tätigkeit des Arbeitnehmers zum Verkündigungsauftrag) den Standpunkt der verfassten Kirche und Religionsgemeinschaft seiner Entscheidung zugrunde legen, sofern es hierdurch nicht in Widerspruch zu Grundprinzipien der Rechtsordnung gelangt“.30
Insgesamt hat das Bundesverfassungsgericht 2014 eine Gelegenheit verpasst, der grundsätzlich begrüßenswerten offenen Haltung gegenüber dem religiösen Selbstverständnis eine moderne und verallgemeinerungsfähige Begründung zu verleihen. Gerade weil fast ausschließlich von den Kirchen (statt allgemeiner von Religionsgemeinschaften spricht) die Rede ist, liest sich die Entscheidung wie ein Sonderrecht für die christlichen Kirchen. Der Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass sich das Gericht zwar mit der EMRK und der Rechtsprechung des EGMR auseinandersetzt, aber das Antidiskriminierungsrecht der Europäischen Union mit keinem einzigen Wort erwähnt, obwohl das AGG und die Richtlinie 2000/78/EG erkennbar einschlägig waren und im fachgerichtlichen Verfahren eine erhebliche Rolle gespielt hatten.31 Dass man mit solch einem „Retrotrip mit Variationen“32 vor dem EuGH kein Gehör gefunden hat, darf eigentlich niemanden überraschen.33
2.3 Der EuGH als Motor der Integration und als Hüter des europäischen Antidiskriminierungsrechts
Rolle und Perspektive des EuGH unterscheiden sich wiederum grundlegend sowohl von derjenigen des EGMR als auch von derjenigen des Bundesverfassungsgerichts. Im Grunde genommen haben Fragen der Religion für den EuGH bis vor wenigen Jahren kaum eine Rolle gespielt. Abgesehen von einem frühen dienstrechtlichen Fall,34 wurde der EuGH erst in den vergangenen Jahren intensiver mit Auswirkungen der Religionsfreiheit oder des mitgliedstaatlichen Religionsrechts konfrontiert. Dessen ungeachtet haben gerade die deutschen christlichen Kirchen potentielle Auswirkungen des Unionsrechts schon sehr früh bedacht und bei der Rechtserzeugung auf die Entwicklung Einfluss zu nehmen versucht. Gerade die vorliegend umstrittenen Regelungen in Art. 4 Abs. 2 RL 2000/7835 und in Art. 17 AEUV gehen auf die Aktivitäten der beiden christlichen Kirchen zurück, die maßgeblich aus Deutschland angestoßen und betrieben wurden.36
Für den EuGH waren und sind die Einheitlichkeit der Unionsrechtsordnung und ihre Durchsetzung gegenüber den Mitgliedstaaten die entscheidenden Parameter. In der Literatur ist insoweit von einer „gelegentlich kühn vorwärtsweisenden weitsichtigen Rechtsprechung“ die Rede.37 Das Selbstverständnis der früheren EWG als Wirtschaftsgemeinschaft wirkt vielfach noch in der Rechtsprechung nach, auch wenn insbesondere mit dem Raum der Freiheit der Sicherheit und des Rechts zahlreiche Rechtsfragen von grundsätzlicher rechtsstaatlicher Bedeutung verbunden sind.38 Hinzu kommt, dass das Unionsrecht immer als eine Querschnittsmaterie verstanden wurde, die Einfluss auf die unterschiedlichsten Teilgebiete des innerstaatlichen Rechts hat. Der EuGH hat dabei durchgängig keine Rücksicht auf vermeintlich nicht von den Unionskompetenzen erfasste Rechtsbereiche genommen und insbesondere die Grundfreiheiten flächendeckend durchgesetzt. In der Gesamtschau ist diese Rechtsprechung überzeugend.39 In ihr finden sich dementsprechend zahlreiche Beispiele, in denen nicht in die Zuständigkeit der Union fallende Bereiche von Auswirkungen der Grundfreiheiten oder anderen Regelungen des Unionsrechts erfasst sind. Ein frühes Beispiel betrifft das Verwaltungsprozessrecht.40 Besonders intensiv wurden die Auswirkungen des Diskriminierungsverbots auf den Zugang von Frauen zu Streitkräften diskutiert.41 Auch das Steuerrecht ist ein Beispiel.42 Im Ergebnis ist es sicher nicht falsch, wenn dem EuGH aufgrund dieser Tradition unterstellt wird, er zeige wenig Sensibilität für die Besonderheiten religionsrechtlicher Fragestellungen.43 Die Urteile zum Kopftuch am Arbeitsplatz lassen sich jedenfalls gut in diesem Sinne deuten.44
Ein Weiteres kommt hinzu: Anders als der EGMR hat der EuGH nie eine eigene Dogmatik der Verschiedenheit und der Rücksichtnahme auf mitgliedstaatliche Besonderheiten entwickelt. Bei aller Unübersichtlichkeit und allen Schwierigkeiten der Konturierung im Einzelfall liefert die vom EGMR verwendete Doktrin der margin of appreciation doch zumindest einen Anhaltspunkt für die Zurücknahme der euopäischen gerichtlichen Kontrolle. Beim EuGH lassen sich zwar verstreute Ansätze für eine ähnliche Form der Rücksichtnahme auf mitgliedstaatliche Besonderheiten finden,45 eine entsprechende Dogmatik gibt es aber bislang nicht und der EuGH hat sich auch nicht darum bemüht, die vom EGMR gerade für religionsrechtliche Fragen angelegte Spur46 aufzunehmen und unionsrechtlich weiterzuverfolgen.47
2.4 Zwischenfazit
In einem kurzen Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass die Perspektiven der drei maßgeblichen Gerichte sehr unterschiedlich sind. Während der EGMR sich auf die Festlegung und Durchsetzung eines im gesamten Europa der 47 Europaratsstaaten akzeptablen Mindestmaßstabs beschränkt und dementsprechend einen beträchtlichen Ausgestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten im Rahmen der margin of appreciation akzeptiert, versteht sich der EuGH als Hüter der Einheitlichkeit der Unionsrechtsordnung, zu der er insbesondere auch die Durchsetzung des Antidiskriminierungsrechts der Union rechnet. Dementsprechend ist die Kontrolldichte höher und die Bereitschaft zur Rücksichtnahme auf mitgliedstaatliche Besonderheiten geringer. Das Bundesverfassungsgericht wiederum judiziert auf der Basis gewachsener religionsrechtlicher Strukturen, zu denen in Deutschland eine religionsoffen verstandene Neutralität und die Berücksichtigung des Selbstverständnisses der Religionsgemeinschaften gehören. Im konkreten Fall des kirchlichen Arbeitsrechts hat es aber in seiner Entscheidung aus dem Jahr 2014 versäumt, die Begründung für diese religionsfreundliche Herangehensweise an die geänderten Bedingungen einer religiös pluraleren und (in nicht unerheblichen) Teilen auch säkulareren Gesellschaft anzupassen.
3. Maßgebliche Weichenstellungen in der Rechtsprechung des EuGH in den Rechtssachen Egenberger (C-414/16) und IR (C-68/17) und ihre Auswirkung auf die deutsche Rechtslage
Im Folgenden werden die maßgeblichen Weichenstellungen durch den EUGH beschrieben, kritisch gewürdigt und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die deutsche Rechtslage analysiert. Zum einen geht es um die Auslegung der Ausnahmeklausel in Art. 4 Abs. 2 RL 2000/78 (3.1), zum zweiten um den Umfang des gerichtlichen Rechtsschutzes (3.2) und zum dritten um die Bedeutung des sog. „Kirchenartikels“ in Art. 17 AEUV (3.3.).
3.1 Auslegung von Art. 4 Abs. 2 RL 2000/78 (EG) und Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften
3.1.1 Die Vorgaben des EuGH
Ausgangspunkt für die Auslegung muss zunächst einmal der Wortlaut der Ausnahmeregelung sein. Wie nicht selten im Unionsrecht ist dieser umständlich und bei Art. 4 Abs. 2 RL 2000/78 (EG) zudem auch sehr lang. Die Vorschrift lautet:
„(2) Die Mitgliedstaaten können in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, Bestimmungen in ihren zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie geltenden Rechtsvorschriften beibehalten oder in künftigen Rechtsvorschriften Bestimmungen vorsehen, die zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie bestehende einzelstaatliche Gepflogenheiten widerspiegeln und wonach eine Ungleichbehandlung wegen der Religion oder Weltanschauung einer Person keine Diskriminierung darstellt, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. Eine solche Ungleichbehandlung muss die verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Grundsätze der Mitgliedstaaten sowie die allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts beachten und rechtfertigt keine Diskriminierung aus einem anderen Grund.
Sofern die Bestimmungen dieser Richtlinie im Übrigen eingehalten werden, können die Kirchen und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, im Einklang mit den einzelstaatlichen verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Rechtsvorschriften von den für sie arbeitenden Personen verlangen, dass sie sich loyal und aufrichtig im Sinne des Ethos der Organisation verhalten“.
Entscheidend für den EuGH ist die im Zitat hervorgehobene Stelle. Der EuGH legt diese Vorgabe in Egenberger eng anhand des Wortlauts aus und verlangt, dass sich die im Ethos der Organisation begründete Anforderung entweder aus der „Art“ der Tätigkeit oder aus den „Umständen“ ihrer Ausübung ergeben muss.48 Diese Auslegung führt dazu, dass – anders als es die Erwägungsgründe nahelegen und auch die Formulierung von Art. 4 Abs. 2 RL mit dem Verweis auf die „bestehenden einzelstaatlichen Gepflogenheiten“ andeutet – das bestehende einschlägige Religionsrecht der Mitgliedstaaten nicht vollumfänglich von den Wirkungen der Richtlinie ausgenommen wird, sondern die Qualifikation über die Art der Tätigkeit oder die Umstände ihrer Ausübung als zusätzliches Erfordernis beachtet werden muss. Diese enge Auslegung anhand des Wortlauts ist sicherlich auch dann ohne Weiteres vertretbar, wenn der Europäische Gesetzgeber beim Erlass der Richtlinie eine umfassendere Ausnahme vor Augen gehabt haben sollte.49 In der praktischen Konsequenz bedeutet dies, dass die Notwendigkeit der Kirchenmitgliedschaft nicht mehr mit übergreifenden Konzepten wie dem der Dienstgemeinschaft begründet werden kann, sondern die Gerichte insoweit eine Überprüfung anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls vornehmen müssen.50
In Bezug auf die in UAbs. 2 von Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie angesprochenen Loyalitätsobliegenheiten wird der in Egenberger entwickelte Ansatz übernommen. Maßgeblich hierfür sind eine systematische Interpretation beider Absätze und der Umstand, dass UAbs. 2 verlangt, dass die „Bestimmungen der Richtlinie im übrigen eingehalten sind“. In der Konsequenz bedeutet dies, dass auch die Loyalitätsanforderungen nur dann verlangt und durchgesetzt werden können, wenn dies nach der Art der konkreten Tätigkeit oder den Umständen ihrer Ausführung „eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt.“51