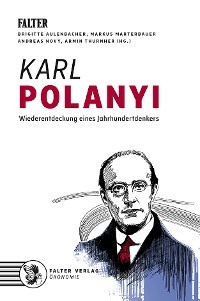Kitabı oku: «Karl Polanyi», sayfa 3
Es handelt sich bei diesem Text um einen neu zusammengestellten Auszug aus: Michael Burawoy (2015), Public Sociology – Öffentliche Soziologie gegen Marktfundamentalismus und globale Ungleichheit (hg. von Brigitte Aulenbacher und Klaus Dörre und aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Regine Othmer). Beltz Juventa: Weinheim und Basel.
„DU ALS DEUTSCHER BIST NICHTS MEHR WERT“
Der Aufstieg des Rechtspopulismus – eine Arbeiterbewegung von rechts?
KARINA BECKER UND SOPHIE BOSE
In zahlreichen frühindustrialisierten Ländern sind wir derzeit mit dem Aufstieg rechtspopulistischer Formationen konfrontiert, die eine Zäsur für das politische System darstellen. Zwar rekrutieren populistische Parteien ihr Elektorat grundsätzlich aus allen Klassen und Schichten der Bevölkerung, es fällt jedoch auf, dass sie bei der Arbeiterschaft auf überdurchschnittliche Zustimmung stoßen. US-Präsident Donald Trump verdankt seinen Wahlsieg nicht nur Stimmen aus der Mittelschicht und dem Kleinbürgertum, sondern auch aus dem deindustrialisierten Rust Belt der USA.
Die von der rechtspopulistischen UKIP federführend betriebene Brexit-Kampagne fand in der Arbeiterschaft überdurchschnittliche Zustimmung. In Österreich votierten bei der Bundespräsidentenwahl 85 Prozent der Arbeiter und Arbeiterinnen für den FPÖ-Kandidaten Hofer (insgesamt 46,2 % der Stimmen), sein siegreicher Konkurrent Van der Bellen kam in dieser Statusgruppe auf gerade einmal 15 Prozent. In Frankreich erzielt der Rassemblement national (ehemals Front national) seit den 1990er-Jahren Spitzenwahlergebnisse in ehemaligen Hochburgen der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF).
Auch die Wahlerfolge der Alternative für Deutschland (AfD) fügen sich in dieses Muster. Die AfD war neben der FDP die eigentliche Gewinnerin der Bundestagswahl 2017. In den ostdeutschen Bundesländern hat sie insgesamt Ergebnisse einer Großpartei erzielt, in Sachsen ist sie mit 27 Prozent sogar die stimmenstärkste Kraft. Laut Analysen von infratest dimap haben überdurchschnittlich viele Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Arbeitslose (jeweils 21 %) die AfD gewählt, aber auch in anderen Berufsgruppen und im Bereich der mittleren Bildungsabschlüsse konnte sie Stimmen im zweistelligen Bereich für sich gewinnen. Bei den Gewerkschaftsmitgliedern hat die AfD mit 15 Prozent leicht überdurchschnittliche Unterstützung; bei den Gewerkschaftsmitgliedern im Osten Deutschlands liegt sie mit 22 Prozent gleichauf mit der Linkspartei. Gerade in den Kohorten, die von Erwerbstätigen geprägt werden, verzeichnet sie Zugewinne, und zwar insbesondere bei den Männern in der Altersgruppe von 25 bis 59 Jahren.
Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage, wie die hohe Akzeptanz der völkischen Rechten unter Arbeitern und Arbeiterinnen – auch gewerkschaftlich organisierten – zu erklären ist und ob wir es gar mit einer Arbeiterbewegung von rechts zu tun haben?
Eine Bewegung Polanyi’schen Typs
Um dies zu beantworten, ist es unseres Erachtens geboten herauszufinden, unter welchen Bedingungen sich der Aufstieg rechtspopulistischer Formationen vollzieht. Karl Polanyis Konzept der Doppelbewegung hilft uns dabei zu verstehen, was sich derzeit in Gestalt eines völkischen Populismus ereignet und in einigen Ländern wie beispielsweise Deutschland zuspitzt. Durch marktradikale Ideologien forciert, wurden in den letzten Jahren marktbegrenzende Institutionen und Organisationen geschwächt, Märkte sozial entbettet und marktabhängige Individuen oder Gruppen einem Wettbewerbsprinzip ausgesetzt, bei dem einige gewinnen und andere verlieren. Die Entbettung von Märkten, als deren Folge die fiktiven Waren Arbeit, Boden und Geld so behandelt werden, als seien sie Waren wie jede andere, hat im globalen Maßstab Gegenbewegungen vor allem von unten hervorgerufen. Damit verbindet sich eine Kapitalismuskritik, die nicht wie in der Analyse Karl Marx’ an klassenspezifischen Ungleichheiten und Ausbeutung ansetzt, sondern an den gesellschaftszerstörenden Konsequenzen dieser Entwicklung.
Bewegungen Polanyi’schen Typs richten sich gegen eine marktgetriebene Transformation moderner Gesellschaften. Was wir derzeit auch im Wahlverhalten beobachten, interpretieren wir als eine Art imaginärer, konformistischer Revolte in Opposition zur weit getriebenen Marktsteuerung von Erwerbsarbeit. Sie richtet sich gegen die Universalisierung von Marktvergesellschaftung und Konkurrenz und vor allem gegen deren Folgen.
Ökonomische Marktmacht wirkt diffus und abstrakt, sie lässt sich selten eindeutig zuordnen, und die Kritik an ihr kann in unterschiedliche Richtungen politisiert werden. Bewegungen gegen den Markt können, wie die frühen sozialistischen Arbeiterbewegungen, systemtranszendierende Ziele verfolgen; sie können aber auch bloßen Schutz vor marktvermittelter Konkurrenz einfordern und reaktiv-nationalistische oder, wie im Falle faschistischer Mobilisierungen, geradezu terroristische Züge annehmen.
Konflikt zwischen innen und außen
„Du als Deutscher bist nichts mehr wert.“ Mit diesen und ähnlichen Wahrnehmungen wurden wir in Interviews mit männlichen, gewerkschaftlich aktiven Industriearbeitern konfrontiert, die wir im Jahr 2017 in Sachsen führten. Anhand dieser Forschung wollen wir Einblicke dahingehend geben, wie sich befragte gewerkschaftlich aktive, rechts orientierte Arbeiter ihre eigene Lebenssituation und die sie umgebende Wirklichkeit erklären und illustrieren, dass der gegenwärtige völkische Nationalismus und dessen Attraktivität für Arbeiterinnen und Arbeiter als Bewegung Polanyi’schen Typs gedeutet werden kann.
Von uns befragte Arbeiter, bei denen wir rechtspopulistische Orientierungen ausmachen, verorten sich selbst in der gesellschaftlichen „Mitte“ oder bezeichnen sich als „ganz normal“. Sie sind zwar mit ihrer persönlichen Lebenssituation relativ zufrieden, blicken aber mit Sorge auf die immer größer werdende „Schere zwischen Arm und Reich“. Trotz ihrer aktuellen Zufriedenheit haben sie das Gefühl, nicht dem zu entsprechen, was ihnen gemeinhin als normales und erstrebenswertes Lebensmodell präsentiert wird. Mit zwei Kindern kommen beispielsweise zwei der acht Befragten trotz ihrer Vollzeiterwerbstätigkeit und der ihrer Lebenspartnerinnen nur gerade so über die Runden. Urlaubsreisen und regelmäßige Restaurantbesuche mit der ganzen Familie, die für sie zu einem „normalen“ Leben dazugehören, können sie sich nicht leisten. Sie fühlen sich als „arbeitende deutsche Bürger“ und „kleine Leute“ nicht angemessen anerkannt sowie materiell entlohnt. Gegenüber Flüchtlingen fühlen sie sich benachteiligt, da für diese nun plötzlich Geld da sei, nachdem jahrelang nicht in das Bildungssystem oder in den sozialen Wohnungsbau investiert wurde.
Ob für die Flüchtlinge, die überbezahlten Politiker oder Griechenland – immer sei der kleine deutsche Arbeiter „der Zahlemann der Nation“. Die Befragten konstruieren „die Deutschen“ als Gemeinschaft ehrlicher, hart arbeitender Menschen, die von der eigenen Regierung betrogen wird. Das reale soziale Problem, dass nicht wenige Lohnabhängige selbst mit einer Vollzeittätigkeit mit ihren Familien nur gerade so über die Runden kommen, wird hier national überformt: Ihnen als Deutschen stünde ein besseres Leben, soziale Absicherung und Anerkennung zu, ethnisch „Fremden“ und Personen, die nichts zum Wohlstand des Landes beigetragen hätten, hingegen nicht. Sie sollen ausgegrenzt, in Sammelunterkünften untergebracht und ausschließlich mit den nötigsten Sachleistungen versorgt werden.
Zu dem Gefühl, nicht dem entsprechen zu können, was als „normal“ gilt, gesellen sich entwertende Arbeitsbedingungen. Ein autoritärer Führungsstil der Vorgesetzten, Bevormundung, wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten für Beschäftigte und ausbleibende Lohnerhöhungen gehören zu den prägenden Erfahrungen und sind nach Aussagen befragter Gewerkschaftssekretäre in den untersuchten Regionen keineswegs eine Ausnahme. Erfahrungen solcher Art können dazu beitragen, dass sich Menschen ohnmächtig und permanent benachteiligt fühlen, dass Frust und Wut wachsen. Diese Gefühle münden keineswegs zwangsläufig in eine rechtspopulistische oder gar völkische Bewegung, können jedoch von solchen mobilisiert werden.
Bei unseren Befragten spielen spezifisch ostdeutsche Erfahrungen eine bedeutende Rolle. Viele Ostdeutsche erlebten infolge der sogenannten Wende 1989/90 in rasantem Tempo eine Entwertung von fast allem, was bis dato gegolten hatte. Als Ostdeutsche waren sie gegenüber Westdeutschen nicht nur in ökonomischer Hinsicht benachteiligt; sie fühlten sich als Bürger und Bürgerinnen Ostdeutschlands auch in kultureller Hinsicht von westdeutscher Politik, von Arbeitgebern und anderen bevormundet, abgewertet und in ihren Lebensrealitäten nicht anerkannt.
Gefühle solcher Art entsprechen realen Benachteiligungen und Anerkennungsdefiziten, sind Ostdeutsche doch bis heute in allen Bereichen der Positionseliten und Medien unterrepräsentiert. Die Löhne und die Qualität der Arbeit sind in Ostdeutschland nach wie vor niedriger als in Westdeutschland. Nach den tiefgreifenden erwerbsbiografischen, sozioökonomischen und demografischen Umbrüchen der Wendezeit haben viele Ostdeutsche gerade erst wieder eine gewisse Normalität und Stabilität erreicht, die sie nun mit der Ankunft von Geflüchteten erneut bedroht sehen.
Deutlich wird, dass sich der Wunsch danach, mit dem eigenen Einkommen ohne Sorge ein gutes Leben führen zu können, nach stärkerer materieller Anerkennung ihrer Leistungen, ihrer harten Arbeit, aber eben auch ihrer Lebensrealitäten, in ausgrenzenden Lösungen ausdrückt. Diese Haltung lässt sich als exklusive Solidarität mit den produktiv Beschäftigten und der nationalen Leistungsgemeinschaft in Abgrenzung zu Arbeitslosen und „kulturell fremden‚ unnützen Migranten und Migrantinnen“ bezeichnen.
Diese Grundproblematik lässt sich zu folgender These zuspitzen: Je geringer die Hoffnung ist, trotz individueller Anstrengungen Anschluss an eine Gesellschaft zu finden, die medial fortwährend als prosperierend dargestellt wird, desto stärker haben die von uns befragten Arbeiter das Gefühl, Verlierer einer Verteilungsungerechtigkeit zu sein. Infolgedessen interpretieren sie die aktuelle Situation als einen Konflikt zwischen innen – den leistungsbereiten, tüchtigen Deutschen – und außen, das heißt vermeintlich leistungsunwilligen, kulturell nicht integrierbaren Ausländern und Ausländerinnen.
Das gute Volk gegen das korrupte System
Dabei grenzen die Befragten das Volk und die von ihnen ersehnte nationale Leistungsgemeinschaft vom System ab. Sie kritisieren Egoismus, Macht- und Profitstreben sowie Vereinzelung und wünschen sich mehr Zusammenhalt und ein besseres Miteinander, das sie in der Nation zu realisieren meinen. Interessengegensätze und Meinungspluralismus kommen in dieser Vorstellung nicht vor. Das ist umso erstaunlicher, als alle als aktive, gewerkschaftlich organisierte Betriebsräte davon überzeugt sind, dass es ein starkes Gegengewicht der Arbeitenden zum Management braucht. Diesen Interessengegensatz auf der betrieblichen Ebene beziehen sie jedoch nicht auf die Gesellschaft: Hier eint die Vorstellung des deutschen „Volks“ die Menschen über alle Interessengegensätze hinweg und verbündet sie im ethnischen Sinne gegen „das System“.
Die Systemkritik ist häufig verschwörungstheoretisch begründet. Auch wenn sie das grundlegend diffuse Gefühl haben, dass „etwas mit dem System nicht stimmt“, fällt doch auf, dass sich die Kritik der Befragten nicht auf die tieferen Ursachen von sozialer Ungleichheit, kapitalistischer Verwertungslogik oder sozialer Vereinzelung bezieht. Sie bestimmen lediglich Personen und Mächte, die allein an der gegenwärtigen Misere schuld sein sollen und Deutschland gezielt kleinhalten würden: die Migration, das vermeintliche Kartell von Parteien und Medien, die Politik, die Linken, die USA oder eben „irgendjemand“.
Die verbreitete Kritik an wachsender sozialer Ungleichheit, das Bewusstsein für Ungerechtigkeiten in der Arbeitswelt, das Gefühl, politisch nicht repräsentiert zu werden und mit den eigenen Belangen in der Öffentlichkeit nicht vorzukommen, die mangelnde materielle und soziale Anerkennung als Arbeiter verbinden sich mit rassistischen Ressentiments und kanalisieren sich in einer völkischen Bewegung Polanyi’schen Typs. Diese richtet sich nicht gegen eine ausbeuterische Klasse, den Kapitalismus oder Ähnliches, sondern gegen das diffuse „System“ und die kulturell vermeintlich Fremden. Die Grenzen zwischen dem „Wir“ und „den Anderen“ verlaufen folglich nicht klassenspezifisch, sondern nach Leistung und „Kultur“.
Es handelt sich um eine Bewegung Polanyi’schen Typs, weil sie sich gegen die (vermeintliche) soziale Konkurrenz mit Migrierenden richtet und darauf abzielt, den eigenen Status, das Anrecht auf soziale Sicherheit und ein „gutes Leben“ auch in der Zukunft zu erhalten, nicht aber darauf, die tatsächlichen gesellschaftlichen und ökonomischen Ursachen der Konkurrenz infrage zu stellen und zu überwinden. Die Befragten empfinden rechtspopulistische, nationalistische Bewegungen wie beispielsweise Pegida als Bewegungen der Mehrheit, die den authentischen Willen des Volks artikulieren und gegen die aus ihrer Sicht verlogene „Systempolitik“ mit dem Ziel der Errichtung einer wahren, direkten Demokratie zu Felde ziehen.
Ausblick: Mehr vergleichende Forschung ist nötig
Rechtspopulistische Formationen greifen reale Anerkennungsdefizite und Themen auf, deren Bearbeitung sich lange Zeit linke Parteien recht erfolgreich verschrieben hatten. Dabei machen sie ausgrenzende, „national-soziale“ Angebote ganz im Sinne von „Deutsche zuerst“ oder „Österreicher zuerst“ und legitimieren und radikalisieren rassistische und nationalistische Haltungen und Verhaltensweisen. Die sozialpopulistische Rhetorik und die Verknüpfung sozialer Themen mit Einwanderung läuft letztendlich immer darauf hinaus, Migration zu beschränken oder zu verhindern und soziale Gruppen gegeneinander auszuspielen, und lenkt so davon ab, ernsthaft soziale Probleme anzupacken.
Zu den Bedingungen des Aufstiegs rechtspopulistischer Formationen und ihrer Attraktivität für Arbeiter und Arbeiterinnen gehören politische Diskurse, politische Kräfteverhältnisse, sozioökonomische Veränderungen, politische Repräsentationsdefizite und Ähnliches, die sich in den verschiedenen Ländern voneinander unterscheiden und vergleichend untersucht werden müssten. Unsere Forschungen haben wir bisher nur in Deutschland und vorrangig in Industriebetrieben durchgeführt. Systematischer zu untersuchen wäre, wie es in anderen Branchen, wie beispielweise dem Dienstleistungsbereich, aussieht.
Eine ausführliche Darstellung der diesem Beitrag zugrundeliegenden Studie findet sich bei Klaus Dörre/Sophie Bose/John Lütten/Jakob Köster (2018). Arbeiterbewegung von rechts? Motive und Grenzen einer imaginären Revolte. In: Berliner Journal für Soziologie, 2/17. Online abrufbar unter https://link.springer.com/article/10.1007/s11609-018-0352-z.
II
Persönliches-Historisches
Wer könnte besser Auskunft über das Leben Karl Polanyis geben als seine Tochter Kari Polanyi-Levitt? Um die Person Karl Polanyi besser zu verstehen, ist es notwendig, ihm nahe Menschen kennenzulernen: seine Frau Ilona Duczyńska, seinen Bruder Michael und natürlich seine Tochter Kari. Polanyi wurde in Wien geboren und wuchs in Budapest auf; ungarische Juden befanden sich dort in einer besonderen Lage. Wie viele andere im 20. Jahrhundert verschlug es auch Polanyi von einem Ort zum anderen: Wien, London und die USA waren weitere Stationen seines Lebens.
„WO IMMER MEIN VATER LEBTE, WAR ER INVOLVIERT“
Was Karl Polanyis „The Great Transformation“ geprägt hat: Ein Gespräch über das Leben des Autors mit seiner Tochter Kari Polanyi-Levitt
MICHAEL BURAWOY
Karl Polanyi gilt als einer der anerkanntesten Denker der Soziologie und darüber hinaus. Sein Buch „The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen“ zählt heute zu den Klassikern der Soziologie und berührt beinahe jedes Teilgebiet der Disziplin. Die Bedeutung seines Werkes reicht dabei weit über die Grenzen der Soziologie hinaus, auch in Bereiche der Ökonomie, Geografie und Anthropologie. In den letzten vier Dekaden, die durch neoliberale Denkweise und Praxis gekennzeichnet waren, gewann Polanyis Sichtweise aufgrund seiner kritischen Position gegenüber der Marktwirtschaft und der Art und Weise, wie diese das Gefüge der Gesellschaft zersetzt, immer mehr Zustimmung. Das Buch untersucht Ursprünge und Konsequenzen von Kommodifizierung und ist zugleich eine Darstellung von Gegenbewegungen zu dieser Kommodifizierung – Bewegungen, die sowohl den Faschismus und den Stalinismus als auch die Sozialdemokratie hervorgerufen haben. Im gegenwärtigen globalen Kontext erweisen sich diese Analysen offensichtlich als relevant.
Im folgenden Interview spricht Karl Polanyis Tochter Kari Polanyi-Levitt über das Leben ihres Vaters und die maßgeblichen Einflüsse, die zu „The Great Transformation“ beigetragen haben. Ebenso weist sie auf die spezielle Beziehung ihres Vaters zu ihrer Mutter Ilona Duczyńska hin, einer Intellektuellen, die zeitlebens politische Aktivistin war. Kari Polanyi-Levitt zeichnet die vier Phasen in Karl Polanyis Leben (1886–1964) nach: die ungarische, die österreichische, die englische und zuletzt die nordamerikanische Phase.
Kari Polanyi-Levitt ist Ökonomin und lebt in Montreal. Sie ist Autorin zahlreicher Bücher, einschließlich „From the Great Transformation to the Great Financialization“ (2013) und des Sammelbands „The Life and Work of Karl Polanyi“ (1990). Das folgende Interview ist eine gekürzte Version einer öffentlichen Diskussion zwischen Kari Polanyi-Levitt und Michael Burawoy.
Michael Burawoy: Beginnen wir am Anfang. Wir sind es gewohnt, Karl Polanyi als Ungarn anzusehen, aber er ist eigentlich in Wien geboren, richtig? KARI POLANYI-LEVITT: Ja, das stimmt. Mein Vater und ich, wir sind beide in Wien geboren, meine Mutter in einer kleinen Stadt nicht weit von Wien. Wien war damals natürlich das Zentrum des intellektuellen Lebens, die große Metropole des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs. Die Familie, also Vater und Mutter von Karl Polanyi, begannen ihr gemeinsames Leben in Wien. Karls Mutter, Cecilia Wohl, wurde von ihrem Vater aus Vilnius, damals in Russland, nach Wien geschickt, um einen Beruf zu erlernen. Aufgrund ihrer Ausbildung sprach sie Russisch und Deutsch. In Wien lernte sie Karls Vater, einen jungen ungarisch-jüdischen Ingenieur namens Mihály Pollacsek kennen. Er sprach Ungarisch und Deutsch, also war die Familie zu Beginn deutschsprachig.
Vor nicht allzu langer Zeit erfuhr ich durch Korrespondenzen, dass mein Vater bis zu seinem Eintritt ins Gymnasium in Budapest kein Ungarisch gelernt hatte. Die ungarische Phase meines Vaters, die natürlich sehr wichtig ist, war also durch russische Einflüsse geprägt – im politischen Sinne durch russische Sozialisten, die sich stark von damaligen Sozialdemokraten unterschieden. Es war ein Sozialismus, der sich stärker in eine ländliche Richtung, in Richtung der bäuerlichen Landbevölkerung orientierte und anarchistische Elemente hatte. Selbstverständlich waren Kommunen ein zentraler Teil der politischen Formation. Ich muss sagen, dass dieser russische Einfluss durch seinen Vater, der sehr anglophil war, ausbalanciert wurde. Wenn es zwei relevante literarische Persönlichkeiten im Leben meines Vaters gab, so waren es Shakespeare – er nahm eine Ausgabe seiner gesammelten englischen Werke mit in den Krieg – und, von all den großen russischen Schriftstellern, Dostojewski.
Und dann war da der Einfluss von emigrierten russischen Revolutionären, unter ihnen ein Mann namens Klatschko.
POLANYI-LEVITT: Ja, Samuel Klatschko war eine außerordentliche Persönlichkeit. Er lebte in Wien und war der inoffizielle Vermittler zwischen russischen und internationalen bzw. europäischen Revolutionären. Er stammte aus einer jüdischen Familie aus Vilnius und verbrachte seine Jugend in einer russischen Kommune in Kansas. Diese Gemeinde war nicht sehr langlebig, sie löste sich bald auf. Man erzählt, dass Klatschko 3000 Rinder nach Chicago brachte und von dort aus die International Ladies Garment Workers Union in New York besuchte. Er war ein Aktivist. Die Kommune in Kansas war nach dem Russen Nikolai Tschaikowski benannt. Als Klatschko nach Wien kam, pflegte er eine enge Freundschaft mit der Pollacsek-Familie und er hielt Ausschau nach russischen Menschen, die marxistische Literatur kaufen wollten oder aus welchen Gründen auch immer nach Wien gekommen waren. Mein Vater erzählte mir, und das habe ich niemals vergessen, dass diese Männer nicht nur bei ihm einen starken Eindruck hinterlassen haben, sondern auch bei seinem Cousin Irvin Szabo, der eine wichtige Rolle in den intellektuellen Kreisen Ungarns spielte; er war eine Art anarchistischer Sozialist. Manche von ihnen hatten keine Schuhe, sondern wickelten stattdessen ihre Füße in Zeitungspapier ein. Mein Vater war enorm beeindruckt von ihrem Heroismus und ihrer Courage. Alles in allem hatte mein Vater einen … ich wollte sagen „romantischen“, aber in jedem Fall einen Riesenrespekt vor diesen Revolutionären. Insbesondere vor Bakunin, der, wie ich vermute, die größte Persönlichkeit von ihnen allen war. Ein Mann, der aus allen Gefängnissen Europas ausgebrochen ist.
Diese Sympathie für Sozialrevolutionäre hielt zeit seines Lebens an, was in Teilen die Ambivalenz erklärt, die er gegenüber Bolschewiken verspürte.
POLANYI-LEVITT: Ja, diese Sympathie hielt zeit seines Lebens an. Sie erklärt seine antagonistische Beziehung zu den russischen Sozialdemokraten, denen jene angehörten, die letztendlich zur Mehrheitsfraktion der Bolschewiki wurden.
Ihr Vater war bereits als Student politisch aktiv, richtig?
POLANYI-LEVITT: Ja, er war Gründungspräsident einer studentischen Bewegung, die unter dem Namen Galileo Circle bekannt war und deren Zeitschrift Szabad Gondolat hieß, was so viel bedeutet wie „Freier Gedanke“. Die Zeitschrift stellte sich gegen die Monarchie, gegen die Aristokratie und gegen das österreichisch-ungarische Kaiserreich. Es war keine sozialistische Bewegung, obwohl viele der an ihr Beteiligten Sozialisten waren. Die Bewegung inkludierte junge Leute aus den Gymnasien ebenso wie aus den Universitäten. Ich habe gelesen, dass bis zu 2000 Alphabetisierungskurse pro Jahr abgehalten wurden. Die zentrale Aufgabe war also Bildung.
Dann kam der Erste Weltkrieg.
POLANYI-LEVITT: Mein Vater war Kavallerieoffizier an der russischen Front. Die Situation war entsetzlich. Es war in gleichem Maße für die österreichisch-ungarischen wie für die russischen Truppen schrecklich. Er infizierte sich mit Typhus, einer furchtbaren Krankheit. Er erzählte mir einmal, er dachte, er würde sterben, als sein Pferd stolperte und ihn unter sich begrub, doch er erwachte in einem Militärkrankenhaus in Budapest.
Am Ende des Krieges kam es zur Ungarischen Revolution.
POLANYI-LEVITT: Die Ungarische Revolution von 1918 beendete den Krieg und resultierte im Herbst desselben Jahres in der Gründung der Ersten Republik mit Graf Károlyi als erstem Ministerpräsidenten. Das ist der Grund, warum sie üblicherweise als Astern- oder Herbstrosenrevolution bezeichnet wird – nach Blumen, die den Herbst kennzeichnen. Darauf folgte dann die kurzlebige Räterepublik, die im August 1919 endete, als sie in einer Gegenrevolution niedergeschlagen wurde und zahlreiche ungarische Intellektuelle, Aktivisten, Kommunisten, Sozialisten und Liberale zur Flucht ins Exil nach Wien zwang. Einschließlich meines Vaters.
Also Ihr Vater verließ Ungarn vor dem Ende der Revolution, richtig?
POLANYI-LEVITT: Ja, er verließ Ungarn vor dem Ende der Revolution.
Wie schätzte er die Ungarische Revolution ein?
POLANYI-LEVITT: Seine Haltung war ambivalent, so wie die vieler anderer auch. Ich denke, ursprünglich begrüßten die meisten die Bildung von Räten im ganzen Land. Aber als die Räte eine vollständige Nationalisierung der Wirtschaft beschlossen, denke ich, war das der Moment, in dem er ahnte, dass das Ganze ein böses Ende nehmen wird. Was in der Realität dann auch geschah.
Die Anführer der Kommunistischen Partei Ungarns flohen also von Budapest nach Wien?
POLANYI-LEVITT: Ja. Die Kommunistische Partei hatte im Exil zwei Anführer, Béla Kun und Georg Lukács. Es bestand eine gewisse Rivalität zwischen den beiden. Es gibt eine lustige Geschichte über meine Mutter, die das Jahr 1919 in Moskau verbrachte, wo sie – aufgrund ihrer sprachlichen Ausbildung und Fähigkeiten – in einem Büro mit Karl Radek arbeitete und das Treffen der Zweiten Kommunistischen Internationalen organisierte. Als sie nach Wien zurückkehrte, bekam sie die Aufgabe, finanzielle Unterstützung an die ungarischen Kommunisten zu überbringen, und zwar in Form eines Diamanten, der in einer Tube Zahnpasta versteckt war. Das Interessante daran war, dass sie diese an Lukács liefern sollte, da er als Sohn eines Bankers wohl als zuverlässiger eingeschätzt wurde als Kun.
Zu diesem Zeitpunkt kannten sich Ihre Mutter und Ihr Vater noch nicht, sie lernten sich erst im darauffolgenden Jahr, 1920, in Wien kennen.
POLANYI-LEVITT: Es war ein schicksalhaftes Treffen – in einer Villa, die von Wiener Unterstützern für ungarische Kommunisten und andere linke Emigranten zur Verfügung gestellt wurde. Sie war der Liebling dieser Gruppe von jungen Männern. Von denen hatte – meiner Mutter zufolge – niemand damit gerechnet, dass sie sich von einem Mann angezogen fühlen könnte, der zehn Jahre älter war als sie, einem Mann, dessen Leben so erschien, als würde es bereits hinter ihm liegen, der deprimiert war und in einer Ecke Notizen kritzelte.
Die beiden waren sehr unterschiedliche Charaktere. Sie war mehr Aktivistin, er mehr Intellektueller, die eine verbrachte ihre Zeit in den Schützengräben, der andere im Studierzimmer.
POLANYI-LEVITT: Ja und nein. Wo auch immer mein Vater lebte, er war stets involviert in die Dinge, die dort vor sich gingen. Er schrieb Artikel für die Öffentlichkeit, für alle, die es interessierte, was er zu sagen hatte. Er veröffentlichte überall, wo er seine Texte publizieren konnte, in Ungarn, in Wien und auch in England. Er beschäftigte sich also wahrlich mit der Gegenwart. Er war ein Intellektueller, ja, aber keiner mit einer Obsession, die er pflegte, mit keiner immer gleichen Idee, die er von Ort zu Ort mit sich trug. Nein, nein. Überhaupt nicht. Meine Mutter begann ihren Aktivismus tatsächlich mit einer profilierten Beteiligung als herausragende junge Frau in der Ungarischen Revolution; in einem gewissen Sinne gab es nichts Vergleichbares in ihrem restlichen Leben. Und es umgab sie eine gewisse Traurigkeit. Wissen Sie, wenn man in sehr jungem Alter das erreicht, was man wirklich anstrebt – was in ihrem Falle hieß, eine offensichtlich wichtige Rolle in der Geschichte und der kommunistischen sozialistischen Bewegung zu spielen – was auch immer man dann für den Rest des Lebens tut, es kann diesem Erfolg nicht das Wasser reichen.
Beide hatten also ihre traurigen Erfahrungen, aber dann, 1923, passierte etwas sehr Besonderes. Sie wurden geboren! Das hat Ihre Eltern richtiggehend verjüngt.
POLANYI-LEVITT: Ja, meinem Vater zufolge half ihm meine Geburt aus der Depression, was, wie alle solche Dinge, eine sehr private Erfahrung war. Nichtsdestoweniger schrieb er sehr viel darüber. Er schrieb darüber, was – seines Erachtens nach – die Verantwortung seiner Generation war, aufgrund all der schrecklichen Dinge, die passiert waren, insbesondere des schrecklichen und sinnlosen Kriegs. Er schrieb viel über den Ersten Weltkrieg, darüber, wie wenig dieser Krieg wirklich veränderte. Es war, meinem Vater zufolge, niemals richtig klar, worum es dabei wirklich ging. Es war nichts als ein schreckliches Massaker. Eine menschliche Katastrophe. Er machte seine Generation dafür verantwortlich. Und dieses Gefühl der Verantwortung, der sozialen Verantwortung für den Zustand der Welt, für den Zustand des Landes – ich frage mich, ob das ein Kennzeichen dieser Generation war und ob dieses Gefühl der Verantwortung heute verschwunden ist. Gibt es immer noch Menschen – Intellektuelle inkludiert –, die ein Verantwortungsgefühl unserer Gesellschaft gegenüber haben, in der Weise wie mein Vater und viele seiner Generation es hatten?
Es war mit Sicherheit und aus unterschiedlichen Gründen eine sehr besondere Generation. Einer der Gründe war das Rote Wien, der sozialistische Wiederaufbau Wiens von 1918 bis 1933 – eine Zeit, die Ihr Vater in Wien verbrachte.
POLANYI-LEVITT: Ja, das Rote Wien war eine herausragende Episode in der Geschichte – ein bemerkenswertes Experiment städtischen Sozialismus. Es war tatsächlich eine Situation, in der Arbeiter und Arbeiterinnen sozial privilegiert waren – hinsichtlich Leistungen und dem wunderbaren sozialen Wohnbau; der Karl-Marx-Hof ist natürlich das herausragendste Beispiel. Aber es war nicht nur das. Die Atmosphäre und das kulturelle Niveau waren außergewöhnlich, gekennzeichnet durch den Umstand, dass jemand wie Karl Polanyi, der keinen Status hatte und an keiner Universität angestellt war, öffentliche Vorträge zu Sozialismus und anderen Thematiken abhielt. Er hatte die Möglichkeit, in einem einschlägigen Wirtschaftsjournal das marktorientierte Denken von Ludwig von Mises herauszufordern. Mises reagierte darauf und mein Vater antwortete. Es gab außerhalb der Universität, in der Gesellschaft ein intellektuelles Leben.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.