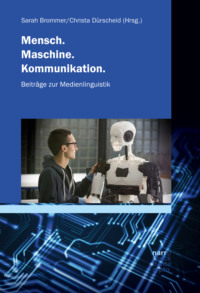Kitabı oku: «Mensch. Maschine. Kommunikation.», sayfa 31
Fußnoten
1 Vorbemerkungen
1
Siehe https://www.planet-wissen.de/technik/computer_und_roboter/kuenstliche_intelligenz/interview-nicole-kraemer-100.html (Stand: 20.06.2021). Diese erste Fussnote sei auch dazu genutzt, um darauf hinzuweisen, dass unser Beitrag in Schweizer Orthographie steht (siehe dazu auch Fussnote 25) und dass wir im Folgenden wahlweise den Genderstern, die Beidnennung oder die maskuline resp. feminine Bezeichnung verwenden. Ausserdem möchten wir an dieser Stelle Gerard Adarve für das sorgfältige Korrekturlesen unseres Beitrags danken.
2
Das sei hier eigens betont, da man auch die Auffassung vertreten könnte, dass alle Kommunikation medial vermittelt sei. Dahinter steht ein anderer, wesentlich weiterer Medienbegriff, der die gesprochene und geschriebene Sprache einschliesst und auch die Face-to-Face-Kommunikation als medial ansieht. So liest man bei Luginbühl/Schneider (2020: 67): «But the crucial point here is the following: even (unfilmed, ‹natural›) face-to-face communication is medial and ‹technical› in a broader sense.» Es ist vermutlich dieser weite Medienbegriff, auf den der erste im Journal für Medienlinguistik genannte Punkt Bezug nimmt. Folgt man dieser Auffassung, dann umfasst die Medienlinguistik viel mehr als das, was herkömmlich in dieser Disziplin untersucht wird. Zugespitzt gesagt: Dann ist alle Linguistik Medienlinguistik.
3
Vgl. https://www.express.de/koeln/-ich-bin-pepper--roboter-erinnert-in-koelner-einkaufszentrum-an-laestiges-thema-37623386?cb=1607879196663 (Stand: 19.06.2021). Wie aus diesem Beispiel ersichtlich, entstand das vorliegende Buch während der COVID-19-Pandemie. Wir hoffen, dass das Beispiel zum Zeitpunkt der Lektüre nicht mehr aktuell sein wird.
2 Maschinen – Automaten – Roboter
1
Vgl. https://www.zeit.de/digital/internet/2014–07/mensch-maschine-kommunikation-gesten-roboter/komplettansicht (Stand: 19.06.2021).
2
Vgl. hierzu auch den Artikel zu Automat von Oliver Bendel im Gabler Wirtschaftslexikon (https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/automat-119939 (Stand: 19.06.2021)).
3
An dieser Stelle sei angemerkt, dass unter Roboter noch etwas gänzlich anderes verstanden werden kann. Auch das zeigt ein Blick in das Gabler Wirtschaftslexikon. Hier wird Roboter definiert als «Crawler, Spider; selbstständig das World Wide Web durchsuchendes Programm, das HTML-Seiten nach Suchkriterien klassifiziert […]» (https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/roboter-44932 (Stand: 19.06.2021)). Das Verständnis von Roboter, das wir hier in Anlehnung an die VDI-Richtlinie sowie an Christaller et al. (2001) zugrundelegen, wird in diesem Lexikon unter anderen Stichworten (wie z.B. Pflegeroboter, soziale Roboter, Kollaborationsroboter, Operationsroboter, Therapieroboter, Kampfroboter) aufgegriffen; und es findet Eingang in den Artikel zu Automat (im Zuge der Abgrenzung von Roboter und Automat, vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/automat-119939 (Stand: 19.06.2021)).
4
«Synchronisierung zwischen Robotik und Maschinensteuerung» bedeutet, dass nur ein technisches System benötigt wird. Damit entfallen alle Schnittstellen zwischen Roboter und Maschine, alle Achsen und Sensoren kommunizieren in einem gemeinsamen Netzwerk. Vgl. dazu https://www.technik-und-wissen.ch/detail/ABB-und-BuR-roboter-und-maschine-werden-eins.html (Stand: 19.06.2021).
5
Vgl. https://ifr.org/downloads/press2018/Presentation_WR_2020.pdf (Stand: 19.06.2021).
6
Vgl. https://ifr.org/downloads/press2018/2019-09-18_Pressemeldung_IFR_World_Robotics_2019_Service_Robots_deutsch.pdf (Stand: 19.06.2021).
7
Die Darstellung greift die Gliederung des IFR-Welt-Roboter-Reports auf (vgl. https://ifr.org/img/worldrobotics/Contents_WR_2020_Service_Robots.pdf (Stand: 19.06.2021)), modifiziert diese jedoch und ergänzt sie. So bleiben im Report Sexroboter unerwähnt (vgl. dazu aber ausführlich Bendel 2020), obschon diese zweifelsfrei zu den Servicerobotern zählen.
8
Roboter werden als soziale Roboter bezeichnet, wenn sie für den Umgang mit Menschen oder Tieren programmiert wurden (zur genaueren Erläuterung vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/soziale-roboter-122268 (Stand: 19.06.2021)).
9
Beim Einsatz von Robotern in der Pflege wird auch deutlich, dass Roboter die persönliche zwischenmenschliche Kommunikation nicht nur ergänzen, sondern sie in bestimmten Situationen auch ersetzen (s.a. die Beiträge von Knoepfli und Staubli i.d.B.). Hier zeigt sich also ein gewisses Mass an Gemeinsamkeit zwischen der Mensch-Mensch- und der Mensch-Maschine-Kommunikation – zumindest bezogen auf den kommunikativen Anlass.
10
Zu Fragen maschineller Moral vgl. ausführlich Bendel (Hrsg.) 2019.
3 Maschinen – Menschen – Vertrauen
1
Vgl. hierzu bspw. die Beiträge in dem 2018 von Bernd Blöbaum herausgegebenen Sammelband «Trust and Communication in a Digitized World. Models and Concepts of Trust Research».
2
Vorbei ist die Zeit, wo dies noch offensichtlich war. Man denke nur an Eliza, ein von dem Informatiker Joseph Weizenbaum in den 1960er Jahren entwickeltes Computerprogramm, das imstande war, auf einfache Fragen (schriftlich) zu antworten.
3
Im oben erwähnten Interview mit Nicole C. Krämer liest man dazu (Stand Oktober 2020): «Es gibt bisher nur ganz wenige Systeme, die schon eine sinnhafte Unterhaltung führen können. Alexa und Google können noch nicht so viel. Da hören Sie noch häufig die Antwort: ‹Ich habe Dich nicht verstanden.› Viel ist auch heute noch vorprogrammiert und abhängig vom Programmierer, der sich auf vermutete Fragen witzige oder passende Antworten einfallen lässt.»
4
Vgl. dazu die Medienberichte, die zu dem Voicebot von Google (dem Google Assistant) publiziert wurden, so z.B. https://www.tageskarte.io/technologie/detail/google-assistant-reserviert-per-telefon-im-restaurant.html, (Stand: 19.06.2021). Das Projekt wurde auch unter dem Namen Google Duplex bekannt.
5
Dem Bot Traffic Report 2016 zufolge wurden bereits 2016 mehr als 50 % des Verkehrs im Internet durch Bots verursacht (vgl. Zeifman 2016). Engel (2019: 10) weist darauf hin, dass dies zu 56 % durch sog. «bad bots» geschieht, «von denen wiederum ein Teil als verdeckt agierende ‹social bots› versuchen, Einfluss auf die (netzwerk-)öffentliche Meinungsbildung zu nehmen». Nicht von ungefähr setzen viele Unternehmen denn auch Captchas (automatische Tests zur Unterscheidung von Computern und Menschen) als ‹Schutzwall› ein, um zu verhindern, dass ein Bot Zugang zur Website bekommt.
6
Vgl. dazu auch den lesenswerten Beitrag von Thimm et al. (2019): Die Maschine als Partner? Verbale und non-verbale Kommunikation mit einem humanoiden Roboter.
7
So wirkt ein Roboter mit Kopf- und Rumpfbereich sympathischer als ein industrieller Schwenkarm. Wird allerdings ein Level sehr hoher Menschenähnlichkeit erreicht, sinkt die Akzeptanz abrupt.
8
Vgl. dazu den Roman von Ian McEwan mit dem treffenden Titel «Machines like me». Der Roman handelt von Adam, einen sympathischen, gut aussehenden, androiden Roboter, der in der Paarbeziehung der beiden Protagonist*innen Charlie und Miranda eine immer bedeutendere Rolle spielt.
9
Wie aus den Zitaten ersichtlich, wird das Adjektiv künstlich wahlweise klein- oder grossgeschrieben. Wir selbst verwenden das Adjektiv hier in Grossschreibung, da wir den Ausdruck Künstliche Intelligenz als einen Terminus mit fachsprachlichem Charakter ansehen.
10
Vgl. dazu das Buch Atlas of Anomalous AI (Vickers/Dowell 2020), in dem die Geschichte und die Zukunft von Künstlicher Intelligenz aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird (technologisch, literarisch, philosophisch, künstlerisch, ethisch). Im Klappentext zum Buch heisst es: «Key texts on modelling, prediction and automation are brought together with stories of science fiction, dreams and human knowledge, set among visionary and surreal images.»
11
Eine Folge dieser Entwicklung sind tiefgreifende Veränderungen in der Arbeitswelt. Doch auch wenn bspw. der Einsatz Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz Erleichterungen bringt, sieht die Hälfte der volljährigen Arbeitnehmer*innen in Deutschland darin einen Grund zur Sorge (vgl. eine im Mai 2018 veröffentlichte Studie des IMWF, Institut für Management und Wirtschaftsforschung, zur Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz. Abrufbar unter: https://www.imwf.de/pressemitteilung/studie-kuenstliche-intelligenz-am-arbeitsplatz-verunsichert-die-haelfte-der-berufstaetigen/, (Stand: 25.01.2021)).
4 Übersicht über die folgenden Beiträge
1
Auf den Entstehungskontext sei auch deshalb hingewiesen, weil dies die Erklärung dafür ist, warum die meisten Beiträge in Schweizer Orthographie verfasst wurden. Selbstverständlich wurde diese Schreibung in der Endredaktion so belassen.
1 Einleitung
1
Es mag hier überraschen, dass die Kommunikation über E-Mail mit Messaging-Diensten verglichen wird. Weiter unten wird ausgeführt, warum dieser Vergleich angebracht ist und es sogar sinnvoll sein kann, E-Mails unter die Kategorie «Messaging-Dienst» zu subsumieren.
2
https://www.uni-due.de/germanistik/chatkorpus/ (Stand: 25.09.2020)
3
https://sms.linguistik.uzh.ch/ (Stand: 25.09.2020)
4
https://www.whatsup-switzerland.ch/index.php/en/corpus-en (Stand: 25.09.2020)
2.1.1 WhatsApp
1
Bei Push-Nachrichten handelt es sich um Nachrichten, die auf dem Sperrbildschirm von Geräten erscheinen, unmittelbar nachdem der oder die Produzent*in des Beitrages ihn abgesendet hat. In den Medien werden Push-Nachrichten im Hinblick auf «ständige Erreichbarkeit» und die Problematik des «nie abschalten können» teilweise negativ bewertet (vgl. z.B. https://www.srf.ch/play/radio/ratgeber/audio/push-nachrichten-einfach-abschalten?id=955e817a-eb63-4400-b80c-5c44e384ee86, Stand: 30.09.2020).
2
«Rezipiert» kann hier bedeuten: gelesen, abgehört oder gesehen (im Falle von Videodateien wird allerdings nicht ersichtlich, ob die rezipierende Person das Video tatsächlich angeschaut hat).
3
Es ist auch möglich, bereits gesendete Nachrichten zu löschen, allerdings muss dies nach maximal einer Stunde nach dem Absenden des Beitrages geschehen, danach steht diese Funktion nicht mehr zur Verfügung. Hinzu kommt, dass die Funktion hinfällig wird, wenn die Nachricht bereits rezipiert wurde.
2.1.3 E-Mail
1
Es ist möglich, eine Lesebestätigung einzufordern. Dies könnte aber als aufdringlich interpretiert werden.
2.2 Semiotische Ressourcen: Multimedialität und Multimodalität
1
Vermutlich meint Androutsopoulos hier ‹Schrift›.
2
Emoticons sind veränderbare graphostilistische Symbole, die aus einer Kombination aus ASCII-Zeichen bestehen (z.B. :-)). Es gibt weitaus mehr Emojis als Emoticons, weil Letztere grundsätzlich «nur» Gefühlslagen ausdrücken. Emojis können dagegen auch für Objekte und Tätigkeiten stehen (vgl. Dürscheid/Siever 2017: 259).
2.2.1 WhatsApp
1
Das Akronym «GIF» steht für «Graphics Interchange Format». Es handelt sich dabei um kurze, tonlose, aus Einzelbildern bestehende Videos in der Endlosschleife.
2
Wer nicht iOS verwendet, kann Memojis nur empfangen, nicht aber kreieren und damit auch nicht versenden.
3
Sticker sind unbewegte Bildzeichen, zu denen auch die Memojis gezählt werden können. Im Gegensatz zu Emojis stehen sie für sich alleine, können also nicht in einen grafisch realisierten Text integriert werden. Dementsprechend werden Sticker auch grösser abgebildet als Emojis.
4
Hier wird sich in Zukunft vielleicht eine neue forschungsethische Frage stellen. Wenn sich die Grafik weiterentwickelt, verweisen persönliche Avatare immer deutlicher auf eine identifizierbare Person. Sind Memojis demzufolge Bestandteil von öffentlich zugänglichen Korpora, ergeben sich ethische Fragestellungen hinsichtlich des Datenschutzes.
2.2.2 iMessage
1
Es hat sich bei der Recherche nicht eindeutig erwiesen, wofür der Ausdruck steht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um ein Kofferwort, bestehend aus «Animation» und «Emoji». Es wäre aber auch möglich, dass es sich aus «Animal» und «Emoji» zusammensetzt, da vor der Einführung des Memojis nur animierte Tierbilder möglich waren.
2.3 Zwischenfazit
1
Die oder der iMessage-Nutzer*in muss zuerst die Erlaubnis dafür geben, dass eine Lesebestätigung angezeigt wird. Bei WhatsApp ist es umgekehrt: Hier ist die Default-Einstellung, dass für andere ersichtlich ist, ob man eine Nachricht gelesen hat. Die Lesebestätigung lässt sich aber auch für WhatsApp ausschalten.
2
Wenn ein*e Sender*in eine Lesebestätigung wünscht, kann sie oder er diese anfordern – was aber keine Default-Einstellung ist.
3
Sprachnachrichten, die spontan aufgenommen werden, sind hier jedoch ausgenommen.
3.1 Synchronie
1
Die Beispiele befinden sich im Anhang.
4 Diskussion der Ergebnisse
1
Nicht Bestandteil dieses Beitrages, aber ein interessanter Aspekt, der im weiteren Sinne den semiotischen Ressourcen zugerechnet werden kann, betrifft das Profilbild. Während man bei WhatsApp ein Profilbild einstellen kann, welches den anderen User*innen angezeigt wird, ist dies bei iMessage und E-Mails meistens nicht der Fall. Dies verleiht WhatsApp eine zusätzlich informelle Komponente, da die Profilbilder oft Aufnahmen aus einem Freizeitkontext sind. Daraus könnte resultieren, dass WhatsApp bewusst vermieden wird, wenn die Kommunikation auf einer formellen Ebene stattfindet.
2
Bestätigt wird dies auch von Titeln sprachwissenschaftlicher Beiträge (vgl. z.B. «Zu kommunikativen Funktionen von Emojis in der WhatsApp-Kommunikation» von Pappert (2017) oder «WhatsApp: Kommunikation 2.0. Eine qualitative Betrachtung der multimedialen Möglichkeiten» von Arens (2014)).
3
Siehe zur Rezeption dieses Modells beispielsweise Albert (2013), Dürscheid (2003, 2016), Thaler (2007). Kurz zusammengefasst besteht es aus zwei Dimensionen. Die mediale Dimension bezieht sich auf die Form der Realisation (phonisch oder graphisch), die konzeptionelle auf den sprachlichen Duktus, der den Autoren zufolge in ein Kontinuum eingeordnet wird («mündlich»/«nähesprachlich» am einen Ende des Kontinuums, «schriftlich»/«distanzsprachlich» am anderen Ende).
1 Einleitung
1
Werner Holly (2011) gibt in seinem Aufsatz Medien, Kommunikationsformen, Textsortenfamilien einen guten Überblick über die Entwicklung dieser Terminologie.
3.1 Visuelle Ebene – Vergleich zwischen Animojis, Emojis und Memojis
1
Abhängig davon, ob das Memoji als Sticker oder in animierter Form gebraucht wird.
2
siehe Fussnote 2
3
Ähnlich lässt sich dies auch bei den gesichtsverändernden Filtern auf Snapchat beobachten, die vor allem dazu dienen, Fotos oder Videos humoristisch zu modifizieren.
3.2 Auditive Ebene – Vergleich zwischen Sprachnachrichten und Animojis
1
Auch wenn vielen WhatsApp-Nutzer*innen diese Funktion nicht bekannt ist: Es ist möglich, Sprachnachrichten auf WhatsApp vor ihrem Versenden noch einmal anzuhören. Um das zu tun, muss man den Chat während einer Sprachnachrichtaufnahme verlassen. Wählt man anschliessend den Chat wieder an, findet man dort (ähnlich wie eine Memodatei) die aufgenommene Sprachnachricht vor. Diese kann dann abgehört oder wieder gelöscht werden.
1 Vorbemerkungen
1
Dieser Effekt bezeichnet ein bestimmtes Verhältnis zwischen Mensch und Maschine: Bis zu einem gewissen Grad wirken Roboter, Animationen oder Ähnliches vertrauenswürdiger auf Menschen, je menschenähnlicher sie gestaltet sind. Ab einem gewissen Punkt jedoch wird es schwierig, festzustellen, warum das Gegenüber menschlich wirkt und warum wiederum nicht. Der Grad der Anthropomorphität ist zu hoch, obwohl nicht perfekt. Das Vertrauen schlägt in Misstrauen um, positive Gefühle kehren ins Negative. Diese Unsicherheit löst ein unheimliches Gefühl aus, man befindet sich im ‹uncanny valley› (siehe Cheetham 2014: 13).
2
Selbstverständlich könnten auch diese untersucht werden, um die Lebensechtheit der Influencerin zu beschreiben. Davon wird im Rahmen dieses explorativen Beitrags abgesehen. Nicht zuletzt bedürfte es auch einer quantitativen Vergleichsstudie von menschlichen und künstlicher Influencer*innen, um wiederholende Muster aufzudecken.
2.3 Lil Miquela
1
Der Name Cain (dt.: Kain) muss als Anspielung auf das Buch Genesis des Alten Testaments gelesen werden. Kain erschlägt darin seinen Bruder Abel und gilt somit als alleiniger Nachfolger von Adam und Eva.
3.2 Lil Miquela und Ashley O.
1
Der Ausdruck wird auch in den sozialen Netzwerken rege als Hashtag genutzt. Im September 2020 sind auf Instagram unter diesem Hashtag 45,8 Millionen Einträge zu finden (siehe Instagram 2020d).
1 Einleitung
1
In dieser Arbeit wird überwiegend das generische Maskulinum verwendet, gemeint sind aber alle Geschlechtsidentitäten.
2.2 Wer sind die Nutzer solcher Plattformen?
1
Siehe den Skandal um die Fremdgeh-Seite ‹Ashley Madison› im Jahr 2015.
2.3 Ablauf beim Online-Dating auf Singlebörsen
1
Einige Webseiten enthalten die Funktion, kleine Botschaften zu versenden, wie ein zwinkerndes Smiley oder ein Herz. Damit kann Interesse an dem Profil bzw. dem User signalisiert werden.
2.4 Interaktion beim Online-Dating auf Singlebörsen
1
Von Relevanz für den (erfolgreichen) Erstkontakt sind natürlich auch die dabei verwendeten Fotos. Dennoch ist die Schrift bzw. der schriftliche Austausch massgeblich für den Erfolg, da die Bilder häufig zuerst ‹freigegeben› werden müssen. Auf Parship besteht die Funktion des ‹Lächeln-Schickens›, was als kleine, para- oder nonverbale Botschaft gewertet werden kann. Dennoch sind die Mittel der nonverbalen Kommunikation stark limitiert (vgl. Dürscheid 2017: 53).
2
Weitere Beispiele wären hdl (Hab dich lieb), lg (Liebe Grüsse), bb (Bis bald) u.Ä.
3
Der ‹Halo-Effekt› ist ein Terminus aus der Sozialpsychologie und beschreibt das Phänomen, dass aus bekannten Eigenschaften einer Person (beispielsweise deren gutes Aussehen) auf unbekannte Eigenschaften (wie deren Intelligenz) geschlossen wird. Dabei handelt es sich um eine kognitive Verzerrung, die stark mit der eigenen Bewertung/Sympathie der anderen Person gegenüber korreliert (vgl. Bak 2010: 1f.).