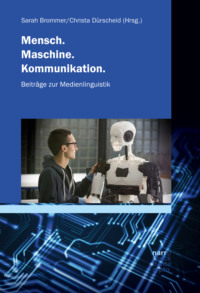Kitabı oku: «Mensch. Maschine. Kommunikation.», sayfa 32
3.1 Übersicht
1
Mingle = Mischung aus den Worten ‹mix› und ‹Single› – siehe auch ‹I’m single and ready to mingle!›.
2
Natürlich gibt es mittlerweile die früheren Singlebörsen wie Parship auch in App-Form; das Design entspricht aber weiterhin dem Modell der Webseite.
3.4 Interaktion beim Online-Dating auf Apps
1
Siehe dazu Birnholtz et al. 2014; Pidun 2016; Fiore et al. 2008; Tyson et al. 2016; Ranzini et al. 2016.
2
Tyson et al. belegten, dass die durchschnittliche Länge einer von einem Mann versandten Erstnachricht 12 Zeichen betrug, 25 % der Nachrichten betrugen sogar unter 6 Zeichen. So besteht eine ‹typische› Erstnachricht, die Männer an zahlreiche Frauen verschicken, einfach nur aus einem ‹Hey›, was wiederum dazu führt, dass viele Frauen gar nicht erst antworten, was wiederum den Prozess in Gang setzt, dass Männer mehr Frauen anschreiben, um Antworten zu erhalten, aber aufgrund der hohen Anzahl den Aufwand möglichst gering halten wollen, was sich wiederum auf die Qualität der Nachrichten auswirkt (vgl. Tyson et al. 2016: 464).
3
‹Dick-pick› steht für das Bild eines Penis, welches meist ungefragt verschickt wird.
3.5 Eigenes Korpus
1
Sensu in persona.
2
Für die Interpretation der Kategorisierung ist anzumerken, dass die Nachrichten, die der Kategorie ‹Frage nach einem Treffen› zugeordnet sind, nicht auch der (inhaltlich übergeordneten) Kategorie ‹Sonstige Frage› zugeordnet sind (dies würde die Aussagekraft aufgrund der doppelten Zählung verzerren).
3
Im März/April 2020 wurden die Menschen in der Schweiz vom BAG aufgrund des Covid-19-Virus dazu angehalten, zu Hause zu bleiben und sich aus Sicherheitsgründen nicht mit anderen Personen zu treffen. Somit ist es eher erstaunlich, dass dennoch fast 3 % der User in der ersten Nachricht direkt um ein Treffen baten.
4
GIF = Graphic Interchange Format (kurze Videos oder Animationen, bspw. eine brennende Flamme).
5
<Anthropomorphismus> beschreibt die Übertragung menschlicher Eigenschaften auf nichtmenschliche Entitäten. Dieser Effekt ist beispielsweise zu beobachten, wenn jemand mit seinem Staubsauger schimpft. In der Metastudie von Sharkey et al. 2017 konnte dieser Effekt bei der erotischen Reaktion von Menschen auf Roboter beobachtet werden: So zeigte eine Untersuchung von Li et al. 2016, dass Teilnehmer der Studie erregt wurden, wenn sie Roboter an ‹intimen Körperstellen› berührten, da sie diese ‹anthropomorphisierten›. Aus einer anderen Studie von Szczuka/Krämer 2017 ging hervor, dass Männer Fotos von Roboterfrauen in Unterwäsche gleich attraktiv bewerteten wie Fotos von echten Frauen in Unterwäsche (vgl. Sharkey et al. 2017: 7f.).
4.2 Wer werden die Nutzer sein?
1
Nicht nur als Hilfskräfte für die Pflegenden werden Roboter in Krankenhäusern eingesetzt, sie können sogar als ‹soziale Betreuer› in Altersheimen fungieren. So ist die Kuschelrobbe PARO bei älteren Patienten sehr beliebt und Ärzte sprechen von deutlichen Erfolgen, welche dank PARO bei Demenzpatienten erzielt werden können, wie etwa ein nachweislich gesunkenes Stresslevel, ein gesteigertes Mass an sozialen Interaktionen und die Rückkehr von Erinnerungen (vgl. Leite et al. 2013: 293; Broekens et al. 2009: 98).
4.3 Chronologische Übersicht und Ausblick
1
Dies ist ein von Masahiro Mori eingeführter Begriff, der das Phänomen beschreibt, das eintritt, wenn wir einem anthropomorphen Roboter gegenüberstehen, der uns gleichermassen vertraut wie fremd ist. Mori erklärt das ‹uncanny valley› so, dass wir uns wohlfühlen, wenn uns Roboter entweder gar nicht ähneln oder aber so sehr, dass wir sie bereits wieder für Menschen halten könnten; alles dazwischen befindet sich im ‹valley› (vgl. Wagner 2013: 266).
2
Für weiterführende Informationen siehe auch Kino Courseys Aufsatz Speaking with Harmony.
4.4 Digital Dating: Virtual Girlfriend Azuma Hikari
1
An dieser Stelle sei als weiterführende Literatur auf die Arbeit von Eleonora Pietronudo "Japanese women’s language" and artificial intelligence: Azuma Hikari, gender stereotypes and gender norms verwiesen, in welcher Pietronudo sich eingehend mit der sprachlichen Interaktion von Azuma Hikari und ihrem User beschäftigt.
1 Vorbemerkungen
1
Daher werden Roboter anthropomorph mit Körperpartien wie Kopf und Rumpf (inklusive Armen und Beinen) sowie Gesichtsmerkmalen wie Augen, Nase und Mund gestaltet. Auch die Kommunikationsfähigkeit der anthropomorphen bzw. humanoiden Roboter ist menschenähnlich und umfasst den verbalen symbolisch gestischen Ausdruck (Sprache) sowie die Verwendung nonverbaler Gesten.
2 Was sind Erwartungshaltungen?
1
Vgl. das Konzept der „doppelten Kontingenz“ bei Luhmann (1984: 148–190).
2
Sowohl signifikante Andere (vgl. Mead 1998) als auch die institutionell geprägte Sozialisation liefern gesellschaftlich geteilte Sinnstrukturen und machen den Verlauf von Anschlussinteraktionen über erwartbare Verhaltensordnungen als erwartete Erwartungserwartung vorhersehbar.
3
Bei Personenbezeichnungen sind immer alle Geschlechter (m/w/d) einbezogen.
3.1 Zum Untersuchungsrahmen
1
Das Akronym steht für Hiroshi-Ishiguro Laboratories (HIL), die eine eigenständige Forschungseinheit in den „Intelligent Robotics and Communication Laboratories“ am ATR (Advanced Telecommunications Research Institute International) in Kyoto/Japan darstellen.
2
Zur Generierung einer eigenständigen Identität gegenüber dem Roboter während der Teleoperation vgl. Straub (2018 und o.J.).
3
Während der Geschäftszeiten des Café Cubus (9 bis 18 Uhr) wurden die Mensch-Roboter-Begegnungen innerhalb von drei Wochen nach Platzierung des Roboters audiovisuell aufgezeichnet. Die Aufzeichnung umfasst den Aufbau, die Platzierung und den Abbau der Versuchsanordnung. Die Aufnahme wurde parallel über fünf mit Mikrofonen ausgestattete Kameras durchgeführt, die die Szenerie in Bild und Ton erfassen.
4
Die Nachbildung eines real existierenden Menschen basiert auf MRI-Aufnahmen und Abbildungen der zu kopierenden Person und erfolgt anhand einer Modellierung ihrer Körper- und Gesichtsmerkmale mit Hilfe einer Silikonmasse und anschließender farblicher Pigmentierung. Zu einer genaueren Beschreibung der technischen Machart und der Funktion von androiden Robotern siehe Nishio et al. (2007).
5
Im Sinne des ethnografischen Paradigmas entschied man sich für diese Umgebung, um Einschränkungen, die in der Laborforschung sichtbar werden, auszugleichen. Dahinter stand die Absicht, die unbefangenen Eindrücke der Cafébesucher zu erfassen, wenn sie den Roboter sehen, und ihren spontanen Umgang mit ihm zu analysieren.
6
Um die Persönlichkeitsrechte der Teilnehmer zu wahren, wurden die Namen der Akteure anonymisiert und mit Kürzeln codiert sowie die Personen in den Abbildungen unkenntlich gemacht.
4.1 Idling- und Facetrack-Modus
1
Da die Ergebnisse der Untersuchung in diesen beiden Modi nur geringe Variationen aufweisen, werden sie in einem Abschnitt behandelt. Der Fokus liegt dabei auf dem Facetrack-Modus.
2
Im Gegensatz zum Idling-Modus sind die Besucher im Facetrack-Modus länger unsicher über den Akteursstatus des Roboters. Die Resterwartungen scheitern schlussendlich aber auch hier.
3
Vgl. Transkript 2308_1439_frau mit kind explore GHI-1, Zeile 28–289 (vgl. Straub 2020: 354).
a) Beispiel 2: Motorische Fertigkeiten
1
Gekürzter Ausschnitt aus Transkript 2908_1320_frau setzt sich zu GHI-1, Zeile 778–794 (vgl. Straub 2020: 374f.).
b) Beispiel 3: Kommunikative Immersionsfähigkeit
1
Gekürzter Ausschnitt aus Transkript 2708_1647_Mann befragt GHI-1, Zeile 847–861 (vgl. Straub 2020: 380).
c) Beispiel 4: Kognitive Kapazitäten
1
Gekürzter Ausschnitt aus Transkript 1908_1227_junge comt und fragt wurzel, Zeile 806–841 (vgl. Straub 2020: 378f.).
1 Robotisierung der Beziehung
1
Alexa ist von Amazon, Siri von Apple.
2
Wenn von Partner oder anderen Personenbezeichnungen gesprochen wird, sind immer beide Geschlechter gemeint.
2 Zur Netflixserie Be right back
1
Im Film wird zwischen Ash als Ash (der verstorbene Mensch) und R-Ash (Online-Kopie und später Roboter) unterschieden.
3.2 Die Kommunikation zwischen Martha und Ash
1
Unter Responsivität versteht man, inwiefern ein Gesprächspartner angemessen auf eine Äusserung reagiert. Dabei wird zwischen Responsivität (Intention und Inhalt werden berücksichtigt), Teilresponsivität (Inhalt wird nur teilweise berücksichtigt) und Nonresponsivität (Inhalt wie auch Intention werden nicht berücksichtigt) unterschieden (vgl. Linke et al. 2004: 317).
2
Die Zeitangaben beziehen sich auf die Episode, welche auf Netflix gestellt ist.
3
Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Zeilennummer im Transkript, welches am Ende dieses Beitrags zu finden ist. Das Transkript wurde selbst verfasst.
3.3 Die Kommunikation zwischen Martha und R-Ash
1
Sofern man bei einem produzierten Filmskript von Zufall sprechen darf.
2
Siehe zur Erklärung der Notation den Anhang.
4 Partnerroboter heute?
1
Siehe für aktuelle Untersuchungen zu Sexrobotern und somit auch Partnerrobotern Bendel (2020). Vgl. auch Zülli i.d.B.
2
Hier ist anzufügen, dass Chatbots heute bereits weit entwickelt sind. Dies wurde kürzlich von Google demonstriert: Der Google-Assistant kann z.B. einen Coiffeur-Termin organisieren (siehe Welch 2018). Das tut er auf einem solch elaborierten Level, dass nicht mehr erkennbar ist, dass es sich um Künstliche Intelligenz handelt.
2 Verständnis von Vertrauen
1
Die explizite Vertrauensäusserung ‹Ich vertraue dir› ist folglich nicht nur als expressive, sondern auch direktive Sprechhandlung zu verstehen: Es wird nicht nur mitgeteilt, dass man der Person vertraut, sondern auch, dass man von dieser Person auch ein bestimmtes Verhalten erwartet.
2
Der Diskurs um Vertrauen in Tiere und andere Lebewesen wird hier ausgelassen, da der Fokus auf Maschinen liegt. Es wird jedoch nicht ausgeschlossen, dass aus der Analyse dieses Diskurses Argumente für oder gegen ‹Vertrauen in Maschinen› gewonnen werden können.
3 Verständnis von Maschinen und Robotern
1
Online unter: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/maschine-40202/version-263592 (Stand: 28.12.2020)
2
Online unter: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/roboter-44932/version-268235 (Stand: 28.12.2020)
3
Online unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/Roboter (Stand: 28.12.2020)
4
Online unter: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/maschinelles-lernen-38193/version-261619 (Stand: 28.12.2020)
4 Vertrauen in Maschinen
1
Ein Beispiel für eine weitere Implikation ist aus ethischer und juristischer Sicht besonders relevant: Die Zuschreibung einer intentionalen Akteurposition impliziert, dass Maschinen für das ‹eigene Verhalten› die Verantwortung tragen. So könnte bei einem maschinell verursachten Schaden die Verantwortung nicht den Hersteller*innen, sondern den Maschinen zugesprochen werden (siehe Weber 2019: 204). Der linguistische Beitrag liegt u.a. im Aufzeigen der Zusammenhänge zwischen den verwendeten Begriffen und ihren Implikationen.
5 Sprachliche Darstellung von Maschinen
1
Siehe dazu auch den Artikel Co-Robots as Care Robots (Bendel/Gasser/Siebenmann 2020). Hier wird der Einsatz von Lio aus praktischer Sicht beschrieben und es werden die Vor- und Nachteile seiner Verwendung im Pflegebereich aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
2
Online unter: https://www.fp-robotics.com/de/care-lio/ (Stand: 28.12.2020)
3
Minor, Liliane: «Es darf nicht passieren, dass Lio jemanden umfährt.» In: Tagesanzeiger, 22.08.2019, online unter: https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/seine-geduld-ist-endlos/story/17626511 (Stand: 28.12.2020). Zu bemerken ist, dass sich die Kamera zur Personen- und Objekterkennung unterhalb der Zange befindet. Die aufgeklebten Augen, die oberhalb der Zange angebracht sind, erfüllen keine funktionelle Aufgabe – sie dienen (wenn nicht einem menschlichen, dann jedoch) dem belebten und fröhlich wirkenden Aussehen.
4
Diese und die weiteren Seitenangaben in diesem Format beziehen sich auf die Seitenzahlen des Werbeprospekts.
5
Zum Vergleich: Wenn das Gerät als Assistenzmaschine bezeichnet werden würde, hinterliesse dies einen anderen Eindruck.
6
«Alles, was agensfähig ist – dazu gehören auch große Tiere und als agensfähig konzipierte Naturgewalten wie Stürme –, bildet die Spitze der sog. Belebtheits- oder Agentivitätshierarchie und wird, da für uns hochrelevant, mit EN [Eigennamen] identifiziert […]» (Nübling et al. 2012: 18).
7
Es wäre zwar denkbar, dass Fachbegriffe und die ausführlichen Darlegungen des hochkomplexen Systems des Roboters die Vertrauenswürdigkeit fördern. Bei Laien könnte dies jedoch eher zur Überforderung führen und die (tendenziell kulturell bedingte) Skepsis gegenüber Robotern verstärken.
6 Fazit
1
Die nicht zu unterschätzende Wirkung von Namen blieb in bisherigen sprachwissenschaftlichen Arbeiten jedoch allzu oft unbeachtet (siehe Nübling et al. 2012: 14).
1 Einleitung
1
Siehe dazu Robot Love in Japan: https://www.youtube.com/watch?v=YzzDLujpat4 (Stand: 09.06.2020).
2 Forschungsliteratur zum geschlechtsspezifischen Sprechen
1
Im Englischen werden Question tags folgendermassen gebildet: Isnt’ he?, Wasn’t she? etc. Pendants im Deutschen sind beispielsweise Nicht wahr?, Oder? etc.
2
Hedges sind im Englischen abschwächende Ausdrücke wie kind of, well etc. Pendants im Deutschen sind beispielsweise vielleicht, möglicherweise etc.
3.2 Künstliche Intelligenz – Was ist das?
1
Ramge (2018: 14) formuliert den Fortschritt im Bereich KI folgendermassen: «[…] aus Daten lernende Software in Verbindung mit steuerungsfähiger Hardware [beherrschen] den Dreischritt von Erkennen, Erkenntnis und Umsetzung in eine Handlung immer besser».
2
Siehe dazu beispielsweise Piaget, Jean (1983): Meine Theorie der geistigen Entwicklung. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag.
4.1 Sprachassistenz und Gender
1
Im Folgenden wird von der ‹weiblichen› und der ‹männlichen› Stimme gesprochen. Dies soll in keiner Weise ausschliessen, dass die Stimmen auch anders wahrgenommen werden oder sich ausserhalb des heteronormativen Spektrums befinden können. Die Kategorisierung in ‹weiblich› und ‹männlich› soll lediglich helfen, die zwei vorhandenen Versionen zu unterscheiden. Diese Kategorisierung wird bis jetzt auch von den gängigen Konzernen, welche Sprachassistenzen verkaufen, verwendet, so u.a. von Apple, Amazon und Google.
5 Fazit
1
Siehe dazu Lakoff 2004 und Mills 2012.
2 Zugänglichkeit zum und im Internet
1
Es darf nicht vergessen werden, dass funktionaler Analphabetismus auch in Ländern wie der Schweiz und Deutschland existiert. Um Texte für betroffene Personen zugänglich zu machen, wurde beispielsweise das Regelwerk für Leichte Sprache (Lebenshilfe Bremen 2013) entwickelt, auf welches wir im Kapitel 3 zur Methodenentwicklung noch kurz eingehen. Auf die Ausnahmen für sehbehinderte und blinde Personen kann hier nicht weiter eingegangen werden.
2
Die Kommunikation in quasi-synchronen Chats sei hier ausgenommen.
4.1 Beispiel 1: «Smartes Heim – Glück allein», Zeit Magazin
1
In der Literaturwissenschaft würde man hier von einem Simile sprechen. Die Tatsache, dass sich literaturwissenschaftliche Konzepte auf den Zeitungsartikel anwenden lassen, ist ein weiteres Indiz für dessen Narrativität.
4.3 Beispiel 3: «Brauchst du smarte Geräte zu Hause?», 20 Minuten
1
Es ist bei den vorgestellten Produkten nicht ersichtlich, ob es sich hier um gesponserte Werbung handelt.
2.1 Bio- and Bodyhacking
1
Some experts consider bodyhacking as an independent field, which has only few similarities with biohacking. Some see the term very narrowly and understand hacking as DIY-system analysis and manipulation.
2
Bodyhacking is also seen as a do-it-yourself movement. But what does do-it-yourself even mean? It can be used to refer to the construction of equipment, but also to the individual adaptation and individual use of the equipment. Therefore, the next chapter, in which examples are given, will not be too narrow-minded. Modern prostheses and intelligent contact lenses are also discussed. The conceptual discussion will be repeated there.
3
In particular, NFC chips are implanted. The application of 2D codes to the skin is also common – at least that’s what the many pictures on the Internet suggest –, and in the future, perhaps the drawing of circuits.
3.1 The Intelligence in and on the Body
1
One can discuss whether this is bodyhacking in the narrower sense. The chips are usually placed by doctors or experts. Hardly anyone experiments with his or her cat or dog at the moment. Animal enhancement is certainly concerned, and the chips seem to benefit both the animal and the person. Basically one has to see that bodyhacking could well extend to animals in the future. The willingness to experiment with your own and other animals could increase, especially if you expect advantages for the animal or yourself.
2
Intelligent contact lenses are hardly produced by a group of laymen. But these can order them in the desired size or design, colour and modify them, and use them in certain ways and combine them with glasses and gadgets.
3
And again the question arises whether this is bodyhacking or not. Of course, one can well imagine that the movement is appropriating these means more and more, especially during crises and disasters or in space.