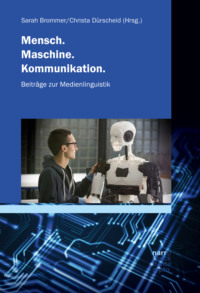Kitabı oku: «Mensch. Maschine. Kommunikation.», sayfa 5
3.1 Synchronie
Aus einem technischenTechnik Blickwinkel sind die Bedingungen für eine quasi-synchrone KommunikationKommunikationquasi-synchrone bei den drei Kommunikationsformen zwar nicht identisch, aber durchaus vergleichbar, vor allem bei iMessageiMessage und WhatsAppWhatsApp. Durch die Push-Nachrichten erlauben es aber alle drei Dienste, Beiträge in Sekundenschnelle zu rezipieren und auf diese zu antworten. Betrachtet man die Beispiele zu WhatsApp, so wird deutlich, dass dies häufig auch der Fall ist. In allen Fällen liegen zwischen zwei Nachricht maximal wenige Minuten. Auffallend ist diesbezüglich vor allem die sogenannte ‹Häppchenkommunikation› (vgl. Pappert 2017: 177) (siehe v.a. Beispiele 1, 3, 5, 61): Inhalte werden auf mehrere Nachrichten aufgeteilt. Die Häppchenkommunikation findet sich weder bei den Beispielen der E-MailE-Mails noch bei den iMessage-Beispielen. Die iMessage-Nachrichten sind prinzipiell etwas länger (Ausnahme: Beispiel 7), die E-Mail-Texte sind deutlich länger (mit Ausnahme von den Beispielen 1 und 4).
Bei den E-MailE-Mail-Beispielen fällt auf, dass es sich in den meisten Fällen (2, 3, 7, 8) gar nicht um Konversationen im klassischen Sinn handelt, da die Kommunikationsrichtung unidirektional verläuft. Es sind Nachrichten, die viele Adressat*innen erreichen, die aber gar keine Antwort erfordern. In den MedienMedium/Medien wird diese Art der E-Mail-Kommunikation meist eher negativ aufgenommen:
680 Milliarden Mails sind letztes Jahr in Deutschland verschickt worden, mehr als je zuvor. Und das Wachstum soll weitergehen. Für 2017 wird ein Plus von 17 Prozent erwartet. Das verkündeten am Montag die beiden Mailanbieter GMX und Web.de. Überraschende Zahlen – denn in der subjektiven Wahrnehmung ist E-MailE-Mail eine stagnierende Kommunikationsform. Sie wurde über die letzten Jahre immer wieder für tot erklärt. (Schüssler 2017 im Tages-Anzeiger)
Der Artikel beschreibt weiter, dass E-MailE-Mails zwar immer häufiger verwendet werden, viele jedoch inhaltlich nicht relevant sind für die Empfänger*innen. Oft handle es sich dabei um digitale Kaufquittungen, Hinweise auf Erwähnungen in den sozialen Netzwerkensoziales Netzwerk, Sicherheitsmeldungen und Werbung (siehe dazu auch die E-Mail-Beispiele 7 und 8). Wenn der oder die Verfasser*in Nachrichten an mehrere, zumindest teilweise nicht persönlich bekannte Rezipient*innen versendet, hat das in der Regel auch Auswirkungen auf den sprachlichen Duktus. Die Sätze sind meist komplex, es gibt Anrede- und Abschiedsformeln, der Duktus ist formeller. Dürscheid/Fricks Hinweis, dass E-Mails aber auch vermehrt informelle Aspekte aufweisen können (vgl. 2016: 35), zeigt sich bei den Beispielen 1, 2 und 4 – wenn auch auf zwei verschiedene Arten. Beispiel 2 macht deutlich, dass Gross- und Kleinschreibung – auch in einem formellen Kontext – nicht immer berücksichtigt wird. Dies könnte daran liegen, dass der Verzicht auf die Berücksichtigung dieser Orthographienorm zu einer höheren Geschwindigkeit bei der Produktion einer Nachricht führen kann. Beispiele 1 und 4 zeigen, dass bei einer höheren Geschwindigkeit der Kommunikation Anrede- und Grussformeln fehlen können. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Kommunikationsraum in diesem Fall als «offenstehend» interpretiert wird, was sich auf den Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone auswirkt.
Bei den iMessageiMessage-Beispielen scheint dies gerade umgekehrt zu sein; dieser Kommunikationsraum wird offenbar eher als «geschlossen» wahrgenommen: Obwohl die Kommunikation – auf die Affordanzen bezogen – hier genauso quasi-synchronKommunikationquasi-synchrone ablaufen kann, wie dies bei WhatsAppWhatsApp der Fall ist, finden sich bei allen acht iMessage-Beispielen formelle Anreden und in den meisten Fällen auch Abschiedsgrussformeln, auch wenn die Anrede oft auf den ersten Turn beschränkt bleibt. Wird eine neue Konversation aufgenommen (Beispiele 1 und 7), wird der Raum durch erneute Anrede neu geöffnet. Das ist auch dahingehend bemerkenswert, als dass iMessage dies gar nicht vorgibt. Rein visuell gibt es – ausser der Anzeige des Datums der Konversation (so auch bei WhatsApp) – kein Zeichen dafür, dass es sich bei einer Konversation zwischen zwei Beteiligten nicht um einen einzigen Raum handelt. Dass dies aber offenbar anders wahrgenommen wird, muss auf der situativen bzw. sozialen Ebene begründet werden: Offenbar entscheiden sich AkteurAkteur*innen für die Kommunikation über iMessage, wenn die Beziehung zwischen den Gesprächsteilnehmenden auf einer professionellen Ebene liegt, welche eine formelle Anrede verlangt. Es schien den Schreibenden hier anscheinend unangemessen, über WhatsApp zu kommunizieren. Der formellere Charakter der Kommunikation zeigt sich auch an den syntaktisch vollständigen Sätzen, der grundsätzlichen Beachtung von Gross- und Kleinschreibung und der nicht-dialektalen Schreibung. Warum diese Unterhaltungen aber nicht über E-MailE-Mails geführt wurden, kann nicht abschliessend begründet werden. Eine naheliegende These wäre, dass E-Mails immer noch die traditionelle Rolle asynchroner KommunikationKommunikationasynchrone zugesprochen wird. iMessage stellt damit eine Zwischenlösung dar: Es wird eher im formellen Setting verwendet, dennoch ist die Geschwindigkeit des Feedbacks in der Regel höher.
Ein letzter Aspekt, der den Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone zu beeinflussen scheint, ist die optische Strukturierung der Beiträge: Je strukturierter und übersichtlicher, desto mehr Zeit benötigt man für die Produktion und desto geringer ist der Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone. Hier lässt sich ein Kontinuum feststellen. Bei E-MailE-Mails erscheint es angebracht, Darstellungsoptionen wie Absätze, Zeilenauslassungen und Auflistungen zu verwenden (Ausnahme: teilweise Beispiele 1 und 4). So wird beispielsweise der Norm Folge geleistet, nach der Anrede eine Zeile auszulassen. Bei iMessageiMessage scheint diese Norm flexibler interpretiert zu werden – nur bei Beispiel 3 und 4 wird nach der Anrede ein Zeilenumbruch eingefügt. Bei WhatsAppWhatsApp sind keine solchen Konventionen ersichtlich, was vor allem dadurch bedingt ist, dass Anrede- und Grussformeln ohnehin fehlen.
Es zeigt sich an dieser Stelle, dass eine Erweiterung des dreistufigen Modells (‹asynchronKommunikationasynchrone – quasi-synchronKommunikationquasi-synchrone – synchronKommunikationsynchrone›) sinnvoll sein kann: Thaler (2007) eröffnet denn auch eine zweite Möglichkeit, den Grad der SynchronizitätKommunikationsynchrone fassbar zu machen. Statt von drei Stufen spricht sie von einem Kontinuum mit den Polen ‹synchronKommunikationsynchrone› und ‹asynchronKommunikationasynchrone› (vgl. Thaler 2007: 174). Das erscheint angebracht, da auf diese Weise die Komplexität der verschiedenen Kommunikationsarten im Internet eher veranschaulicht werden kann, als dies ein Stufenmodell tut. So lässt sich die Tendenz konstatieren, dass über WhatsAppWhatsApp ‹am synchronstenKommunikationsynchrone› und über E-MailE-Mail ‹am asynchronsten› kommuniziertKommunikationasynchrone wird, während iMessageiMessage dazwischen liegt. Ausnahmen (wie die E-Mail-Beispiele 1 und 4) zeigen jedoch, dass auch Mails auf eine sehr synchroneKommunikationsynchrone Weise verwendet werden können.
3.2 Multimediale und multimodaleMultimodalität Kommunikation
Grundsätzlich könnte vermutet werden, dass iMessageiMessage das semiotisch reichhaltigste Kommunikationsmedium darstellt. Die vorliegende Datensammlung belegt aber das Gegenteil: Die Unterhaltungen auf iMessage sind, mit wenigen Ausnahmen, auf die graphische Realisierung des zu vermittelnden Inhalts beschränkt. Nur in den Beispielen 7 und 8 finden sich einige wenige Emojis, bei Beispiel 8 zwei Sticker. Dahingehend scheint iMessage mit den E-MailE-Mails vergleichbar zu sein. Auch hier finden sich, mit Ausnahme von Beispiel 6, keine Emojis. Ganz anders sieht die Situation bei WhatsAppWhatsApp aus. In allen acht Beispielen ist die Schrift nicht die einzige semiotische Ressource. Es zeigt sich, dass die personalisierten Bildzeichen hier deutlich häufiger eingesetzt werden als bei iMessage, obwohl sie in ihrer Funktion eingeschränkter sind, weil sie nur statisch verwendet werden können. Dabei wird deutlich, dass die Memojis kommunikativ ganz ähnlich wie Emojis eingesetzt werden. In den Beispielen 2 und 4 übernehmen sie die Kommentarfunktion und verstärken bzw. relativieren das Geschriebene. Da Memojis im Unterschied zu Emojis jedoch nicht in den graphischen Text integriert werden können, werden sie teilweise auch eher in Situationen verwendet, in denen ihre Bedeutung für sich alleine stehend eindeutig ist. Beispiele dafür sind 3 und 7: Beim dritten Beispiel steht das Zeichen für «Ich weiss es nicht», beim siebten Beispiel wird zuerst ausgedrückt, dass ein vorangehender Beitrag als lustig bewertet wird, ehe Zustimmung vermittelt wird. Bei WhatsApp scheint es demzufolge eher üblich zu sein, multimodalMultimodalität zu kommunizieren. Darauf weist auch die Bemerkung von Arens (2014: 82) hin, die von «WhatsApp-typische[n], multimediale[n] Kommunikationsmöglichkeiten wie Piktogramme, Fotos und Videos, Audios und Hyperlinks» spricht. Die genannten Kommunikationsmöglichkeiten sind, technischTechnik gesehen, nicht distinktiv für WhatsApp. Empirisch gesehen kann Arens hier aber insofern Recht gegeben werden, als die Verwendung von Piktogrammen in den vorliegenden Beispielen tatsächlich fast nur auf WhatsApp beschränkt ist.
Bezüglich der Multimedialität scheint allerdings die E-MailE-Mail am variantenreichsten zu sein. Bei mindestens drei Beispielen (4, 5, 6) wird ein Dokument verschickt, auf das sprachlich auch jeweils Bezug genommen wird. Zudem werden Links in den Text integriert (so in Beispiel 2), bei den Beispielen 7 und 8 besteht ein grosser Teil der Nachricht aus Bildern. An zweiter Stelle ist WhatsAppWhatsApp zu nennen (Beispiel 4), bei iMessageiMessage fehlen multimediale Inhalte in den Fallbeispielen.
4 Diskussion der Ergebnisse
Es hat sich gezeigt, dass die Affordanzen in Bezug auf die beiden untersuchten Aspekte sehr wohl relevant sind. Erst dadurch, dass quasi-synchronKommunikationquasi-synchrone kommuniziert und dass auf semiotisch reichhaltige Ressourcen zurückgegriffen werden kann, erhöht sich erstens die Geschwindigkeit der Kommunikation und verliert zweitens die Schrift ihren Status als alleiniges semiotisches Mittel. Hinsichtlich der SynchronieKommunikationsynchrone lässt sich dies deutlich aufzeigen. Im vorliegenden Korpus laufen WhatsAppWhatsApp-Konversationen ‹am synchronstenKommunikationsynchrone› ab. Dass iMessageiMessage auf dem zweiten, E-MailE-Mail auf dem dritten Platz folgen, ist zunächst einleuchtend. Was aber nicht erklärt werden kann, ist der grosse Abstand zwischen iMessage und WhatsApp, denn WhatsApp ist technischTechnik gesehen nur gering ‹synchronerKommunikationsynchrone› als iMessage. Hier müssen die Gründe für den deutlichen Unterschied auf einer anderen Ebene festgemacht werden.
Wie in Kapitel 3.2 diskutiert, sind die Nachrichten bei iMessageiMessage im Vergleich zu WhatsAppWhatsApp sprachlich deutlich reflektierter, was mit dem Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone zusammenhängen kann. Da der Grund für diese sprachliche Reflektiertheit nicht in den Affordanzen des Dienstes begründet liegt, lässt sich für iMessage folgende Konsequenz ziehen: Hinsichtlich des Grades an SynchronizitätKommunikationsynchrone ist iMessage eher durch situative und soziale als durch technischeTechnik Gegebenheiten determiniert. Eine mögliche Begründung für den formelleren Duktus auf iMessage könnte in der historisch bedingten Wandlung der Bedeutung von SMS zu finden sein: Durch das Aufkommen von WhatsApp wurden SMS überflüssig. Dadurch wandelte sich das Verwendungsspektrum von SMS, sodass sie nun vermehrt für formellere, aber – im Vergleich zu E-MailE-Mails – ‹synchronere› KommunikationKommunikationsynchrone eingesetzt werden. SMS und iMessage hängen insofern zusammen, als iMessage nur zwischen zwei iOS-User*innen verwendbar ist. Schickt ein*e iOS-NutzerNutzer*in*in eine Nachricht an eine*n Androidandroid-Nutzer*in, so wandelt Apple die Nachricht in eine SMS um. Wenn folglich iOS-Nutzende iMessage verwenden, assoziieren sie damit möglicherweise die SMS-Kommunikation.
Beim E-MailE-Mailen scheint es gerade umgekehrt zu sein: Dadurch, dass E-Mails auch mobil bearbeitet werden können und Push-Nachrichten die Geschwindigkeit des Feedbacks in die Höhe treiben, steigert sich auch der Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone. In diesem Fall scheint die Technologie ausschlaggebend dafür gewesen zu sein, dass über dieses klassisch asynchroneKommunikationasynchrone Kommunikationsmittel nun auch quasi-synchronKommunikationquasi-synchrone (oder zumindest: ‹synchronerKommunikationsynchrone›) kommuniziert wird. Wichtig ist aber im Hinblick auf E-Mails, dass deren Entwicklung in drei Richtungen verläuft: Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, werden E-Mails heute vermehrt unidirektional verwendet, wenn etwa eine grosse Gruppe über etwas informiert werden soll. So stehen Nachrichten in Form von sprachlich (grösstenteils) reflektierten, vielleicht sogar redigierten Texten solchen gegenüber, die spontaner und schneller verfasst werden und eher nähesprachlichenähesprachlich Merkmale (z.B. Ellipsen) beinhalten. Zusätzlich ist relevant, dass diese beiden Entwicklungen die «traditionelle» asynchroneKommunikationasynchrone, dialogischDialog ausgerichtete Kommunikation nicht ablösen – sie sind vielmehr als Ergänzung zu sehen. Für E-Mails lässt sich daher schliessen, dass das Spektrum an Sprachhandlungen durch die neuen Affordanzen erweitert wurde, weswegen sich unterschiedliche Kommunikationspraktiken ergeben. Kurz: Die Kommunikation über E-Mail ist so variantenreich, dass deren Determiniertheit durch die Technologie bzw. anderer Faktoren hinsichtlich der drei untersuchten Kommunikationsformen am wenigsten pauschal beschrieben werden kann.
Damit kommen wir zu den semiotischen Ressourcen: TechnischTechnik gesehen ist iMessageiMessage der semiotisch reichhaltigste Dienst, gefolgt von WhatsAppWhatsApp und E-MailE-Mails. Dadurch, dass sich bei den untersuchten iMessage-Beispielen sämtliche Unterhaltungen auf einer professionellen Ebene abspielen, werden kaum andere semiotische Zeichen als graphische verwendet. Hier scheint die iMessage-Kommunikation allein von situativen und sozialen Gegebenheiten bestimmt.E-MailiMessageWhatsApp1 Ein wichtiger Punkt ist dabei jedoch, welche Rückwirkung die Tatsache hat, dass dieser Dienst nicht betriebssystemübergreifend ist. So nutzen alle User*innen bei den abgebildeten Beispielen iOS, weswegen allen die Möglichkeit zur spezifisch multimodalenMultimodalität Kommunikation zur Verfügung steht. Doch es ist möglich, dass sich viele dieser Möglichkeiten gar nicht bewusst sind, weil sie in der Kommunikation via WhatsApp damit gar nicht in Berührung kommen. Das könnte eine Begründung dafür sein, warum sich Animojis, die Kommentierfunktion oder das Senden mit Effekten (noch) nicht etablieren konnten: User*innen lernen nicht, mit diesen zu hantieren, weil sie nicht Bestandteil der alltäglichen internetbasierten Kommunikation sind. Anders formuliert: WhatsApp-NutzerNutzer*in*innen, die das iOS-Betriebssystem verwenden, vermissen diese Möglichkeiten nicht, weil sie sie kaum kennen, und sie sehen demzufolge keinen Grund, für die alltägliche Kommunikation iMessage statt WhatsApp zu verwenden. So sind die Affordanzen hier indirekt doch ein zentraler Einflussfaktor auf das sprachliche Verhalten.
Bei WhatsAppWhatsApp ist das Versenden nicht-graphischer Zeichen und multimedialer Inhalte hingegen Bestandteil der Kommunikationspraxis. Doch ist dies in erster Linie technischTechnik oder situativ bzw. sozial zu begründen? Eine These könnte lauten, dass WhatsApp der erste, intensiv genutzte Messenger war, der das Verwenden der grossen Bandbreite an Emojis erlaubte. Die neuartigen technischenTechnik Möglichkeiten könnten so stark zu einem nähesprachlichennähesprachlich Kommunikationsverhalten motiviert haben, dass sich die semiotisch variantenreiche Kommunikation als «WhatsApp-typisch» etablierteWhatsApp.2 Dass Emojis, Memojis und andere semiotische Zeichen verwendet werden, wird hier quasi erwartet; WhatsApp wird mit der Verwendung dieser Zeichen assoziiert. Allein schon das Verwenden von Diensten, die nicht WhatsApp sind, entbindet folglich von dieser Konvention, wie die iMessageiMessage-Beispiele aufzeigen.
Was die Kommunikation über E-MailE-Mail betrifft, so scheint die Situation im Falle der «klassischen» asynchronenKommunikationasynchrone, dialogischenDialog wie auch im Falle der quasi-synchronenKommunikationquasi-synchrone, dialogischen Verwendung ebenfalls von den historisch bedingten technischenTechnik Gegebenheiten bestimmt zu sein. MultimodaleMultimodalität Inhalte finden sich hier kaum. Auf Emojis und andere Einheiten ausserhalb des graphischen Bereichs wird aber nicht in erster Linie deshalb verzichtet, weil es technischTechnik nicht möglich wäre, solche einzufügen. E-Mails werden vielmehr klassischerweise dem Bereich der Geschäftskorrespondenz zugeordnet (vgl. Dürscheid/Frick 2016: 32f.). Diese Konnotation hat sich bis heute gehalten, auch wenn E-Mails nicht nur im geschäftlichen Bereich Anwendung finden. Mit dieser Konnotation geht – offensichtlich nach wie vor – (die ErwartungErwartungshaltung an) eine sprachlich reflektierte Ausdrucksweise einher. Eine Ausnahme bilden die unidirektional laufenden E-Mails: die Werbe-E-Mails (Beispiele 7 und 8). Eine These wäre, dass dies sehr bewusst geschieht, um sich von «herkömmlichen» E-Mails abzuheben.
Weiterführend wäre es nun interessant, sprachwissenschaftliche Modelle zur Erklärung des verwendeten sprachlichen Duktus in der internetbasierten Kommunikation auf die drei Fallbeispiele anzuwenden. Hier kommt dem Modell von Peter Koch und Wulf OesterreichernähesprachlichKoch/Oesterreicher-Modell3 immer noch eine Monopolstellung zu (vgl. Albert 2013: 61), obwohl seine Anwendung im Kontext der internetbasierten Kommunikation von verschiedenen Seiten kritisiert wurde. Insbesondere die Annahme, es handle sich bei der internetbasierten Kommunikation um «getippte Gespräche» – wie dies beispielsweise Storrer (2001) formuliert –, wird in Frage gestellt. Damit würde die internetbasierte Kommunikation defizitär betrachtet – die Verwendung von Emojis oder anderen Symbolen wäre dann lediglich eine Kompensationsstrategie und nicht mehr eine spezifische semiotische Form (vgl. ausführlich zu dieser Kritik Albert 2013).
Abschliessend bleibt festzuhalten: Wünschenswert ist, dass die Sprachwissenschaft in den kommenden Jahren neue Modelle entwickeln kann, die der Diversität der Kommunikation im Internet gerecht werden. Wichtig hierfür ist auch, dass Korpora mit authentischen Daten generiert und zeitnah zugänglich gemacht werden. Nur so kann die Medienlinguistik die sich stets wandelnde Kommunikationspraxis adäquat reflektieren und aktuelle technologische Entwicklungen einbeziehen.
Bibliographie
Albert, Georg (2013). Innovative Schriftlichkeit in digitalen Texten: Syntaktische Variation und stilistische Differenzierung in Chat und Forum. Berlin: Akademie Verlag.
Androutsopoulos, Jannis (2010). Multimodal – intertextuell – heteroglossisch: Sprach-Gestalten in „Web 2.0“-Umgebungen. In: Deppermann, Arnulf/Linke, Angelika (Hrsg.). Sprache intermedial: Stimme und Schrift, Bild und Ton. Berlin/New York: De Gruyter, 419–445.
Arens, Katja (2014). WhatsApp: Kommunikation 2.0: Eine qualitative Betrachtung der multimedialen Möglichkeiten. In: König, Katharina/Bahlo, Nils Uwe (Hrsg.). SMS, WhatsApp & Co: Gattungsanalytische, kontrastive und variationslinguistische Perspektiven zur Analyse mobiler Kommunikation. Münster: Monsenstein und Vannerdat, 81–106.
Dennis, Alan R./Valacich, Joseph S. (1999). Rethinking Media Richness: Towards a Theory of Media Synchronicity. Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 1–10.
Dürscheid, Christa (2003). Medienkommunikation im Kontinuum von Mündlichkeit und Schriftlichkeit: Theoretische und empirische Probleme. Zeitschrift für Angewandte Linguistik 38:1, 1–20.
Dürscheid, Christa/Frick, Karina (2014). Keyboard-to-Screen-Kommunikation gestern und heute: SMS und WhatsApp im Vergleich. In: Mathias, Alexa/Runkehl, Jens/Siever, Torsten (Hrsg.). Sprachen? Vielfalt! Sprache und Kommunikation in der Gesellschaft und den Medien. Eine Online-Festschrift zum Jubiläum von Peter Schlobinski. Darmstadt: sprache@web, 149–181.
Dürscheid, Christa/Siever, Christina M. (2017). Jenseits des Alphabets – Kommunikation mit Emojis. Zeitschrift für germanistische Linguistik 45:2, 256–285.
Dürscheid, Christa (2016). Nähe, Distanz und neue Medien. In: Feilke, Helmuth/Hennig, Mathilde (Hrsg.). Zur Karriere von ‹Nähe und Distanz›. Rezeption und Diskussion des Koch-Oesterreicher-Modells. Berlin, Boston: De Gruyter, 357–385.
Habscheid, Stephan/Klein, Wolfgang (2012). Einleitung: Dinge und Maschinen in der Kommunikation. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 42:4, 8–12.
Hinz, Leonore (2015). The Functions of Emoticons and Pictograms in Instant Messengers. 10plus1: Living Linguistics 1, 92–103.
Pappert, Steffen (2017). Zu kommunikativen Funktionen von Emojis in der WhatsApp-Kommunikation. In: Beißwenger, Michael (Hrsg.): Empirische Erforschung internetbasierter Kommunikation. Berlin: De Gruyter Mouton, 175–211.
Schüssler, Matthias (2017). Das E-Mail stirbt einen langsamen Tod. In: Tagesanzeiger vom 14.02.17. Abrufbar unter: https://www.tagesanzeiger.ch/digital/internet/das-email-stirbt-einen-langsamen- tod/story/29860033 (Stand: 20.12.2020)
Siever, Christina M. (2015). Multimodale Kommunikation im Social Web: Forschungsansätze und Analysen zu Text-Bild-Relationen. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
SRF (2018). Push-Nachrichten: Einfach abschalten! Abrufbar unter: https://www.srf.ch/play/radio/ratgeber/audio/push-nachrichten-einfach-abschalten?id=955e817a-eb63-4400-b80c-5c44e384ee86 (Stand: 20.12.20)
Statista (2020): Anzahl der monatlich aktiven Nutzer von WhatsApp weltweit in ausgewählten Monaten von April 2013 bis Februar 2020. Abrufbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/285230/umfrage/aktive-nutzer-von-whatsapp-weltweit/ (Stand: 20.12.2020)
Steinseifer, Martin (2011). Die Typologisierung multimodaler Kommunikationsangebote. Am Beispiel der visuellen Aspekte seitenbasierter Dokumente. In: Habscheid, Stephan (Hrsg.). Textsorten, Handlungsmuster, Oberflächen: Linguistische Typologien der Kommunikation. Berlin: De Gruyter, 164–189.
Storrer, Angelika (2001). Getippte Gespräche oder dialogische Texte? Zur kommunikationstheoretischen Einordnung der Chat-Kommunikation. In: Lehr, Andrea/Kammerer, Matthias/Konerding, Klaus-Peter/Storrer, Angelika/Thimm, Caja/Wolski, Werner (Hrsg.). Sprache im Alltag: Beiträge zu neuen Perspektiven in der Linguistik. Berlin, New York: De Gruyter, 439–465.
Storrer, Angelika (2017). Internetbasierte Kommunikation. In: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung u.a. (Hrsg.). Vielfalt und Einheit der deutschen Sprache. Zweiter Bericht zur Lage der deutschen Sprache. Tübingen: Stauffenburg, 245–279.
Thaler, Verena (2007). Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Synchronizität: Eine Analyse alter und neuer Konzepte zur Klassifizierung neuer Kommunikationsformen in: Zeitschrift Für Germanistische Linguistik, 35:1, 146–181.