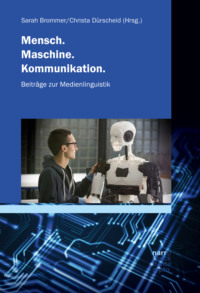Kitabı oku: «Mensch. Maschine. Kommunikation.», sayfa 6
Korpora
Chat (Dortmund): https://www.uni-due.de/germanistik/chatkorpus/ (Stand: 25.09.2020)
SMS (Zürich): https://sms.linguistik.uzh.ch/ (Stand: 25.09.2020)
WhatsApp (Schweiz): https://www.whatsup-switzerland.ch/index.php/en/corpus-en (Stand: 25.09.2020)
Anhang
Fallbeispiele WhatsAppWhatsApp
 Abb. 5:
Abb. 5:
Beispiel WhatsAppWhatsApp 1
 Abb. 6:
Abb. 6:
Beispiel WhatsApp 2
 Abb. 7:
Abb. 7:
Beispiel WhatsAppWhatsApp 3
 Abb. 8:
Abb. 8:
Beispiel WhatsApp 4
 Abb. 9:
Abb. 9:
Beispiel WhatsApp 5
 Abb. 10:
Abb. 10:
Beispiel WhatsAppWhatsApp 6
 Abb. 11:
Abb. 11:
Beispiel WhatsApp 7
 Abb. 12:
Abb. 12:
Beispiel WhatsAppWhatsApp 8
Fallbeispiele iMessageiMessage
 Abb. 13:
Abb. 13:
Beispiel iMessageiMessage 1
 Abb. 14:
Abb. 14:
Beispiel iMessage 2
 Abb. 15:
Abb. 15:
Beispiel iMessage 3
 Abb. 16:
Abb. 16:
Beispiel iMessageiMessage 4
 Abb. 17:
Abb. 17:
Beispiel iMessage 5
 Abb. 18:
Abb. 18:
Beispiel iMessageiMessage 6
 Abb. 19:
Abb. 19:
Beispiel iMessage 7
 Abb. 20:
Abb. 20:
Beispiel iMessageiMessage 8
Fallbeispiele E-MailE-Mail
 Abb. 21:
Abb. 21:
Beispiel E-MailE-Mail 1
 Abb. 22:
Abb. 22:
Beispiel E-Mail 2
 Abb. 23:
Abb. 23:
Beispiel E-MailE-Mail 3
 Abb. 24:
Abb. 24:
Beispiel E-Mail 4
 Abb. 25:
Abb. 25:
Beispiel E-MailE-Mail 5
 Abb. 26:
Abb. 26:
Beispiel E-Mail 6
 Abb. 27:
Abb. 27:
Beispiel E-MailE-Mail 7
 Abb. 28:
Abb. 28:
Beispiel E-Mail 8
Animojis
Eine Analyse aus linguistischer Perspektive
Roberto Tanchis & Leonie Walder
1 Einleitung
In unserer vom Internet geprägten Zeit kommunizieren wir nicht nur mittels unterschiedlicher Kommunikationsmedien, wie zum Beispiel SmartphoneSmartphone, Telefon, ComputerComputer etc., sondern auch über eine Vielzahl von unterschiedlichen Kommunikationsformen, wie zum Beispiel WhatsAppWhatsApp, Snapchat, InstagramInstagram oder E-MailE-Mail.1 Wir sind es gewohnt, verschiedene Kommunikations-Apps parallel zu nutzen und je nach Zweck von AppApp zu App zu wechseln: E-Mail für Geschäftliches, WhatsApp für Freunde und Familie, Snapchat und InstagramInstagram für das Teilen von fotografischen Momentaufnahmen. Dabei wechseln wir häufig nicht nur die Kommunikationsformen und -kanäle, sondern auch zwischen verschiedenen Sprachregistern. Die Art und Weise, wie wir Kommunikationsmittel nutzen, variiert von MediumMedium/Medien zu MediumMedium/Medien und nicht selten auch von Adressat zu Adressat. Je nach Sinn und Zweck einer Nachricht orientieren wir uns mehr oder weniger an konzeptionell Mündlichem, und nicht jeder Empfängerin oder jedem Empfänger schicken wir, wenn überhaupt, die gleiche Anzahl Emojis. Diese auf den ersten Blick unübersichtliche Vielfalt erschwert es Sprachwissenschaftler*innen, den Überblick über alle Kommunikationsformen zu behalten und die verschiedenen Phänomene entsprechend analysieren und einordnen zu können. Hinzu kommt, dass sich die schriftliche und audiovisuelleAudiovisualität Kommunikation den technischenTechnik Neuerungen und Veränderungen schnell anpasst. Da stets neue Apps und Funktionen auf den Markt gebracht werden und die bevorzugten Kommunikationskanäle häufigem Wechsel unterliegen, ist die Forschung gezwungenermassen immer etwas im Rückstand. Zu diesen Neuerungen zählen zum Beispiel auch die im Juni 2017 eingeführten Animojis. Diese eröffnen die Möglichkeit, eine SprachnachrichtSprachnachricht inklusive dynamischer Mimik zusammen mit einer Anzahl animierter Emojis oder mit einem individuell angepassten AvatarAvatar im EmojiEmoji-Stil zu verschicken.
In diesem Aufsatz wollen wir zunächst darlegen, was ein AnimojiAnimoji genau ist (Kap. 2). Hierzu skizzieren wir die Entwicklungsgeschichte hin zu Animojis und widmen uns anschliessend der Frage, wie mit Animojis kommuniziert wird. Im daran anschliessenden Kapitel folgt eine Beschreibung des Animoji-Phänomens aus linguistischer Perspektive (Kap. 3). Hier untersuchen wir das Phänomen auf mehreren Ebenen: Zuerst fokussieren wir uns auf die visuelle Ebene und setzen Animojis in Relation zu den (allgemein bekannten) Emojis. Für die Analyse der auditiven Ebene vergleichen wir, in welchen Aspekten sich Animojis von Sprachnachrichten unterscheiden. Diese beiden Punkte führen zur Synthese, dass Animojis als audiovisuellesAudiovisualität Phänomen aufzufassen sind. Vor diesem Hintergrund gehen wir anschliessend auf die praktische Verwendung von Animojis ein (Kap. 4) und zeigen auf, wie mit Animojis kommuniziert wird. Im abschliessenden Kapitel (Kap. 5) fassen wir die Ergebnisse unserer Untersuchung in einem Résumé zusammen und geben eine Prognose dazu ab, wohin die Auseinandersetzung mit Animojis führen könnte.
2 Was ist ein AnimojiAnimoji?
2.1 Entwicklungsgeschichte
SmartphonesSmartphone haben sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Kommunikationsmittel überhaupt entwickelt. Mit WhatsAppWhatsApp oder anderen Nachrichtenapplikationen auf dem HandySmartphone können wir in ständigem Kontakt mit Menschen auf der ganzen Welt sein, unabhängig davon, wo wir uns gerade befinden. Digitale KommunikationKommunikationdigitale funktioniert so praktisch gänzlich ortsungebunden (siehe König/Hector 2017: 4). Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Übertragungsgeschwindigkeit. Nicht zuletzt dadurch hat sich die Tendenz von der Versendung von Nachrichten mit hoher Informationsdichte (wie z.B. Briefen) hin zur Kommunikation durch knappere Einzelnachrichten verstärkt. Die Geschichte des Briefes – der trotz SmartphonesSmartphone nicht von der Bildfläche verschwunden ist, sondern ein neues, wenn auch kleineres und spezifischeres Feld innerhalb der Kommunikation abdeckt – zeigt aber auch, dass ältere Kommunikationsmittel in der Regel nicht einfach durch neuere Entwicklungen ersetzt, sondern ergänzt werden. So öffnet sich tendenziell ein immer breiteres Feld unterschiedlicher Kommunikationskanäle, die parallel verwendet werden und je einen spezifischen Aufgabenbereich abdecken.
Jüngste Entwicklungen scheinen diesen Trend zu bestätigen: Immer wieder werden Applikationen eingeführt, die gezielt für einen bestimmten Kontext konzipiert wurden. Ein Beispiel dafür ist der webbasierte Instant-MessagingInstant-Messanging-Dienst Slack, der mit unterschiedlichen Tools wie einer Chatfunktion, To-do-Listen etc. spezifisch für die Kommunikation in beruflichen Teams entwickelt wurde. In den letzten Jahrzehnten haben sich Technologien wie Handschriftenerkennung, Bildverarbeitung, Gesichtsdetektion und -identifikation zudem so weiterentwickelt, dass nicht nur stillstehende Objekte verarbeitet werden können, sondern auch sich bewegende Objekte (Körperverfolgung) – eine technischeTechnik Voraussetzung für die Produktion von Animojis. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, wie sich die visuelle und auditive Ebene weiterentwickelt haben: Bei den ersten SprachassistentenSprachassistenz wie AlexaAlexa von Amazon, Cortana von Microsoft, Assistant von Google und SiriSiri von Apple wurde z.B. der Fokus auf die mündliche Kommunikation gelegt. Auch die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation via MaschineMaschine wird immer weiter ausgebaut. Diese Entwicklungen ermöglichen die Kommunikation auf unterschiedlichen Kanälen. Schenk und Rigoli (2010: 3) nennen als wichtigste den visuellen (Bildschirm) und den auditiven Kanal (Lautsprecher). Für die Produktion von Animojis sind Kamera, Mikrofon und Touchscreen von Bedeutung. Aber auch innerhalb der neuen digitalen KommunikationsmedienKommunikationdigitale gibt es laufend Erweiterungen und neue Funktionen. So kamen zu den Emoticons (bestehend aus Klammern und Interpunktionszeichen) die Emojis, animierte GIFsGIF, Sticker, unterschiedliche Schriftarten und verschiedene Nachrichteneffekte (wie z.B. Konfetti, das eine Nachricht auf iMessageiMessage begleiten kann) hinzu. Weiter wurde das Versenden von Fotos, Videos und von Sprachnachrichten ermöglicht, die textbasierte Nachrichten ersetzen oder ergänzen können (siehe Stark 2018). Zu dieser grossen Palette digitaler KommunikationsmöglichkeitenKommunikationdigitale hat sich, wie erwähnt, im Jahr 2017 das AnimojiAnimoji hinzugesellt, dem wir uns nun im Folgenden ausführlicher widmen werden.
2.2 AnimojiAnimoji: Beschreibung des digitalen Phänomens
Zunächst soll erläutert werden, was ein AnimojiAnimoji überhaupt ist. Herring et al. (2020: 1) beschreiben Animojis folgendermassen: «[U]sers can video chat and send video clips of themselves speaking through large-format emoji that mirror movements of the sender’s head, mouth, eyes, and eyebrows in real time». Ein Animoji ist also ein grossformatiges, animiertes 3D-EmojiEmoji, welches die Mimik der aufgenommenen Person auf das Emoji überträgt und die parallel dazu aufgenommenen Sprachbotschaften wiedergibt. Kurz: Es kombiniert die bekannten Emojis mit der Stimme der Person zu einem Videoclip – deshalb auch die Bezeichnung Animoji, was ein Portmanteau-Wort aus AnimationAnimation und Emoji ist.
Um Animojis zu verwenden, wird zuerst die gewünschte EmojiEmoji-Maske ausgewählt, zum Beispiel der Kopf einer Kuh (siehe Abb. 1), anschliessend wird eine Nachricht in die Frontkamera des HandysSmartphone gesprochen, die von dem AnimojiAnimoji wiedergegeben wird. Neben der Nutzung von vorgefertigten, meist aus den Emojis bekannten Gesichtzeichen besteht auch die Möglichkeit, ein personalisiertes Animoji zu erstellen, welches das eigene Gesicht repräsentieren soll und dementsprechend nach dem eigenen Vorbild gestaltet wird (siehe ebenfalls Abbildung 1 und 2 oben). Solche Avatare werden Memojis genannt. Diese Memojis können statisch als Sticker – wie Emojis (siehe Abb. 2) – oder als Aufzeichnungen eines animierten Bildes versendet werden. Die personalisierbaren Elemente der Memojis schliessen zum Beispiel Festlegungen zur Frisur, zu Haut- und Augenfarbe, Make-up und Piercings ein. Im Unterschied zu Animojis ist die Funktion der MemojiMemoji-Sticker mit denen von ‹normalen› Emojis vergleichbar. Beide werden als statische Bildzeichen verwendet, und beide können dazu genutzt werden, schriftliche Äusserungen zu ergänzen oder zu kommentieren. Im Folgenden werden wir aber nicht weiter auf diese statischen Elemente eingehen, wir konzentrieren uns vielmehr auf die Funktion und die Art der Verwendung von animierten Memojis und Animojis. Immer wenn hier von Animojis die Rede ist, sind also animierte Animojis gemeint – und auch animierte Memojis mitgedacht. Memojis stellen nämlich eine Unterkategorie von Animojis dar und werden, abgesehen von der vorhergehenden Gestaltung, identisch verwendet.
 Abb. 1:
Abb. 1:
Personalisiertes MemojiMemoji (links) und Standard-AnimojiAnimoji (rechts)
 Abb. 2:
Abb. 2:
Personalisierter MemojiMemoji-Sticker (oben) und EmojiEmoji (unten) im Vergleich
Um das einmal ausgewählte AnimojiAnimoji in Bewegung zu setzen bzw. es sprechen zu lassen, sind die Parameter Kopf, Mund, Augen und Augenbrauen entscheidend. Die entsprechenden Bewegungen im Gesicht der Sender*innen werden beim Erstellen eines Animojis von der Handykamera aufgenommen und durch die Signalverarbeitung des iPhones als Gesichtsbewegungen im Animoji wiedergegeben. Die Mimik wird durch GesichtserkennungstechnikTechnik parallel zur Sprachaufnahme der Sprecher*innen aufgenommen und mit minimaler Ton-Bild-Verschiebung beinahe zeitgleich vom Animoji dargestellt. Die aufgenommene Nachricht kann nun über Apples iMessageiMessage verschickt werden und von den Empfänger*innen in einer Endlosschleife oder in Form eines Videos (je nach Handymodell und Betriebssystem) abgespielt werden. Dabei ist anzumerken, dass es noch nicht möglich ist, Animojis auf allen Applikationen abzuspielen. So ist bspw. WhatsAppWhatsApp (Stand September 2020) noch nicht mit Animojis kompatibel.
Bei der Kommunikation mittels Animojis handelt es sich um eine sogenannte «Keyboard-to-screen-Kommunikation» (siehe Dürscheid/Frick 2014: 152f.). Dazu zählt jegliche Art von Kommunikation, die über Tastatur und Bildschirm geführt wird – unabhängig vom technischenTechnik Modell, das dazu verwendet wird, und der Art der Datenübertragung. Bei der Verwendung von Animojis sind vor allem der Bildschirm und die in SmartphonesSmartphone integrierte Frontkamera wichtig, um die visuelle Komponente wiedergeben zu können. Die Tastatur auf dem Touchscreen spielt eine eher untergeordnete Rolle, ist aber dennoch grundlegend, um die Aufnahme überhaupt starten und beenden und schliesslich wiedergeben zu können.
2.3 Überblick über den Forschungsstand
Da Animojis erst im Jahr 2017 eingeführt wurden, also ein jüngeres Phänomen sind, liegt zum derzeitigen Zeitpunkt nur wenig Forschungsliteratur vor. Ein aufschlussreicher Aufsatz über AnimojiAnimoji-Performances wurde jedoch kürzlich von Susan Herring et al. veröffentlicht. Herring et al. (2020) haben 397 Videoclips analysiert, welche sich aus 31 Memojis und 366 Animojis zusammenstellen, und das Animoji-Phänomen im Rahmen der filtered digital self-representation (FDSR) untersucht. Diese Art der Selbstdarstellung hat nicht nur durch die von InstagramInstagram und Snapchat bekannten dynamischen Filter, sondern durch das Auftreten von sogenannten Deepfakes an Bedeutung gewonnen. Bei dieser durch Filter veränderten Aufnahme wird in einem digitalen KommunikationskontextKommunikationdigitale eine technologisch modifizierte Version von sich selbst oder einer anderen Person kreiert. So können Bilder oder Videoaufnahmen – vor allem von Personen – mit Make-up-Filtern, Kostümen oder verschiedenen Hintergründen modifiziert werden. Zudem gibt es Filter, mit denen das Alter oder das Geschlecht verändert werden kann. Unter dem Strich kann man sagen, dass digitale Filter dazu dienen, den/die Empfänger*in der Nachricht zu täuschen und Bild und Ton so zu verändern, dass Selbst- und Fremddarstellung stark verzerrt sind. Die filterbasierte digitale Selbstdarstellung geht damit in eine Richtung, die im Gegensatz zu einer Kommunikation steht, die darauf abzielt, Informationen so präzise und wahrheitsgetreu wie möglich weiterzugeben.
Herring et al. schlagen eine Brücke zwischen dieser filterbasierten, digitalen Darstellung des Selbst und einem weiteren Konzept, nämlich der Polynymität. Dieses Wort lehnt sich an das Wort AnonymitätAnonymität an. Laut Herring et al. (2020: 3) bezieht sich ‹Polynymität› (wörtlich: ‹viele Namen›) auf die Tendenz der Nutzer*innenNutzer*in von sozialen MedienMedium/Medien, mehrere Identitäten in einer Vielzahl von Online-Räumen und manchmal innerhalb einer einzigen Plattform zu schaffen und aufrechtzuerhalten. FDSR ist dabei hilfreich, die Polynymität durch visuelle und auditive Veränderungen zur Unterstützung und Widerspiegelung multipler Identitäten zu ermöglichen. Animojis sind exemplarisch für Polynymität, da zwischen verschiedenen EmojiEmoji-Masken frei gewählt werden kann und ihre Verwendung die Inszenierung verschiedener Identitäten ermöglicht. Als Beispiel dafür wird von Herring et al. vor allem das Spiel mit Genderidentitäten genannt. Dieses Phänomen ist auch von Online-Rollenspielen her bekannt. In diesen Spielen nehmen die Teilnehmer*innen ein anderes Geschlecht (oder eine andere Hautfarbe, sexuelle Orientierung usw.) (siehe McRae 1996) an. Auch ein MemojiMemoji kann sich vom persönlichen Aussehen, dem eigenen Geschlecht usw. unterscheiden. Die Möglichkeit der Personalisierung stellt dem Nutzer, der Nutzerin frei, ein sich ähnliches Abbild zu erstellen (wie es Me in dem Wort Memoji andeutet) oder mit den veränderbaren, äusseren Merkmalen zu spielen und zu experimentieren.
Auf soziokultureller Ebene werden aufgrund der Polynymität StereotypenStereotyp ermöglicht, welche stets auch mit ideologischen Werten einhergehen. So fanden Herring et al. in ihrer Untersuchung heraus, dass in AnimojiAnimoji-Kommunikaten die Darsteller*innen sprachliche Merkmale verwenden, die ihren Aussagen kulturelle und ideologische Bedeutung verleihen und über den eigentlichen Inhalt der Aussage hinausgehen (siehe Herring et al. 2020: 5). Beispielsweise beobachteten sie, dass Huhn, Katze und Schwein vor allem mit stereotypisierten weiblichen Stimmen inszeniert wurden – und dies auch von männlichen Sprechern (siehe Herring et al. 2020: 11). Dieser Prozess stellt eine Art Stilisierung der Sprache dar. Laut Bakhtin sind stilisierte Äusserungen inhärent mehrstimmig und beinhalten «a varying degrees of otherness or varying degrees of ‹our-own-ness›» (Bakhtin 1986: 89). Das zeigt, dass auch mit stilisierten Lauten auf sprachlicher Ebene StereotypenStereotyp verbreitet werden können. Auch Stark (2018) unterstreicht, dass sich Animojis an den Ausdruck von Emotionen annähern und bestehende racial categories durch ihre formalen und ästhetischen Merkmale verdinglichen und aufrechterhalten. Zum Beispiel werden dialektale Stilisierungen, welche mit African-American Vernacular English (AAVE) assoziiert werden – postvokales /r/, /l/-Streichung und Vereinfachung der Konsonanten-Cluster (Herring et al. 2020: 5) –, so verwendet, dass sie StereotypenStereotyp verstärken. Stark (2018) weist darauf hin, dass nicht nur die Darstellung von menschlichen Gesichtern und Körpern, sondern die Darstellung menschlicher Affekte und Emotionen die Hauptfaktoren sind, die die digitale AnimationAnimation des Rassenschemas kodieren. Für die Forschung ist es deshalb wichtig, dass die Schematisierung bei der Kodierung des menschlichen Gesichts (und des Körpers) kritisch betrachtet wird. Denn die schematisierenden – und laut Stark Rassismus propagierenden – technischenTechnik Mechanismen dienen nur vermeintlich der spielerischen Erweiterung von Emojis. Browne (2015) hat dazu beobachtet, dass Gesichtserkennungstechnologien und andere Systeme zur visuellen Klassifizierung menschlicher KörperKörper immer Mittel sind, mit denen race definiert und sichtbar gemacht wird.
Wie erkennbar wird, haben Animojis das Potential – im Hinblick auf FDSR –, die Realität zu verzerren oder auch StereotypenStereotyp zu stärken. Sie geben dem NutzerNutzer*in, der Nutzerin die Möglichkeit, sich hinter einer anderen Identität zu verstecken. Das soll aber nicht bedeuten, dass dies die einzigen Potentiale von Animojis sind. Die Tatsache, dass Animojis eine innovative, neue Art der Kommunikation ermöglichen, soll hier gewürdigt und im Folgenden aus sprachwissenschaftlicher Perspektive ausgeleuchtet werden.
3 Linguistische Analyse des AnimojiAnimoji-Phänomens
3.1 Visuelle Ebene – Vergleich zwischen Animojis, Emojis und Memojis
Die optische Ähnlichkeit von Animojis und Emoijs legt einen Vergleich der beiden Phänomene in Bezug auf die visuelle Ebene nahe. Während Animojis als audiovisuelleAudiovisualität Kommunikate definiert werden können, sind Emojis rein visueller Natur (siehe Tab. 1). Es sind statische Bilder, die nur einen festgefrorenen Gesichtsausdruck darstellen können. Da syntaktische Relationen nicht durch Emojis allein geklärt werden können und sie deshalb nicht eigenständig Sachverhalte transportieren können, treten sie in der Regel gepaart mit oder in Ergänzung zu Schriftzeichen auf. Einzeln werden sie meist nur als Reaktion auf die TextnachrichtTextnachricht der Kommunikationspartner*innen verwendet. Mit Emojis können keine Informationen zu Tempus, Modus oder Kasus ausgedrückt werden. So lässt sich zum Beispiel von der EmojiEmoji-Abfolge  nicht eindeutig sagen, ob hier gemeint ist, die Frau selbst sei gut oder ihre Meinung zu etwas sei positiv (siehe Dürscheid 2017: 260 und s.u., Tab. 1). Emojis stehen entweder vor (
nicht eindeutig sagen, ob hier gemeint ist, die Frau selbst sei gut oder ihre Meinung zu etwas sei positiv (siehe Dürscheid 2017: 260 und s.u., Tab. 1). Emojis stehen entweder vor ( so lustig) oder nach (echt schade
so lustig) oder nach (echt schade  ) einer Textsequenz, in seltenen Fällen auch innerhalb eines Wortes (wir geniessen die S
) einer Textsequenz, in seltenen Fällen auch innerhalb eines Wortes (wir geniessen die S nne), oder sie werden als einzelne Nachricht versendet. Emojis und Buchstaben werden linear von links nach rechts, also in Schreibrichtung, angeordnet. Sie erscheinen auf WhatsAppWhatsApp zusammen als eine Art Textfeld und werden als Einheit wahrgenommen. In der folgenden Tabelle haben wir die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Emojis, Animojis und Memojis in Hinblick auf Produktion, Modalität, Grammatik, Dynamik, Kommunikationsmedium und Kommunikationsform dargestellt.
nne), oder sie werden als einzelne Nachricht versendet. Emojis und Buchstaben werden linear von links nach rechts, also in Schreibrichtung, angeordnet. Sie erscheinen auf WhatsAppWhatsApp zusammen als eine Art Textfeld und werden als Einheit wahrgenommen. In der folgenden Tabelle haben wir die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Emojis, Animojis und Memojis in Hinblick auf Produktion, Modalität, Grammatik, Dynamik, Kommunikationsmedium und Kommunikationsform dargestellt.
| Emoji | Animoji | Memoji | |
| Produktion | typographisch | Aufzeichnung eines Gesichts | individuell angepasst (customized) und allenfalls Aufzeichnung eines Gesichts1 |
| Modalität | visuell | audio-visuell | (audio-)visuell2 |
| Grammatik | keine Syntax, als Ergänzung zur geschriebenen Sprache, kein Ersatz für Sprache (Dürscheid 2017) | auditive Ebene: orientiert sich an gesprochener Sprache visuelle Ebene: abstrahiert, maskenähnlich, animierte Darstellung des Gesichts | wie Animoji |
| Dynamik | statisch | dynamisch | dynamisch oder statisch (als Sticker) |
| Kommunikationsmedium | Smartphone/Computer | Smartphone | Smartphone |
| Kommunikationsform | graphisch realisiert | medial mündlich realisiert | medial mündlich oder graphisch realisiert |
Tab.1:
Überblick – Vergleich EmojiEmoji, AnimojiAnimoji, MemojiMemoji
Der massgebliche Unterschied von AnimojiAnimoji zu EmojiEmoji besteht darin, dass die Emojis-Gesichter dynamisch animiert sind und in Verbindung mit einer auditiven Nachricht stehen. Wie bereits erläutert, wird beim Aufnehmen der Nachricht nicht nur das Gesprochene gespeichert, sondern durch maschinelle Gesichtserkennung auch die Mimik festgehalten. Dabei werden die aufgenommenen Gesichtsausdrücke vereinfacht und auf einer Art digitalen Maske animiert. Wiedergeben wird die Mimik entweder von einem selbst gestalteten AvatarAvatar oder einem Gesicht, das aus den Emojis bekannt ist (siehe Abb. 2). Mit einem Animoji kann man nicken, man kann auf ein trauriges Gesicht ein Lachen folgen lassen oder genervt mit den Augen rollen – und dies stets parallel zur gesprochenen SprachnachrichtSprachnachricht. Die Entwickler von Animojis werben damit, dass diese kleinen, virtuellenvirtuell Gesichtsavatare mehr als 50 Muskelbewegungen verfolgen und nachahmen können (siehe Stark 2018).
Doch auch Animojis unterliegen gewissen Einschränkungen. Da sie nur den Kopf darstellen können, stossen sie schnell an ihre Grenzen. Sie können nicht die ganze Bandbreite menschlicher Ausdrücke verarbeiten, geschweige denn darstellen – vor allem nicht solche, die den ganzen KörperKörper einbeziehen. Die nonverbale Kommunikation beschränkt sich entsprechend auf die Mimik; Gesten werden komplett ausgeschlossen. Auf jeden Fall kann man ein AnimojiAnimoji-Kommunikat als eine erweiterte und modifizierte Art einer SprachnachrichtSprachnachricht ansehen. Je nachdem, welche Form gewählt wird, verleiht das Animoji der gesprochenen Nachricht eine andere Färbung. Die Tierdarstellungen wie auch die RoboterRoboter- und Gespensterköpfe haben eher spielerischen, unterhaltsamen Charakter.3 Die personalisierte Version hingegen kann die Sprachnachricht persönlicher erscheinen lassen, weil die Empfänger*innen in dem animierten Gesicht die Sender*innen wiedererkennen, auch wenn es sich natürlich immer noch um eine Reduktion und Vereinfachung handelt. Trotz der Ähnlichkeit zwischen Animoji und Sender ist eine Animoji-Nachricht aber unpersönlicher als eine Nachricht über ein Video. Denn beim Animoji ist es ja, im Gegensatz zu einer Videoaufnahme, nicht das eigene Ich, das die Nachricht wiedergibt, sondern ein AvatarAvatar, eine Art Bote, der mit der Stimme der Sender*innen zu den Empfänger*innen spricht.
Neben dem Übermitteln von Inhalt spielt bei der Nutzung von Animojis auch der Aspekt Gamification eine wichtige Rolle: Animojis ermöglichen den NutzerNutzer*in*innen, Online-Personen zu kreieren, die die Gestalt von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder populären YouTubern annehmen, und auf diese Weise deren Rolle zu spielen. Oder sie erlauben, mit den eigenen äusseren Eigenschaften zu spielen – das beginnt bei der Veränderung der Frisur und kann bis zum bereits erwähnten Genderwechsel führen. Im Gegensatz zu einem Videochat ist mit Animojis aber keine synchrone KommunikationKommunikationsynchrone möglich. Das heisst, dass die Empfänger*innen einer Nachricht, anders als bei einem Face-to-Face-Face-to-Face-Gespräch oder Video-Gespräch, den Sprechakt des Kommunikationspartners nicht simultan miterleben. Aufgrund der Quasi-SynchronizitätKommunikationquasi-synchrone haben sie auch keine Möglichkeit, in das Kommunikationsgeschehen einzugreifen, vielmehr können sie immer erst das Endprodukt der Nachricht ansehen bzw. anhören (siehe Howind 2020: 16). Die Kommunikation mittels AnimojiAnimoji bleibt also eine Annäherung an reale menschliche Kommunikation, indem visuelle Elemente die gesprochene Sprache begleiten. Gleichzeitig entfernt sich die Animoji-Kommunikation von natürlicher Kommunikation, indem sie die über die Kamera aufgenommenen Signale zu einer Maske verarbeitet und so die Realität verzerrt.