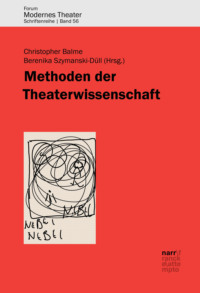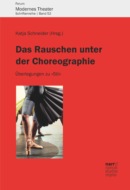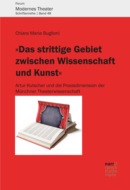Kitabı oku: «Methoden der Theaterwissenschaft», sayfa 11
Anwendungsfelder: Archiv/Praxis
Wie nun könnte eine theater- und tanzwissenschaftliche Methodik aussehen, die sich bewusst ins Verhältnis setzt zu den besonderen Wissensformen und -dynamiken, die mit dem Begriff und der Metapher des Archivs benannt werden? Archive eröffnen mit der Vielfalt der in ihnen gesammelten Quellen immer wieder den Rückbezug auf Anfänge, Voraussetzungen, Entscheidungen, und damit auch das Feld einer nach möglichen Ereignissen fragenden, mitunter spekulativen Historiographie.1 Sie enthalten gleichsam Rohstoffe von Geschichtsschreibung, nicht deren Resultate. Dokumente werden in historischen Archiven ja vor allem „um der Möglichkeit, eine Geschichtsquelle zu sein“ bewahrt,2 und eben nicht als schon restlos gedeutete Monumente. Daher wäre Foucaults Archäologie des Wissens weiterzudenken auch im Sinne einer methodisch reflektierten Infragestellung vermeintlich gesicherter, jedenfalls immer wieder nacherzählter Hypothesen. Für die Theatergeschichte ist es, wie von Andreas Kotte bemerkt, beispielsweise keine unwichtige Frage, wer wann und warum die Behauptung von griechischen Ursprüngen des europäischen Theaters propagiert hat.3 Aus der Perspektive des Archivs stellt sich die Frage nach den immer wieder beschworenen „griechischen Anfängen“ aber auch umgekehrt: Was bedeutet es für das Verständnis von Archiven, dass als eines der frühesten erhaltenen Archive der griechischen Kultur ausgerechnet die Didaskalien gelten können, die Listen der Gewinner von Theaterwettbewerben (Dichter, Schauspieler, Choregen)? Warum wurden diese von Aristoteles und seinen Schülern wohl zu Lehrzwecken erstellten Siegerlisten nachträglich auch in Stein gemeißelt? In welchem Verhältnis steht diese buchstäbliche Monumentalisierung der pädagogischen Dokumente zu der über ein Jahrhundert früheren großen Zeit der Theateragone und zu deren herausgehobener Bedeutung für die demokratische Öffentlichkeit der Stadtgesellschaft?
Theo Girshausen hat auf diese Fragen in seiner Studie zu den „Ursprungszeiten des Theaters“, unter dem konkreteren Titel Das Theater der Antike, eine Reihe von Antworten gegeben, die im Hinblick auf mögliche Wechselwirkungen zwischen der Struktur von Archiven und den Methoden der Theaterwissenschaft erhellend sind. So deutet er die Herstellung der Monumente, durchaus im Sinne Foucaults, als eine eigene Form der Geschichtsschreibung, basierend allein auf Jahreszahlen und Namen. Der Sinn ihrer Zusammenstellung liege einerseits in einem politischen Motiv, den zur Zeit des Lykurg ausgeprägten Bemühungen, die Traditionen des klassischen Athen wieder aufleben zu lassen und die kulturelle Einheit Athens in einer Zeit des außenpolitischen Bedeutungsverlusts zu stärken. Dazu käme als ‚wissenschaftliches‘ Motiv eine auch sonst für die griechische Geschichtsschreibung zu beobachtende Beglaubigung der mythischen Vorgeschichte(n) der Stadt, in diesem Fall durch den linearen Zusammenhang von Aufführungs- und Festdaten.4 Die Art und Weise, in der diese Siegerlisten auch von Aristoteles selbst für seine Poetik genutzt wurden, in der er wiederum eine bestimmte Erzählung vom Ursprung des Theaters gibt, dient Girshausen als Beleg für die Grundannahme seiner Untersuchung, dass alles Wissen über antikes Theater schon Teil einer Wirkungs- und Vermittlungsgeschichte ist, die eine seit der Renaissance zentrale und normativ gedeutete Funktion für die Selbstbegründung europäischer Kultur produziert hat.5 In der Antike habe es zwar keine dem heutigen Verständnis von Quellenkritik vergleichbaren Methoden gegeben, gleichwohl die Tendenz, für die Abgrenzung im weiteren Sinne kulturgeschichtlicher Erzählungen von unglaubwürdig gewordenen Mythen auch auf die Struktur von bloßen Chronologien zurückzugreifen. Gerade an diesem für die Historiographie des antiken Theaters entscheidenden Punkt verdeutlicht Girshausen zugleich den phantasmatischen Charakter aller späteren Ursprungserzählungen des Theaters, indem er auf die eigentliche Problematik der monumentalisierten Listen verweist: das krasse Missverhältnis zwischen den Namen vieler Dichter und tausenden Titeln von siegreichen Stücken und den nur wenige Prozent davon erreichenden, erhaltenen Werken von bloß drei Tragödien- und zwei Komödiendichtern. Demnach enthält das Archiv der Didaskalien eigentlich vor allem die verlorenen Bestände, verweist auf eine „Leerstelle der Überlieferung“.6 Die späteren Versuche, diese Lücken zu füllen und insbesondere den Ursprung des Theaters zu konstruieren, hätten das Wissen über die wirklichen Entstehungszusammenhänge des griechischen Theaters nur punktuell und fragmentarisch erweitern können, sich in der Entwicklung vielfältiger neuer Theaterformen jedoch als höchst produktiv erwiesen.7
Das Beispiel manifestiert exemplarisch das Spannungsverhältnis zwischen den mehr oder weniger bewussten Absichten theaterhistoriographischer Forschung und andererseits den in Archiven enthaltenen Spuren und Resten einer selbst immer schon von Wirkungsabsichten geprägten kulturellen Überlieferung. Damit verdeutlicht es einmal mehr die Notwendigkeit, den linearen Interpretationen und ‚großen Erzählungen‘ der Geschichtsschreibung entgegen nach konkreten szenischen und theatralen Praktiken zu fragen. Paradoxerweise sind Archive für die Forschung gerade im Fehlen von Beweisen, im Mangel an Evidenz, und in der Lückenhaftigkeit aller Überlieferung nach wie vor notwendige Orte der Aporie, der immer neu zu machenden Erfahrung, dass die Quellen etwas ganz anderes sagen (können), als das was die Geschichtsschreibung von ihnen hören will. Exemplarisch dafür wären, wie Kotte gezeigt hat, auch die in Archiven mitunter auftauchenden Zeugnisse für Theaterformen und -diskurse, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, zumindest nicht nach den etablierten Vorstellungen über ein „Theatervakuum“ zwischen dem 6. und dem 10. Jahrhundert, aus dem dann erst die christliche Osterfeier einen neuen ‚Ursprung‘ von Theater hervorgebracht hätte.8
Mit diesen und ähnlichen Widersprüchen erweist sich auch ein elementares Problem der methodischen Bestimmung von Theaterwissenschaft, nämlich das Verhältnis von Spieltexten und Aufführungspraxis, als eine Frage des Archivs und seiner vielfältigen Funktionen. Die mitunter dem Archiv zugeschriebene Aufgabe, tradierte Stücke von den Einflüssen aktueller Aufführungen zu bewahren,9 sollte nicht verdecken, dass die Texte selbst eine Vielzahl theaterhistorischer Informationen über die jeweilige Aufführungspraxis enthalten, in deren Kontext sie entstanden sind, basierend auf Konventionen, die von den Autoren mit geprägt wurden oder schon vorausgesetzt werden konnten.10 Um die Texte aber heute noch oder wieder in diesem praktischen Sinne lesen zu können, sind die entsprechenden Kontexte zu rekonstruieren und vielfältige weitere Quellen heranzuziehen. Auch dem von hier aus absehbaren Desiderat, dass zwischen einzelnen Bereichen theaterwissenschaftlicher Forschung: Historiographie, Aufführungs- bzw. Inszenierungsanalyse, Werkinterpretation etc. (wieder) eine größere Durchlässigkeit zu erreichen wäre, kann womöglich gerade in der Auseinandersetzung mit Fragen des Archivs in produktiver Weise entsprochen werden. Dafür müsste allerdings die historiographische Perspektive sowohl mit der Archivierung theatraler Praktiken als auch mit den Praktiken des Archivierens noch stärker zusammengedacht und verknüpft werden.
Worin liegt denn, wie nochmal etwas grundsätzlicher mit Jacques Derrida zu fragen wäre, die „einzigartige Erfahrung des Versprechens“, die vom Archiv ausgeht, wenn nicht eben in dem Versprechen einer Erfahrung? Ist diese Erfahrung aber nicht gerade die Erfahrung eines Verlusts, der produktiv wird? Um diesen Punkt kreist gegenwärtig auch die theoretische Reflexion der medialen Revolution, mit der die technische Struktur den archivierbaren Inhalt nicht mehr nur zu interpretieren, sondern sogar zu produzieren begonnen hat: „Die Archivierung bringt das Ereignis in gleichem Maße hervor, wie sie es aufzeichnet. Das ist auch unsere politische Erfahrung mit den sogenannten Informationsmedien.“11 Die von dieser Erfahrung nahegelegte Dekonstruktion des Archivbegriffs ist insgesamt für die Frage relevant, inwieweit Perspektiven, Probleme und Potenziale des Archivs methodologische Impulse für eine theaterwissenschaftliche Forschung geben können, die an der Vermittlung zwischen historiographischen Fragen und den Erfahrungen zeitgenössischer Praxis arbeitet. Das Interesse am Re-enactment als einer Methode der künstlerischen Forschung weist jedenfalls Parallelen auf zu der bereits von Max Herrmann formulierten Idee szenischer Rekonstruktionen. Diese sollte sich jedoch nicht bloß der detailgetreuen Wiederherstellung historischer Inszenierungen widmen, sondern zugleich auf Praktiken (Schauspiel, Tanz, Performance, etc.) und ihre Reflexion zielen. Gerade darin liegt ja eine genuine Möglichkeit theatraler Praxis, dass sie im Unterschied zur technischen Reproduktion den Vorgang der Wiederholung als einen nicht auf Identität, sondern auch auf Differenz, Abweichung und Verfremdung gerichteten Prozess begreifen kann. Ansätze in dieser Richtung sind gerade in der aktuellen Tanzpraxis besonders vielfältig, reichen von Martin Nachbars Urheben Aufheben über Fabian Barbas Mary Wigman Dance Evening bis hin zu Christina Ciupkes und Anna Tills Undo, Redo and Repeat oder Christoph Winklers Ernest Berk – The Complete Expressionist.12
Die Entwicklung zeitgenössischer Formen von Theater, Performance und Tanz reflektiert jedenfalls auch schon die medialen Revolutionen, in denen der Zuwachs an sofort verfügbaren Informationen verschiedenste Formen von Gedächtnisschwund und Traditionsverlust zu produzieren scheint. Umso größer ist die kulturpolitische Bedeutung, die derzeit dem Umgang mit Spuren, Dokumenten und Zeugnissen der künstlerischen Praxis zukommt. Als Archiv-Praxis können sich alternative Formen der Überlieferung durch Weitergabe und Wiederaneignung entfalten, in einer bewussten Überschreitung und Neubefragung von Tradition und Konvention. Im Tanz wird besonders evident, dass es mit dem Archiv nicht nur um Künstler*innen und individuelle Werke geht, sondern um Praktiken sowie um Kontexte. Hier ist eine historiographische Erforschung der Spezialarchive für Tanz und Theater ein akutes Desiderat, auch zur Reflexion der jeweiligen Fachgeschichte.13
Weitere methodologische Herausforderungen der Forschung sind im Bereich von Theater, Tanz und Performance in einer kritischen Mitwirkung an der Erhaltung und Neu-Strukturierung von Archiven zu sehen, z.B. bei Projekten wie dem Aufbau eines Archiv des Freien Theaters14 oder der Vernetzung der Tanzarchive und auf Tanz bezogenen Sammlungen mit ihren verschiedenen Datenbanken15 sowie der dringend erforderlichen Unterstützung auch der etablierten Theaterinstitutionen bei der Entwicklung von tragfähigen Konzepten zur Archivierung und Digitalisierung ihrer Dokumentations- und Vermittlungspraxis. Ein besonderes Arbeitsfeld liegt schließlich in der bereits von Foucault zitierten Deutung des Archivs als „System der Formation und Transformation von Aussagen“ begründet, die davon ausgehende Entwicklung einer fachspezifischen Ontologie von Begriffen und Relationen, zur Verbesserung von Ordnungs- und Suchkategorien, sowie als Grundlage für die Vernetzung von Informationen im Rahmen der weiter entwickelten Möglichkeiten des Internet, im sogenannten Semantic Web.16 Auch von daher liegt die Frage nahe, inwieweit neue Medientechnologien im Bereich der Künste bereits Archivkonzepte ermöglichen, die auch unabhängig von Systemen der alphabetischen Verschlagwortung und den dementsprechend zumeist unzulänglichen Klassifikationen operieren können: „[D]ie genuinen Optionen anderer Bild- und Tonordnungen (image-based image retrieval etwa) zu nutzen, ist der Auftrag des digitalen Archivs.“17
Mit der damit nochmals erweiterten Perspektive könnte eine stärkere praktische und zugleich theoretische Einbeziehung der Archive schließlich auch Impulse geben für die allfällige Diskussion von terminologischen und materiellen Grundlagen der theater- und tanzwissenschaftlichen Forschung. Hier liegen zahlreiche weitere, nur durch organisierte Interessensvertretung zu bewältigende Aufgaben: 1.) eine engere Zusammenarbeit mit Archiven auf allen Ebenen, für Lehre, Forschung und Vermittlung; 2.) eine für die dringend nötigen Veränderungen der Urheber- und Verwertungsrechte gemeinsam mit anderen Fachgruppen zu führende, aber jeweils fachwissenschaftlich orientierte Argumentation; 3.) verstärkte Initiativen zur gezielten Digitalisierung fachspezifischer Quellen und Sammlungen, im Rahmen einer weiteren Vernetzung der Informationssysteme mit größeren Einrichtungen (Deutsche Digitale Bibliothek DDB, Europeana, etc.) auch auf internationaler Ebene; 4.) eine intensive Reflexion terminologischer Fragen im Hinblick auf internationale, transkulturelle und transmediale Übersetzbarkeit; 5.) eine theaterwissenschaftliche Lehre, die auch kommende Forschungsgenerationen motiviert, die Infrastrukturen des für das eigene Fach spezifischen Wissens verantwortlich mitzugestalten. Ein in diesem Sinne konstruktiver Streit um tragfähige Begriffe wäre nicht die schlechteste Methode, mit der Arbeit der Archive zugleich die Zukunft des Fachs zu fördern, in der Zeitform einer stets zukünftigen Vergangenheit von Theater.
Affekttheorie und das Subjektivismus-Problem in der Aufführungsanalyse
Matthias Warstat
Wenn nach den in der Theaterwissenschaft heute vorherrschenden methodischen Zugängen gefragt wird, fällt es überraschend schwer, den Stellenwert der Aufführungsanalyse einzuschätzen. In der universitären Lehre spielt sie eine wichtige Rolle und wird an den meisten Instituten zum Gegenstand von Einführungskursen und Methodenübungen. In der theaterwissenschaftlichen Forschungsliteratur führt sie dagegen eher ein Schattendasein, denn selten werden Theateraufführungen der Gegenwart in Monographien und Aufsätzen so detailliert beschrieben und untersucht, dass das aufführungsanalytische Vorgehen tatsächlich im Einzelnen transparent wird. Typischerweise finden sich in der Literatur kurze, illustrative Vignetten mit Aufführungsbeispielen, die nicht genauer erkennen lassen, wie und auf welcher Grundlage sie methodisch erarbeitet wurden. Eine Diskussion darüber, wie man adäquat über Aufführungen schreibt, findet auf wissenschaftlichen Tagungen nur selten statt – wohl aber in der akademischen Lehre. Dort wird an gemeinsam besuchten Aufführungen das Protokollieren von Beobachtungen und Erinnerungen geübt. Das Sprechen und Schreiben über Aufführungen ist insofern charakteristischer Bestandteil des theaterwissenschaftlichen Studiums. Woran könnte es liegen, dass viele Theaterwissenschaftler*innen dieses aufführungsbezogene Schreiben in ihrer späteren Forschungspraxis so nicht beibehalten? Unterschiedliche Gründe wären denkbar: Sicher hat die umstandslose Verfügbarkeit von Fotos, Trailern und Videoclips zu vielen laufenden Inszenierungen das ihre dazu beigetragen, dass in Referaten und Vorträgen allzu oft visuelle Dokumente eine detailliertere Beschreibung des szenischen Geschehens ersetzen.
Daneben könnte sich aber eine grundsätzlichere Skepsis auswirken. Von jeher gibt es Zweifel am Methodencharakter der Aufführungsanalyse. Gerade im interdisziplinären Kontakt, auf fachübergreifenden Konferenzen oder in Forschungsverbünden wird man mit der skeptischen Einschätzung konfrontiert, die Aufführungsanalyse – in ihrer letztlich doch freien und ungeregelten Form – sei im Grunde keine ‚richtige‘ Methode. Diese Auffassung hat einiges für sich, ist für das Fach aber mit Gefahren verbunden, denn wenn in disziplinübergreifenden Debatten der Methodencharakter der Aufführungsanalyse in Abrede gestellt wird, kann es schnell prinzipiell um die Legitimität der Theaterwissenschaft als Wissenschaft gehen. Gerade Diskussionen mit Sozialwissenschaftler*innen sind oft schwer zu führen, weil sich deren Methodenverständnis kaum auf die Praxis der Aufführungsanalyse beziehen lässt. So gehen Aufführungsanalysen, zumal wenn ein Erinnerungsprotokoll am Anfang steht, nicht immer von expliziten Hypothesen aus. Die Erkenntnisse, die aufführungsanalytisch gewonnen werden, sind im strengen Sinne nicht nachprüfbar. Und wo nur noch quantifizierbare Ergebnisse zählen, läuft die Praxis der Theaterwissenschaft auch jenseits der Aufführungsanalyse Gefahr, als ein subjektivistisches Gerede über Aufführungen disqualifiziert zu werden.
Um eben diesen Subjektivismus-Vorwurf gegen die Aufführungsanalyse soll es in meinem Beitrag gehen. Denn der Vorwurf verfolgt die Theaterwissenschaft besonders hartnäckig, er wird auch fachintern immer wieder laut und prägt die Lehre von Anfang an. Bereits im allerersten Semester – und dann in immer neuen Wendungen – fragen Studierende: „Wie subjektiv darf meine Analyse sein?“ Die Antwort lautet in der Regel: Natürlich darf sie subjektiv sein, muss es sogar – aber dann ertappen sich Lehrende doch dabei, vom siebenundzwanzigsten Erinnerungsprotokoll, in dem ausführlich dargelegt wird, wie sehr man sich in der Aufführung gelangweilt oder wovor man sich geekelt hat, ein wenig entnervt zu sein. Dass die subjektivistische Schilderung von eigener Langeweile, persönlichen Abneigungen und idiosynkratischen Befindlichkeiten am Ende nicht viel über die zu analysierende Aufführung aussagt, wird den Seminargruppen schnell deutlich, doch umso dringlicher stellt sich dann die Frage nach dem sozusagen angemessenen, akzeptablen Maß an Subjektivität.
Die identitätspolitischen Debatten der letzten Jahre haben das Problem verschärft. Denn während man es vor nicht langer Zeit noch vorwiegend eindrucksvoll fand, wenn jemand sein individuelles Spüren und Fühlen in einer Aufführung differenziert zu beschreiben vermochte, können solche Beschreibungen heute nicht nur auf eine methodologische, sondern auch auf eine politische Kritik stoßen: Ist es überhaupt zulässig, von eigenen Gefühlen und Empfindungen auf die Erfahrungsdimension ganzer Aufführungen zu schließen? Neigen die Analysierenden von Aufführungen nicht zu unbefangen dazu, ihre eigene Sicht der Dinge zu verallgemeinern, ohne zu berücksichtigen, dass dasselbe szenische Geschehen von anderen Zuschauer*innen vielleicht ganz anders wahrgenommen wurde? Die politische Dimension dieser Fragen wird deutlich, wenn man hinzufügt, dass diese anderen Zuschauer*innen womöglich anderen sozialen und kulturellen Milieus angehören, mit anderen Ausschlüssen und Diskriminierungen konfrontiert sind, einen anderen Erfahrungshintergrund in die Aufführung mitbringen. Die Blackfacing-Debatte nach 2012 hat unterstrichen, dass es nicht irrelevant ist, wer aus welcher Perspektive und von welcher sozialen Position aus über eine Aufführung spricht oder schreibt.1 Eine mögliche Schlussfolgerung aus der Debatte konnte es sein, sensibler darauf zu achten, die eigene Sicht auf eine Aufführung (auch im wissenschaftlichen Schreiben) nicht unhinterfragt zu universalisieren. Dies gilt umso mehr, wenn von Affekten, Gefühlen oder Emotionen die Rede ist.
Im Folgenden soll das Subjektivitätsproblem der Aufführungsanalyse gerade in Bezug auf ein affektorientiertes Schreiben erörtert werden. Der erste Teil versucht einen kurzen Rückblick auf Traditionslinien der Aufführungsanalyse. Die aktuelle Virulenz des Subjektivitätsproblems wird im zweiten Teil genauer erläutert. Im dritten Teil soll eine Differenz zwischen Affekt und Emotion betont werden, um auf dieser Grundlage im letzten Teil eine affektorientierte Analyserichtung vorzuführen, die darauf abzielt, den Subjekt-Objekt-Gegensatz im Beschreiben des szenischen Geschehens wenn nicht zu überwinden, so doch abzuschwächen und weniger stark in die Deskriptionen einfließen zu lassen. Es kann nicht darum gehen, die unhintergehbare Subjektivität des Analysierens zu kaschieren. Gleichwohl sind Möglichkeiten erkennbar, gerade die affektive Dimension der Aufführung zu thematisieren, ohne das gesamte Geschehen auf ein angebliches ‚Ich‘ des Analysierenden zu zentrieren.