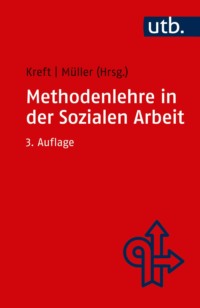Kitabı oku: «Methodenlehre in der Sozialen Arbeit», sayfa 2
So erklären wir uns, dass der alte ‚Methodenbegriff‘, der im deutschen Sprachraum ohnehin einen technokratischen Beigeschmack hat, durch eine Reihe von Verlegenheitsbegriffen ersetzt wurde, die in wenig plausiblen Beziehungen zueinander und zur Tradition der ‚alten Methoden‘ standen. Damit gingen aber sowohl die wissenschaftstheoretischen und philosophisch-weltanschaulichen als auch die forschungspraktischen Kenntnis- und Wissensbestände verloren, die bei der Entwicklung der klassischen Methoden eine Entscheidung gespielt hatten: beispielsweise die Überzeugungen von der Notwendigkeit spiegelbildlicher Kommunikation mit Menschen fremden ethnischen und sozialen Herkommens und anderer kultureller Orientierung, Kenntnisse von der Bedeutung der Rolle von Altersgleichen in jugendlichen Aneignungs- und Sozialisationsprozessen (Sherif / Sherif 1964) und Erkenntnisse der Ökologie (im ursprünglichen Sinne) als der Beziehung zwischen Menschen und ihren Lebensräumen.
Uns liegt daran, den Begriff der ‚Methoden‘ (und des ‚methodischen Arbeitens‘) für alle Berufs- und Tätigkeitssegmente Sozialer Arbeit als strukturierendes Element der Ausbildung in der Profession und der Qualifikation für bürgerschaftliches Engagement zu erhalten und dabei die ihnen zugrunde liegenden Gesellschafts- und Menschenbilder stärker zu betonen, als das in den manchmal etwas hastigen Rezeptionen der 1950er Jahre der Fall gewesen sein mag. Wir befinden uns dabei übrigens – zwei Generationen später – in Übereinstimmung mit internationalen Traditionen weltweit. Denn die internationalen Dachorganisationen und die Ausbildungsstätten für Soziale Arbeit haben die drei klassischen Methoden längst als Grundlagen für die Ausbildung zur Sozialen Arbeit anerkannt. Sie sind die Grundlage aller Lehrpläne der sog. Schools of Social Work, in denen auch die anderen relevanten Grundlagenfächer sozialarbeitsbezogen zusammengefasst werden.
Wir schlagen daher für die ebenso praktische wie systematische Verständigung in der sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Ausbildungs- und Weiterbildungspraxis vor, dem Begriff der ‚Methoden‘ den Begriff der ‚Konzepte‘ vorzuordnen und die Begriffe ‚Verfahren‘ und ‚Techniken‘ nachzuordnen. Also: Konzepte, Methoden, Verfahren und Techniken.
Es liegt im Übrigen für uns auf der Hand, dass ‚vor‘ und dass ‚nach‘ keine Rangfolge darstellt, sondern eine chronologische Abfolge im Entdeckungs-, Darstellungs- und Lernprozess.
Konzepte, Methoden, Verfahren, Techniken: Wie diese Begriffe verwendet werden könnten
Konzepte / Konzeptionen: Ein Konzept meint seinem lateinischen Ursprung nach (‚con scribere‘: ‚zusammenschreiben‘): ‚erster Entwurf‘, ‚erste Niederschrift‘. In einem erweiterten Sinne bereits „von einer bestimmten Idee oder Vorstellung ausgehend, ein Projekt planen, entwerfen, entwickeln“ (Duden-Fremdwörterbuch 2015), das Projekt also zu konzipieren. Konzepte sind heute i. d. R. zweckgebundene Absichtserklärungen über die geplanten Funktionsmerkmale und Vorgehensweisen einer Sache, eines Verfahrens, eines Projektes, einer Einrichtung. Sie geben vor allem Auskunft über die ‚Ausrichtung des fachlichen Handelns‘ (z. B.: ‚Wir stellen uns vor, dass diese Maßnahme eine wirkungsvolle Alternative zur geschlossenen Unterbringung ist‘ oder: ‚Wir arbeiten nach dem erlebnispädagogischen Konzept von Otto Hahn‘).
Eine Konzeption bezieht sich dann auf den institutionellen Wirkungszusammenhang für die gesamte Arbeit innerhalb einer Einrichtung oder einer Organisation. Sie enthält Aussagen darüber, welcher Zielgruppe welche Leistungen mit welchen Zielen und Leitlinien (Arbeitsprinzipien) sowie Arbeits- und Angebotsformen angeboten werden, und wie und mit welchen Aufgaben welche MitarbeiterInnen zusammenarbeiten. Konzeptionen konkretisieren also die ‚Leistungsversprechen‘ einer Einrichtung. Und eine Konzeption ist in diesem Verständnis die Basis für das weitere methodische Handeln (nach v. Spiegel 2018, 188 ff.).
So ist beispielsweise in § 45 Abs.3 Nr.1 SGB VIII vorgeschrieben, dass der Träger der Einrichtung bereits mit dem Antrag auf Betriebserlaubnis eine Konzeption seiner Einrichtung vorzulegen hat (genauer Smessaert/Lakies in: Münder et al. 2019, § 45, Rz 44).
Wir schlagen deshalb vor, die Begriffe Konzept / Konzeption i. S. einer unverzichtbaren erläuternden, beschreibenden, klärenden Vorarbeit für das nachfolgende methodische Handeln zu verwenden.
Methoden und Verfahren: Der Begriff Methode hat einen griechischen und lateinischen Ursprung. Er meint ‚Weg zu etwas hin‘ und in übertragenem Sinne ‚Weg und Gang einer Untersuchung‘, „auf einem Regelsystem aufbauendes Verfahren, das zur Erlangung von (wissenschaftlichen) Erkenntnissen oder praktischen Ergebnissen dient“ (Duden-Fremdwörterbuch 2015). ‚Methode haben‘ bedeutet also ‚wohl durchdacht sein, auf einem genauen Plan beruhend‘. Das Gegenteil wäre ein zufälliges oder willkürliches Vorgehen oder unüberlegte situative Sprunghaftigkeit. Die wissenschaftliche Reflexion methodischen Vorgehens bezeichnete man früher als Methodik, heute wird dafür häufig der Metabegriff Methodologie gewählt.
Auch hier besteht die Schwierigkeit zunächst wieder darin, dass diese – durchaus bekannten und gebräuchlichen – Begriffe so wenig trennscharf voneinander verwendet werden, dass sie schließlich kaum noch Orientierung bieten. So sprechen Geißler / Hege in ihrem Klassiker der Methodenlehre (Konzepte sozialpädagogischen Handelns 2007) von ‚psychoanalytischen, klientenzentrierten, kommunikationstheoretischen, gruppendynamischen und gruppenpädagogischen Konzepten, Methoden und Verfahren‘. Diese begriffliche Diversifizierung hilft jedenfalls nicht (sofort) dabei, jedem Begriff einen eigenen abgrenzbaren Inhalt zuzuordnen (also zu orientieren). Auch bei Galuske wird in seinem – überaus verdienstvollen und lehrreichen – Ordnungsversuch der Methoden in der Sozialen Arbeit (Galuske 2013, 164 ff., insbes. die Übersicht S. 168) nicht klar, was in der Aufzählung eine Methode oder ein Konzept ist. Schaut man sich seine „Steckbriefe“ (168 ff.) an, dann sind das alles Versuche, die aktuellen Regeln der Kunst (für ein angemessenes ‚Vorgehen‘, also Verfahren) für die von ihm ausgewählten 19 Fachgebiete zu beschreiben.
Qualitätssicherung durch Verfahren: Bei den weiterhin so heftig diskutierten strafrechtlichen Folgen unsachgemäßen Handelns (Kriseninterventionen bei vermuteter Kindeswohlgefährdung: jetzt v. a. § 8a SGB VIII und die Kinderschutzgesetze des Bundes und der Länder) wird „die Fachlichkeit sozialer Arbeit in erster Linie an der Einhaltung des richtigen und normativ vorgeschriebenen Verfahrens (Hervorhebung d. d. V.) bei der Entscheidung über die notwendige Intervention und der anschließenden Leistungsgewährung“ beurteilt.
„In der Kinder- und Jugendhilfe lässt sich die Fachlichkeit nicht an den Ergebnissen messen (da es hier keine linearen Umsetzungen wissenschaftlich-empirischen Regelwissens gibt). Damit verschiebt sich der Fokus in der sozialen Arbeit weg von den Ergebnissen hin zu den Verfahrensabläufen. Wenn schon nicht klar sein kann, ob immer das Richtige getan wird, muss das, was getan wird, richtig und begründet getan werden. Gemessen werden kann die Fachlichkeit sozialer Arbeit (also) in erster Linie an der Einhaltung des richtigen und normativ vorgeschriebenen Verfahrens bei der Entscheidung über die notwendige Intervention und der anschließenden Leistungsgewährung“ (Meysen in: Münder et al. 2019, Anhang II, Rz. 12).
Das ist auch durchaus überzeugend. Denn a priori ist es unmöglich, für alle Teilbereiche / Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit gleichermaßen festzulegen, was ‚die Regeln der Kunst‘ sind. Das ist eine überaus mühevolle Arbeit und sie muss immer wieder kleinteilig geleistet und zeitgemäß modifiziert werden: also nicht für die Alten- oder Kinder- und Jugendhilfe insgesamt, nicht einmal für die Jugendarbeit oder die Hilfen zur Erziehung, auch nicht nur für die Offene Jugendarbeit (zuletzt der Versuch von Deinet / Sturzenhecker 2013), aber (eben kleinteilig) zur Krisenintervention / zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (Deutscher Verein 2009 und das ISS 2012, zuletzt zusammenfassend Biesel/Urban-Stahl 2018) sowie exemplarisch zur Jugendhilfeplanung (Kreft / Falten 2003; umfassend Maykus / Schone 2010).
Immer ist inhaltlich angemessenes Handeln strukturiert, d. h. in ein steuerndes Verfahren eingebunden.
Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, schlagen wir vor, den Begriff Methode von seinem inflationären Gebrauch zu lösen (irgendwann wäre sonst schließlich jedes Handeln, das Regeln folgt, eine Methode) und diesen Begriff nur noch für die drei klassischen Methoden zu verwenden. Alle anderen Versuche, die Regeln der Kunst für einen bestimmten Teilbereich der Sozialen Arbeit zu beschreiben, sollten als Verfahren bezeichnet werden.
Denn die drei klassischen Methoden – die soziale Einzelhilfe, die soziale Gruppenarbeit und die Gemeinwesenarbeit – entsprechen nach Herkunft und Entwicklung den drei kommunikativen Grundmustern allen sozialpädagogischen / sozialarbeiterischen Handelns: als Face-to-Face-Beziehung, handelnd in Gruppen, agierend im sozialen Nahraum. Auch in ihren jeweiligen aktuellen Ausformungen (z. B. die soziale Einzelhilfe als Casemanagement, die Gemeinwesenarbeit als sozialräumliche Stadtteilarbeit zur Initiierung bürgerschaftlichen Engagements) haben sie ihre grundsätzliche Orientierung für jedwedes methodisches Handeln nicht verloren und sind in dieser Bedeutung nicht ersetzt worden (genauer dazu Kap. 2: die Beschreibungen der klassischen Methoden und Kap. 3: die exemplarischen Beschreibungen ausgewählter Verfahren).
Techniken: Techniken sind gewissermaßen ‚unterhalb‘ von Methoden und Verfahren angesiedelt. Sie dienen der Operationalisierung methodischen Handelns. Sie bezeichnen „erprobte, standardisierte Verhaltensmuster, deren Wirkung mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussagbar ist“. Es können „Techniken der Kontaktaufnahme, der Materialerhebung und -sammlung, der Planung, der Rollenklärung (…), der Gesprächsführung und der Moderation von Sitzungen und lokalen Prozessen“ sein (Krauß 2017, 651). Bekannte Techniken sind
◼ die Anamnese (Lukas 2017 a),
◼ Arbeitsformen der empirischen Sozialforschung (Lukas 2017b),
◼ die Genealogie oder Genogrammarbeit (Kap. 4.3),
◼ die Szenariotechnik (Hopmann 2005),
◼ das Soziogramm (die grafische Darstellung sozialen Verhaltens oder von Beziehungen in einer Gruppe) (Wendt, P.-U. 2017, 4.3.3),
◼ das narrative Interview (zur Anregung von erzählenden Lebens- und Bildungsgeschichten) (Wendt, P.-U. 2017, 4.3.1),
◼ die projektive Frage (zum Durchlöchern der Mauer des Faktischen),
◼ das Rollenspiel (zur Erprobung alternativer Handlungsweisen: Kap. 4.5),
◼ die Tetralemmaarbeit (zum kreativen Umgang mit Gegensätzen und Vieldeutigkeiten: Kap. 3.4.6),
◼ das aktivierende Interview (zum Bekanntmachen von Problemen im Stadtteil),
◼ die (kontrolliert) konfrontative Gesprächshaltung (zur Erinnerung des Gesprächspartners an geäußerte Widersprüche im Gespräch oder zwischen Gespräch und Handeln) sowie
◼ viele didaktische Spiele (Thiesen 2017 mit weiteren Nachweisen).
Solche Techniken können im Einzelfall wirkungsvoll und zielführend sein. Sie geraten aber zur ‚Ramschware im Sommerschlussverkauf‘, wenn sie von freischaffenden ‚Coaches‘ im Eilverfahren angeboten und antrainiert werden, ohne dass der methodenorientierte Hintergrund zur Sprache gebracht wurde, der allein eine professionelle Glaubwürdigkeit verbürgen könnte (dazu Belardi 2018).
(Vgl. die Beschreibungen ausgewählter Techniken in Kap 4)
Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit
Inzwischen wird immer wieder zwischen Methoden der Sozialen Arbeit und methodischem Handeln unterschieden (dazu Kap. 1.4 und umfassend v. Spiegel 2018). Das vor allem, weil es ‚die Methode‘, ‚das Verfahren‘ im sozialarbeiterischen / sozialpädagogischen Handlungsalltag nicht gibt (also eine voll standardisierte Handlungsvorgabe, die in allen Einzelheiten des gemeinsam vorangetriebenen Lehr-Lern-Prozesses zwischen Sozialarbeitern / Sozialpädagogen und Klienten gilt) – nicht geben kann bei der Unterschiedlichkeit der Lebenswelten und Lebenslagen und der damit verbundenen ‚Beziehungen‘ zwischen denjenigen, die soziale Leistungen ‚nachfragen‘, und den Professionellen. In diesem vielgestaltigen und vielschichtigen Alltag ist nicht mithilfe einer ‚Ziel-Mittel-Technologie‘ zu intervenieren, sondern diese Beziehungen sind nach einem modernen Verständnis von Sozialer Arbeit in einer „strukturierten Offenheit“ (Thiersch 1993) zu gestalten, zudem als Koproduktion: Idealtypisch bilden sich sozialpädagogische / sozialarbeiterische Angebote sozialräumlich (also in der Lebenswelt der Nachfrager) und in einem Aushandlungsprozess aus, um zu erreichen, dass „Lebensbedingungen so gestaltet werden, dass Menschen dort entsprechend ihren Bedürfnissen zufrieden(er) leben können“ (Hinte in: Hinte / Treeß 2014, 34). Und das geht nur durch den Einsatz eines Methoden- und Verfahrensmixes!
„Das berufliche Handeln in der Sozialen Arbeit wird durch den reflexiven Einsatz der eigenen „Person als Werkzeug“ verwirklicht. Methodisch zu handeln bedeutet, die spezifischen Aufgaben und Probleme der Sozialen Arbeit zielorientiert, kontextbezogen, kriteriengeleitet sowie strukturiert und gleichzeitig offen zu bearbeiten.“ (v. Spiegel 2018, 9 und ausführlich Kap. 1.4).
Schlussbemerkung
Unser Strukturierungsvorschlag für den Prozess wissenschaftlich gestützten planmäßigen Arbeitens geht also davon aus, dass die Erkenntnisse und Ergebnisse der Methodenlehre ‚in einer ganz bestimmten Ordnung‘ für das methodische Handeln im Einzelfall genutzt werden:
Im ‚Fall im Feld‘ oder ‚in der Gruppe im Feld‘ soll der / die handelnde Sozialarbeiter / Sozialpädagoge / -in ‚nach den aktuellen, anerkannten Regeln der Kunst‘ methodisch angemessen handeln.
Er oder sie kann das eigene Handeln nach unserem Vorschlag ‚ordnen‘ über Konzepte / Konzeptionen, über die Wahl der grundsätzlich angemessenen Vorgehensweise (da bieten die drei klassischen Methoden Orientierung), durch Rückgriff auf inzwischen erarbeitete, beschriebene und bewährte Verfahren des standardgemäßen Vorgehens. Er oder sie kann ein möglichst breites Technikrepertoire nutzen und schließlich in der je konkreten Arbeitssituation seines / ihres Arbeitsplatzes (etwa als Jugendarbeiter, als Mitarbeiterin eines Allgemeinen Sozialen Dienstes, als Planer) ‚Arbeitshilfen für die Gestaltung von Situationen‘ (v. Spiegel 2018, 139 ff.) entwickeln.
 Weiterführende Literatur
Weiterführende Literatur
Galuske, M. (2013): Methoden der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. 10. Aufl. Beltz Juventa, Weinheim / München
Diese Einführung in die ‚Methoden‘ war lange das Standardwerk, ist aber inzwischen in Teilen veraltet.
Müller, C. W. (2013): Wie Helfen zum Beruf wurde. Eine Methodengeschichte der Sozialen Arbeit. 6. Aufl. Beltz Juventa, Weinheim / München
Der Klassiker zur Entwicklung der ‚Methoden‘.
Spiegel, H. v. (2018): Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. 6. Aufl. Ernst Reinhardt, München / Basel
Die Kenntnis der ‚Methoden‘ ist das eine, sie im beruflichen Alltag ‚richtig‘ einzusetzen das andere: Das ‚Wie‘ wird hier überzeugend dargestellt.
Wendt, P.-U. (2017): Lehrbuch Methoden der Sozialen Arbeit. 2. Aufl. Beltz Juventa, Weinheim/Basel
Ist inzwischen die aktuellste und umfassendste Darstellung der Methodenlehre.
1.2 Beobachten, Beurteilen, Handeln: Handlungsbezogene Reflexion und Wissensanwendung als Merkmale professioneller Sozialer Arbeit
Von Stephan Maykus
Einführung
Was bedeutet professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit? Auf diese Frage hat eine Studentin im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit geantwortet: „Für mich bedeutet es, dass ich nicht nur aus dem Bauch heraus handele; dass ich erklären kann, was ich tue, und mich mit Kollegen darüber austausche, mit denen ich eine gemeinsame Sprache spreche, weil wir Theorien und Methoden kennen, sie auch teilen, da wir sie im Studium erlernt haben. Professionell heißt für mich auch, dass ich mein Handeln begründen kann und nicht einfach drauflos agiere.“ Diese Äußerung, entstanden vor dem Hintergrund erster praktischer Erfahrungen im Feld der Sozialen Arbeit, deutet ein wichtiges Grundverständnis von professionellem Handeln an; es vergegenwärtigt auch, wie dieses Verständnis verinnerlicht werden und professionsbildend wirken kann (kollegiale Prozesse auf der Grundlage gemeinsamer fachlicher Standards) – und dennoch: Es provoziert die Auseinandersetzung mit Widersprüchen. Scheinbar spricht die Studentin einen Balanceakt zwischen professionellem und laienhaftem Handeln an, denn es soll „nicht nur“ aus dem Bauch heraus gehandelt werden, was grundsätzlich wohl als zulässig angesehen wird (solange es durch reflektiertes Handeln regelmäßig ausgeglichen wird).
Bedeutet Professionalität nicht vielmehr, dass genau dieses Bauchgefühl als Grundlage des Handelns möglichst abgestellt wird? Oder äußert sie sich in genau diesem erfolgreich realisierten Balanceakt? Der Verweis auf Aspekte wie Erklärungen, Begründungen, Theorien und Methoden untermauert dies aus Sicht der Studentin sicher, aber eine Frage drängt sich auf: Welche Bedeutung nehmen diese Aspekte in einer Praxis der Sozialen Arbeit ein, die sich alltags- und lebensweltorientiert versteht, darin auch alltagsnahe (vermeintlich unprofessionell anmutende) Handlungen vollzieht? Inwiefern haben sie in diesem konzeptionellen Rahmen ihren Ort? Dieser Beitrag wird diesen Fragen nachgehen und vor allem die Relevanz des angedeuteten Grundverständnisses professionellen Handelns im Kontext einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit verdeutlichen und aufzeigen, dass SozialarbeiterInnen stets ihre Handlungsprozesse fachlich fundiert, reflektiert umsetzen müssen, damit eine ,strukturierte Offenheit‘ (Thiersch 1993) alltags- und lebensweltorientierter Sozialer Arbeit entsteht und sie letztlich erst bewältigbar macht. Hierbei machen Wissen, Können und Haltung zentrale Bausteine professionellen Handelns aus (v. Spiegel 2018), die grundsätzlich als gleichrangige Konstituenten der Handlungspraxis anzusehen sind. In diesem Beitrag soll das Zusammenspiel der Bausteine jedoch auf einen Blickwinkel hin verdichtet werden: Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit ist Handeln nach den Regeln der Kunst (dazu Kap. 1.1), wie aber gelangen SozialarbeiterInnen zu diesen ‚Regeln‘? Anders formuliert: Wie lassen sich Prozesse handlungsbezogener Reflexion und Wissensgenerierung – Beobachten, Beurteilen, Handeln – als Merkmale professionellen Handelns beschreiben und (angehenden) Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern vermitteln? Ein Versuch dieser Beschreibung und Vermittlung soll anhand von vier Schritten unternommen werden.
Beobachten, Beurteilen, Handeln: Vier Schritte zur Beschreibung
1. Schritt: Das Grundverständnis klären – Was bedeutet methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit? Warum ist die Beschäftigung mit dem Handlungsprozess „Beobachten, Beurteilen, Handeln“ von Bedeutung?
2. Schritt:: Das Können im Zusammenhang mit Wissen und Reflexion erkennen – Was zeichnet typische Handlungssituationen in der Sozialen Arbeit aus? Was sollten SozialarbeiterInnen demnach (methodisch) beherrschen?
3. Schritt:: Das Regelhafte in der Offenheit gestalten – Wie generieren SozialarbeiterInnen Wissen und Strategien des Handelns in Praxissituationen?
4. Schritt:: Den Blick öffnen – Beobachten, Beurteilen, Handeln ist auf mehreren Praxisebenen (in Kontexten methodischen Handelns) wichtig!
Eine situative Skizze: Sie dient aus der Praxis der Sozialen Arbeit (hier exemplarisch aus dem Bereich des Kinderschutzes) der Veranschaulichung und als begleitendes Bild für die LeserInnen. Gleichzeitig soll dadurch ein gedanklicher Freiraum für Überlegungen zum praktischen Handeln geboten werden, der mit eigenen konkreten Erfahrungen oder konstruierten Situationen sowie Anforderungen (im Sinne von ‚Gedanken-Spielen‘) gefüllt werden kann. Das Beispiel beschreibt die Erfahrung einer Sozialarbeiterin im Bereich der Familienhilfe, die mit dem Phänomen der Kindeswohlgefährdung konfrontiert ist:
„Die Kinder von Frau E. werden im emotionalen, hygienischen und medizinischen Bereich vernachlässigt. Diese Unterversorgung ist im Kindergarten und der Schule auffällig geworden. Die Kinder haben keine Unterwäsche und die Kleidung wird selten gewaschen. Die Gesichter sind blass, die Milchzähne des jüngsten Kindes sind abgefault, die des größeres Kindes kariös. Die Wohnung wird unzureichend gereinigt, es treten Läuse auf. Untersuchungstermine wurden nicht wahrgenommen, finanzielle Engpässe treten immer wieder auf.“ (DKSB / ISA 2006, 8)
1. Schritt: Das Grundverständnis klären: Was bedeutet methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit?
In der vorstehend beschriebenen Situation ist die Sozialarbeiterin gefordert: Sie muss sich schnell ein Bild von den Ursachen und Folgen der Situation machen und darauf abgestimmte Handlungsstrategien entwickeln, den Kontakt mit dem zuständigen Jugendamt suchen, um die Gefährdung des Kindeswohls einzudämmen und die Lebens- und Versorgungssituation in der Familie durch sozialpädagogische Hilfen, gegebenenfalls auch mittels rechtlicher Regularien, zu verbessern. Als Betrachter erwartet man ein professionelles und situationsadäquates Handeln, ein methodisch strukturiertes Handeln ‚nach den Regeln der Kunst‘, das die gewählten Interventionen nicht nur begründet, sondern auch legitimiert und einer Rechenschaftslegung zugänglich macht (vgl. Kap. 1.1).
Was kennzeichnet demnach professionelles Handeln, das methodisch gestützt ist? Das berufliche Handeln ist durch einen methodischen Prozess gekennzeichnet, der Situationen und Aufgaben anhand von Wissen und Erfahrung strukturiert, so dass die Auswahl von Methoden und Handlungsschritten nachvollziehbar und orientiert an fachlichen Kriterien erfolgen kann. Dabei soll ein Rückgriff auf verfügbares Fachwissen, auf ein Repertoire an Methoden, Verfahren und Techniken, diesen Prozess ordnen helfen, damit auf der Basis aktuell gültiger fachlicher Standards gehandelt wird (vgl. Kap. 1.1). Dieses Wissen und Können wird auch der Sozialarbeiterin im genannten Beispiel hilfreich sein, indem sie hier vor allem einen kritisch-reflexiven Umgang mit z. B. Indikatorenlisten zur Erkennung der Kindeswohlgefährdung kultiviert, Techniken der sozialen und lebenslagenbezogenen Diagnose beherrscht sowie Prozesse der Beratung und Begleitung in der Familie gestalten kann. Hinzu kommen wichtige rechtliche Grundkenntnisse, das Wissen um ihren Auftrag und dessen Spielräume wie auch Grenzen, Kooperationskompetenzen mit dem Jugendamt sowie die Austarierung der ständig präsenten Widersprüchlichkeit von Hilfe und Kontrolle. Und zudem verlangt man ihr, den sozialpädagogischen Standards entsprechend, eine berufliche Haltung ab, die Wertschätzung, Orientierung an Selbstbestimmtheit der Klientel sowie an der Prozesshaftigkeit des eigenen Handelns umfasst, ohne dabei die situativen Grenzen dessen zu missachten (z. B. bei Interventionen zur Krisenbearbeitung und zum Schutz der Kinder) (zu den Grundsätzen des methodischen Handelns Krauß 2017 sowie Galuske / Müller 2012). Hiermit sind Merkmale des professionellen Handelns in der Sozialen Arbeit angesprochen, die ebenso plausibel, unhintergehbar, wie auch schwierig in der Umsetzung sind, denn man kann in diesem Feld
„nicht mit schlichten Wenn-Dann-Technologien operieren. Ihre (die der Sozialen Arbeit; d. V.) Instrumente lassen keine sicheren Prognosen über die Folgen des Änderungshandelns zu. Deshalb folgt das berufliche Handeln häufig Plausibilitäts- und Wahrscheinlichkeitsüberlegungen. Das Handeln hat demzufolge häufig den Charakter des Versuchs“ (Krauß 2017, 653).
Der flexible Umgang mit Methoden und Techniken, ihre je situative Anwendung und Modifizierung im komplexen Alltag der Klienten erfordert eine Reflexions- und Handlungskompetenz, die in ihrer tendenziellen Entgrenztheit nicht selten überfordert. Die Sozialarbeiterin kann nicht vollends sicher sein, wie welche Handlungsschritte wirken und ob sie nachhaltig geeignet sind, die Situation der Kinder und der Familie zu verbessern. Sie kann sich auch nicht sicher sein, alle relevanten Ursachen bearbeiten zu können, gar erkannt zu haben, und versucht daher, die sich ihr erschließende Komplexität der Situation zu ordnen, damit sie handeln kann. Dieses Handeln in Krisen, in zugespitzten Problemlagen (wie z. B. im Kontext der Kindeswohlgefährdung), die konsequente Orientierung an der Lebenswelt der Klienten dabei führt zu einer Nichtstandardisierbarkeit des professionellen Handelns, wie Oevermann es formuliert hat (Becker-Lenz / Müller 2009, 26), das in komplexen Situationen trotzdem zu Entscheidungen über Handeln führen muss. In einer empirischen Studie, in der Handlungsanforderungen in der Sozialen Arbeit von Studierenden (im Verlaufe ihres Studiums) bewertet wurden, haben Becker-Lenz / Müller (2009, 31 ff.) typische Handlungsprobleme identifiziert: Schwer fällt den Befragten demnach die
◼ Klärung des Auftrages (Problem der Definition von Zuständigkeiten),
◼ Durchführung einer sozialpädagogischen Diagnose (Problem der Fallanalyse mittels der Integration von Fachwissen – Beobachten und Beurteilen als schwierige Anforderung),
◼ Wahl und der Einsatz von Verfahren (Problem der Interventionsplanung – strukturiertes Handeln als weitere schwierige Anforderung) sowie die
◼ Klärung des Arbeitsbündnisses mit den Klienten (Problem der Gestaltung von Beziehungsstrukturen).
Die AutorInnen schließen aus den Ergebnissen, dass im Studium der Sozialen Arbeit ein professioneller Habitus geprägt werden sollte, der ein spezifisches Berufsethos sowie Kompetenzen der multiperspektivischen Fallarbeit und der Gestaltung von Arbeitsbündnissen vereint (Becker-Lenz / Müller 2009, 35 und Becker-Lenz / Müller 2009). Diese Idealvorstellung ist schon lange Thema in der Auseinandersetzung mit der sozialpädagogischen Berufsrolle, die Burkhard Müller treffend durch eine „Last der großen Hoffnungen“ (B. Müller 1991) herausgefordert sieht und der ebendies bereits forderte: die Klärung des Gegenstandes der Intervention und des Arbeitsbündnisses mit den Klienten. Das doppelte Vermittlungsproblem der SozialarbeiterInnen zwischen Beziehungsarbeit und Kontrolle verlangt gerade bei einer sich als alltags- und lebensweltorientiert verstehenden Sozialen Arbeit den kritischen Blick auf eine technokratische Methodenpraxis, erfordert jedoch gleichzeitig einen methodisch gestützten Umgang mit der Offenheit von Situationen. SozialarbeiterInnen sollten daher ihr Handeln auf ein Fachwissen gründen, das Theorien umfasst, die die Erkenntnis der Handelnden unterstützt und nicht ersetzt. Sie sollen die Reflexivität erhöhen, die Bewertung seitheriger Praxis ermöglichen und zukünftiges Handeln optimieren helfen (B. Müller 1991, 132). B. Müller betont daher eine selbstreflexive und praxiskritische Haltung:
„Sicherheit im pädagogischen Handeln kann sich (…) nicht daraus ergeben, dass es seinen Gegenstand fest im Griff hat und der eigenen Wirkungen gewiss ist. Sicherheit des Handelns kommt hier aus dem Bewusstsein, das Mögliche getan zu haben und die eigenen Grenzen zu kennen“ (Müller 1991, 134 f.).
Professionelle Handlungskompetenz in der modernen Sozialen Arbeit, das ist hier demnach die zentrale Ausgangsthese (dazu Maykus 2003), bedeutet die Befähigung der MitarbeiterInnen in sozialen Organisationen zur Multiperspektivität und zur eigenen bzw. konzeptionellen Entwicklungsfähigkeit. Es wird zukünftig weniger darum gehen, isolierte Handlungsprogramme bezüglich bestimmter Adressatengruppen zu diskutieren und umzusetzen, vielmehr werden diese integriert in Rahmenkonzepte des Handelns, in Strategien einer gleichermaßen flexiblen und standardisierten Kompetenz, die auf aktuelle Erfordernisse reagieren kann und ihre Gültigkeit nicht in Abhängigkeit von ihnen erlangt. Mit Galuske (2013) lässt sich demnach ein Verständnis vom methodischen Handeln in der Sozialen Arbeit betonen, das jene Aspekte im Rahmen sozialpädagogischer Arbeit hervorhebt, die auf eine planvolle und nachvollziehbare Gestaltung von Praxis zielen. Kern der so verstandenen methodischen Kompetenz ist die Fähigkeit, Praxissituationen in ihrer Komplexität wahrnehmen zu können, sie zu beschreiben und sich (wissensbasiert und theoretisch fundiert) in Zusammenhänge und Bedingungsgefüge einzudenken – als Voraussetzung für die einzelfallorientierte Gestaltung von Lernräumen und Entwicklungsmöglichkeiten. Methodisches Handeln muss sich dabei am Kriterium der Alltagsnähe messen lassen (Soziale Arbeit ist alltagsorientiert) und der generellen situativen Offenheit sozialpädagogischen Handelns eine professionell inszenierte ‚strukturierte Offenheit‘ (Thiersch 1993) entgegenhalten.
Neben diese Offenheit treten Paradoxien des methodischen Handelns, die Winkler (1999, 1115 ff.) wie folgt beschreibt und damit auch die vorstehende Grundannahme unterstreicht:
◼ Die Einheit der Methode besteht in der Vielperspektivität: Es gibt nicht ‚die eine‘ gültige Sichtweise und Perspektive, die in Handlungsfeldern oder -situationen zum Einsatz kommen kann, stattdessen verlangt die Offenheit pädagogischer Situationen multiperspektivische Zugänge und die Berücksichtigung von Einsichten durch Analyse und reflexive Fallarbeit.
◼ Nicht das Erzielen einer bestimmten Wirkung, sondern das Gestalten von Lern- und Erfahrungsräumen steht im Vordergrund: womit die Handlungsfähigkeit aller Beteiligten sichergestellt werden soll, Handlungs- und Lernpotenziale gefördert und aktiviert werden sollen, mithin Bildungs- und Subjektivierungsprozesse in pädagogischen Interaktionen.
◼ Methodisches Handeln beginnt vor diesem selbst: Denn hierfür ist die Bereitstellung eines pädagogischen Ortes notwendig, in dem den Aktivitäten auch eine Form gegeben werden kann, methodisches Handeln eine Grundlage erhält.