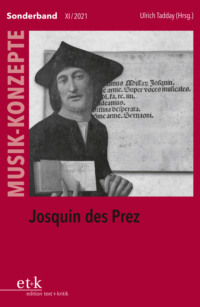Kitabı oku: «MUSIK-KONZEPTE Sonderband - Josquin des Prez», sayfa 4
LAURENZ LÜTTEKEN
Musarum decus?
Josquins Wirklichkeiten und die Wirklichkeit Josquins
I
In der Allgemeinen Musikalischen Zeitung erschien 1837 die spöttische Rezension einer im Jahr zuvor in der Revue et Gazette Musicale gedruckten Novelle.1 Sie trägt den Titel La vieillesse de Guillaume Dufay. Der Rezensent fasst die für ihn absurde Handlung kurz zusammen: Die Geschichte spiele im März 1465, »in einer schönen Julinacht am Quai des Ormes zu Paris«. Als die nach dem Tod ihres Mannes und ihres Kindes wahnsinnig gewordene Protagonistin Helene, Geliebte von Dufays Schüler Josquin und im Hause Dufays lebend, in ihrer Verzweiflung zu singen beginnt, hört der alternde Komponist ihr zu:
»Dufay erstaunt über den Gesang, denn er wurde gewahr, dass er bei der Wiederholung sehr verschieden wurde, doch so, dass beide Weisen zusammenpassten. Natürlich theilt er diese seltsame Erscheinung seinem lieben Josquin mit. Beide sind höchst begierig und begeben sich zur Kranken. Sie singt; die Veränderungen der Melodie lassen sich abermals hören; vor Lust sind beide Meister ganz der Erde enthoben, vergessen die Kranke und alles um sich her, und in der Entzückung stimmen Beide zugleich laut und frisch den Doppelgesang an, von dessen Wirkung selbst die Kranke und Marion wundersam ergriffen werden. Die begeisterten Meister aber stürzen einander selig in die Arme, denn ›in demselben Augenblicke war der Contrapunkt entdeckt.‹ (Le contrepoint venait d’étre découvert!).«2
Autor der Novelle ist der Musikkritiker Jean Baptiste Nicolas Madeleine (1801–1868), der unter dem Pseudonym Stéphen de la Madeleine gesangspädagogische Schriften veröffentlichte, aber auch eine stattliche Zahl von historischen Erinnerungen und Erzählungen. Durch die deutsche Zusammenfassung erregte La vieillesse de Guillaume Dufay offenbar ein gewisses Aufsehen, der Text wurde noch von Franz Xaver Haberl 1885 in seiner Dufay-Monografie als Kuriosum, als »Abschweifung« zitiert.3 Es ist einigermaßen unklar, woher Madeleine seine Anregungen tatsächlich bezog, wahrscheinlich aber aus dem umfangreicheren Josquin-Aufsatz, den François-Joseph Fétis 1834 in seiner Revue Musicale herausgebracht hatte.4 Etwas später, im Jahr 1837, erschien noch Madeleines Novelle Les Psaumes de Josquin, in der die vom Kontrapunkt genesene Helene als Ehefrau des Komponisten wieder begegnet – und in der als weitere Quelle die in Glareans Dodekachordon überlieferten Anekdoten aufscheinen.5 Bemerkenswert an La vieillesse de Guillaume Dufay sind jedoch, unabhängig vom vollständig fiktiven Charakter der Geschichte, zwei Aspekte: Josquin und Dufay werden als Entdecker des Kontrapunkts gefeiert, also einer Satztechnik, die gleichsam in der Materie der Musik liegt und erst aufgefunden werden musste; zudem ist die Entdeckung dieses musikalischen Wunders, getreu einer romantischen Idee von Entgrenzung, auf eine verwickelte Weise an den Bewusstseinsverlust gebunden. Und doch, dies die seltsame Pointe der Erzählung, heilt die durch den Wahnsinn hervorgerufene Entdeckung am Ende sogar diesen, die geheime Protagonistin wird also wieder gesund.
Josquin des Prez galt im 19. Jahrhundert als »vielleicht der grösste, jedenfalls der bewundertste Contrapunktist der vorpalestrina’schen Zeit«.6 Die Verknüpfung seines Namens mit dem Kontrapunkt war jedoch keineswegs eine Erfindung des historistischen Zeitalters. Gute 100 Jahre früher zeigt sich dieselbe Verbindung auch bei Johann Mattheson, für den Josquin aber nicht der Erfinder des Kontrapunkts war, sondern derjenige, der ihn auf schreckliche Abwege gebracht habe. In seiner Critica Musica von 1722 hielt er fest, dass Obrecht, Ockeghem und insbesondere »Josquinus die harmonis.[che] Künsteley per Fugas ad Canones (i. e. extrema) getrieben/ und die sonst/ lange Zeit zuvor/ in den Moteten frey einhergegangene Fugen mit Ketten und Banden/ in seinen Missen/ beleget hat«.7 Immerhin teilte Mattheson dabei mit, dass er zum Beweis seiner Behauptung reichlich Material gesammelt habe, dies aber jetzt nicht weiter ausführen könne. Ob und welcher Art diese Belege waren, lässt sich daher höchstens vermuten.
II
Josquin ist wohl der erste Komponist der Musikgeschichte, der seit seinen Lebzeiten über eine durchgängige, ununterbrochene Rezeptionsgeschichte verfügt. Das betrifft nicht allein die komplexe und vielschichtige Wahrnehmung im 16. Jahrhundert,8 sondern reicht weit darüber hinaus. Auch im Schrifttum des 17. und 18. Jahrhunderts war der Musiker auf eine ganz erstaunliche Weise präsent.9 Es scheint jedoch so, dass sich im Laufe des 17. Jahrhunderts diese Wahrnehmung auf wenige Stereotypen beschränkt hat, für die Glareans Dodekachordon ebenso einen Bezugspunkt bildete wie, wenigstens im reformatorischen Kontext, Luthers Josquin-Apologie. Als Wolfgang Caspar Printz den Komponisten, der sich »unsterblichen Ruhm/ durch seine Musicalische Wissenschafft/ und fürtrefliche Composition erworben« habe, noch 1690 rühmte, berief er sich ausdrücklich auf Luther, zweifellos dürfte eine Quelle aber zugleich Glarean gewesen sein.10 Ob er dabei wenigstens die bei Glarean abgedruckten Beispiele tatsächlich noch kannte, ist aber eher unwahrscheinlich.
Irgendwann scheint also das topische Lob für Josquin nicht mehr mit einer genaueren Kenntnis von wenigstens einigen seiner Werke verbunden gewesen zu sein, ein Sachverhalt, der sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts allmählich wieder verändert hat – und dann zum neuen Stereotyp des ›Contrapunktisten‹ führte. Eine gewisse Scharnierstelle in diesem Prozess bildete wohl das Werk des Historiografen und Agenten der katholischen Reform Petrus Opmeer (1526–1594). Sein Projekt einer Weltgeschichte, das unvollendet blieb und vom katholischen Theologen Laurentius Beyerlinck (1578–1627) fertiggestellt wurde, erschien erst 1611 und gehört v. a. deswegen zur ›kanonischen‹ Josquin-Literatur, weil der Komponist dort, als einziger der erwähnten Musiker, einen eigenen Eintrag erhielt. Dieser wurde zudem mit einem Porträt versehen, das, obwohl eindeutig apokryph, zumindest in der Neuzeit eine bemerkenswerte Verbreitung gefunden hat, eben weil es das einzige Bildnis ist, das sich überhaupt explizit mit Josquin in Zusammenhang bringen lässt.11 Weitaus interessanter ist jedoch der universalhistorische Kontext, in den der Komponist bei Opmeer gestellt wird. In einem kurzen Musikkapitel erläutert der Verfasser nämlich, dass Hermannus Contractus für den einstimmigen Choral (»inter Phonascos«) dasselbe sei wie Josquin für die mehrstimmige Musik (»inter Symphonetas«).12 Es heißt bei Opmeer, dass sein eigenes Jahrhundert (»nostrum seculum«) zwar herausragende »Symphonetas« aufweise (genannt werden u. a. Lasso,13 Clemens non Papa, Morales oder Obrecht), doch sei Josquin eben der Begründer der Mehrstimmigkeit und damit zweifellos der Wichtigste, er sei daher der »Archisymphoneta«.14 Bei Opmeer stehen sich demnach Ein- und Mehrstimmigkeit gegenüber, beide verfügen über zentrale, geradezu mythische Gründerfiguren, weswegen Hermannus Contractus und Josquin auch die einzigen sind, die in seinem Buch mit dem Ehrentitel des »Musicus praestantissimus« (des unübertrefflichen Musikgelehrten) bedacht wurden.
Bei einer solchen Konstruktion bedurfte es einer genauen Vorstellung der damit verbundenen Musik gar nicht mehr. ›Der‹ Choral und ›die‹ Mehrstimmigkeit ließen sich auf archetypische Gestalten zurückführen, auf ›Erfinder‹. Josquin war damit zu einer bloßen Chiffre geworden – für die mehrstimmige Musik an sich. In Opmeers Verkürzung löst sich damit eine ganz erstaunliche Gemengelage von Wahrnehmungsmustern des 16. Jahrhunderts, einsetzend mit Josquins Tod, gleichsam auf. Michael Meyer hat diese Wahrnehmungsmuster mit den Schlagworten von Kanonisierung, Heroisierung, Rhetorisierung und Historisierung zu systematisieren versucht.15 In der Figur des »Archisymphoneta« waren diese Muster ebenso synthetisiert wie aufgehoben.
Da die von Meyer beschriebenen Prozesse allenfalls in Josquins letzten Lebensjahren, massiv aber erst nach seinem Tod einsetzten, stellt sich die Frage, ob sich unter diesem Geflecht unterschiedlichster Wirklichkeiten auch eine historische Schicht verbirgt, die man, in notdürftiger Terminologie, als die Wirklichkeit Josquins bezeichnen könnte. Es geht, banal nur auf der Oberfläche, um die Frage, ob und wie man eigentlich zur Wahrnehmung des Komponisten ›davor‹ zurückgelangen könnte. Es scheint schon auf den ersten Blick so, dass die Wirklichkeit Josquins vergleichsweise weit entfernt von den nachträglichen Inanspruchnahmen war, auch von den zahlreichen philologischen Problemen, die sich damit verbinden und welche die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Komponisten bis in die Gegenwart des 21. Jahrhunderts prägen. So sehr also die Frage nach dem ›authentischen‹ Josquin in den Vordergrund rückte, so unnahbar wurde die Figur selbst.
III
Josquin war zu Lebzeiten, und dies schon als junger Mann, ein ungewöhnlich berühmter Komponist. So unzweifelhaft dieser Ruhm bereits um 1500 war, so fraglich ist doch, was man mit ihm verband. Dabei scheinen sich jedoch ganz andere, vielleicht sogar überraschende Parameter der Wahrnehmung abzuzeichnen, Parameter, die zu der späteren Hervorhebung des Kontrapunkts in einem scharfen Kontrast stehen. Der Dichter Gerhard Geldenhauer (1482–1542) schrieb auf den Tod des Komponisten eine Klage, die von Benedictus Appenzeller und Nicolas Gombert vertont wurde, wohl doch in einigem Abstand zum Ereignis selbst. Das Gedicht seinerseits hat zwar eine komplizierte Überlieferungsgeschichte, verbunden mit einer kleinen Unsicherheit bei der Autorschaftsfrage, doch wird Josquin dort als »musarum decus«, als Zierde der Musen bezeichnet, der Apollo jedoch nicht etwa durch Kontrapunkt beeindruckt habe, sondern durch das Singen eines süßen Liedes.16 Diese Betonung des ›Süßen‹, der ›dulcedo‹ lässt sich als »Eindringen und Besetzen des Innersten unseres Selbst« bezeichnen, als »Invasionsakt durch die ästhetische Form […] und den intelligiblen Gehalt«,17 mithin also als einen genuin neuzeitlichen Vorgang, der von der Idee einer Gründungsurkunde ebenso weit entfernt ist wie von der Vorstellung konstruktiver Artistik.
Will man solche Spuren weiterverfolgen, stößt man auf die zahlreichen Probleme, die sich im Blick auf Josquins Vita ergeben – schon wegen der Häufigkeit des Namens. Die Zeit in Italien (von 1484 bis 1504) ist vergleichsweise gut dokumentiert, die langen, gut situierten Jahre in Condé sind in vielem ungewiss und rätselhaft, auch im Blick auf musikalische Tätigkeiten und musikalische Produktivität. Die Fragen um den frühen Werdegang sind nach wie vor von zahlreichen Unsicherheiten überschattet. Dessen ungeachtet existieren hinsichtlich der Wahrnehmung und Wirklichkeit Josquins dennoch bemerkenswerte Zeugnisse. Der Dichter Serafino de’ Ciminelli dell’Aquila (1466–1500) befand sich ab 1484, gemeinsam mit Josquin, im Dienst des Kardinals Ascanio Sforza in Rom. Er begleitete sich selbst beim Gesang von Petrarca-Gedichten auf der Laute und schrieb zu Ehren des Musikers ein Sonett, in dem sein »sublime ingenio« gepriesen wird, auch seine Tugend (»virtù«). Die wechselseitige Bedingung von tugendhafter »humilitas« und Größe, »sublimitas«, zeichnen nach Marsilio Ficino die Größe eines Menschen aus, und darauf scheint sich auch Serafino zu beziehen, indem er Josquin als jemanden charakterisiert, der auf seine Weise, »a suo modo« durch die Welt ziehe.18
Immer wieder ist in der Forschung auf die erstaunlich gezielte Anwerbung Josquins für den Hof in Ferrara hingewiesen worden.19 Dieser Vorgang ist zweifellos außergewöhnlich, weil er einen wenigstens reduzierten Einblick in musikmäzenatische Entscheidungen um 1500 gewährt – denn jede Entscheidung für eine Person war stets eine gegen eine oder mehrere andere. Greifbar werden in den Rekrutierungsbemühungen die hohen finanziellen Vorstellungen Josquins, also ein sich materialiter abbildendes Selbstbewusstsein, sowie die Eigenart, die teuer verkaufte Leistung keineswegs auch selbstverständlich zu erbringen. Im Rahmen der Werbungen wurde vom Agenten Gian de Artiganova zugleich festgestellt, dass Josquin ›besser‹ komponiere als Isaac – doch gibt es keinen ausdrücklichen Referenzrahmen, worauf sich diese Einschätzung bezieht.20 ›Besser‹ kann die »suavitas« des Gesangs meinen oder die »sublimitas«, Fragen von Angemessenheit und Vielfalt, wohl kaum allerdings die vordergründige Beherrschung des Tonsatzes. Immerhin bestand eine klare Vorstellung von dem, was besser oder schlechter sei, es gab also einen ästhetischen Vergleich und ein ästhetisches Urteil. Einen solchen Vergleich stellt auch der apostolische Sekretär Paolo Cortesi (1471–1510) 1510 an, der in seiner Schrift über den ›wahren‹ Kardinal auch eine Passage zur Musik eingefügt hat. Dort vergleicht er Josquin, Obrecht und Isaac, bevor er zu einigen anderen Zeitgenossen übergeht. Der Ruhm gebühre aber zweifellos »Iusquinum Gallum«, der »praestitisse«, also vor allen ausgezeichnet sei. Der Grund dafür sei ›doctrina‹, was vielleicht am ehesten als ›vorbildliche Übereinstimmung von Norm und Form‹ verstanden werden könnte.21
Aus diesen wenigen Hinweisen werden wenigstens Indizien erkennbar, welche Parameter für eine vage Rekonstruktion der Wirklichkeit Josquins in Anschlag zu bringen sein könnten. Im Folgenden soll daher versucht werden, dies an drei, zweifellos kursorisch und schlagwortartig diskutierten, Beispielen zu tun. Es soll dabei bewusst versucht werden, denkbare historische Wahrnehmungsmuster in den Vordergrund zu rücken. Um wenigstens eine gewisse Systematik walten zu lassen, repräsentieren die folgenden Beispiele drei unterschiedliche Ebenen: die der Gattung, des einzelnen Werkes und der Überlieferung.
IV
Josquin hat alle drei der von Johannes Tinctoris für die Polyphonie sanktionierten Gattungen komponiert, Messe, Motette und Chanson. Die weltlichen Lieder scheinen aber, zumindest wenn man der Dichte der Überlieferung (und Zahl der Werke) folgt, bei ihm eine geringere Rolle gespielt zu haben.22 In einer offenkundig späten Gruppe von Stücken (unter denen es überdies nur eine kleine Zahl von fragwürdigen Zuschreibungen gibt) ist der Komponist zur Fünf- oder sogar Sechsstimmigkeit übergegangen, zumindest für die Zeit um 1500 alles andere als eine Norm. Unter dem knappen Dutzend der erhaltenen (und in der Authentizität nicht angezweifelten) fünfstimmigen Lieder weisen fast alle Kanontechniken auf, einige sogar in strikter Form. Das steht dem Habitus einer ›Poetisierung‹ vordergründig entgegen, erst recht den Tendenzen zu einer an die Metrik angelehnten ›Textdarstellung‹, die das Lied nach 1500 bestimmen sollte.
Die kanonischen Techniken, die an den Motettensatz erinnern (aber eben auch nur erinnern), verleihen gerade diesen Stücken etwas ungemein Kompaktes. Der charakteristische Wechsel von Gegensätzen (etwa Zwei- gegen Vollstimmigkeit) verschwimmt dabei. Es verschwimmen aber zugleich auch die Textgrenzen, da der dichte Satz zumindest eine vordergründige ›Darstellung‹ des Textes nicht nur nicht erlaubt, sondern geradezu ausschließt. Damit verschwimmen aber zusätzlich die Satznormen selbst. Ein Werk wie Plusieurs regretz, ein ernstes Trauerstück, hebt an mit einem doppelten (und gewissermaßen gegenläufigen) Kanon von Superius und Tenor gegen Altus und Bassus. Dazwischen schiebt sich eine fünfte Stimme eine ›quinta pars‹. Dies prägt den ersten musikalischen Teil, der dann mit dem nächsten Textvers wiederholt wird. Diese Doppelstruktur bleibt in den folgenden Teilen erhalten, allerdings wird, wegen der nur fünf Textverse, im sechsten Teil neben der Musik auch der Text wiederholt. Der strenge Kontrapunkt weicht jedoch einem ›ungefähren‹ in den Teilen drei und vier (nun zwischen Superius und ›quinta pars‹), findet aber dann wieder zu einem strengeren zurück (zwischen ›quinta pars‹ und Tenor).23 Die satztechnische Pointe dieses Verfahrens liegt dann zugleich darin, dass eine tatsächlich polyphone Fünfstimmigkeit nur in wenigen Momenten des Werkes überhaupt erreicht wird – ohne dass allerdings das Pausieren einer Stimme struktur- oder formbildende Folgen hätte.
Es geht in einer solchen Konstruktion des ›Verschwimmens‹ anscheinend nicht um ein analoges, sondern bewusst distantes Verhältnis zum Text, dessen formale Zäsuren (also v. a. die Verse) lediglich das Raster bilden für einen kompositorischen Verlauf, der gerade nicht auf Entsprechung zielt. Der Ernst des Textes gibt dabei zwar die Tonlage vor, der ›Inhalt‹ des Stückes definiert sich jedoch auf eine andere Weise. Im Text werden die allgemeinen Schmerzen in der Welt in ein komparatives Verhältnis gesetzt zur Einzigartigkeit der subjektiven Erfahrung, die, da eben unvergleichlich, zu einer finalen Orientierungslosigkeit führt. In der Musik Josquins findet dies eine Entsprechung, das satztechnische Schwanken steht in einem eigenwilligen Spannungsverhältnis zur vordergründig festen kanonischen Struktur.
Der hier erkennbare Wille, satztechnische (also v. a. kanonische) Gegebenheiten auf komplexe Weise zum Spiegel einer poetischen Kernaussage zu machen, prägt die Gruppe der fünfstimmigen Chansons des Komponisten insgesamt (und in vergleichbarer Weise auch die der sechsstimmigen). Die äußere Faktur ist dabei immer ähnlich und vergleichbar, Differenz und Varianz ergeben sich allerdings im Begründungszusammenhang selbst: Er ändert sich von Werk zu Werk. Man könnte banal sagen: Ein äußerlich vergleichbares Resultat wird im Inneren jeweils ganz anders legitimiert. Hier vollzieht sich demnach, in der oberflächlich so deutlich auf den Text verpflichteten Gattung des weltlichen Liedes, ein Abschied von den Kategorien vordergründiger Nachahmung. Klaus Krüger hat für die Zeit um 1500 einen Wandel festgestellt, in dem die vorhandene Dignität eines Gegenstandes zu einer unmittelbaren »ästhetischen Geltungskategorie« werde, in der das Sinnliche also nicht mehr akzidentell sei, sondern zum substanziellen Kern werde.24 Dieses Vordringen zum substanziellen Kern der Musik prägt die Gruppe der groß besetzten Josquin-Chansons. Die konstruktive Dichte des immer wieder neu begründeten Verfahrens steht aber gerade nicht im Gegensatz zur ›Süße‹ des Gesangs, sondern macht diese auf eine neue und ganz unerhörte Weise erfahrbar, im Sinne eines ästhetischen Eigenwertes. So wie Josquin in seiner Totenklage auf Ockeghem (einem ebenfalls fünfstimmigen Stück) die Fähigkeit der Musik zur ›memoria‹ thematisiert hat, so ist es hier deren Fähigkeit zu einer neuartigen, zu einer unmittelbaren ästhetischen Evidenz. Diese geht nicht einher mit einem Verlust von Kunstfertigkeit, sondern mit deren unerhörter Steigerung.
V
Eine zentrale Frage für das 15. Jahrhundert war das Verhältnis zur Antike, die sich auf die verschiedenste Weise und in einer denkbar großen Vielfalt beantworten ließ – nur nicht in der Musik, da es keine Musik aus dem Altertum gab, auf die man sich dabei produktiv hätte beziehen können. Offenbar entstand aber der Gedanke, eine Klärung wenigstens auf indirektem Wege herbeiführen zu können, durch die Vertonung von antiken Texten. Während der Rückgriff auf solche Texte im 15. Jahrhundert praktisch keine Rolle spielte, mehren sich um 1500 die Anzeichen zu einer verstärkten musikalischen Auseinandersetzung – wenn auch in offenbar gezielt herbeigeführten Einzelfällen. So vertonte Heinrich Isaac 1492 im Andenken an seinen Gönner Lorenzo de’ Medici einen Seneca-Text (Quis dabit pacem populo timenti). Oder es gibt die Versuche, in der Odenkomposition, wesentlich ausgehend von der Sammlung des Petrus Tritonis (1507), den weitgehend homophonen Satz auf die antiken Versmaße zurückzuführen.
Aus derselben Zeit stammt aber auch eine Gruppe von acht Werken, in denen ein ganz anderer Weg gesucht wird. Die Zusammengehörigkeit dieser Gruppe, die wohl an den Hof der Isabella d’Este gehört, wird wenigstens in Teilen der Überlieferung nahegelegt, und trotz der gewissen Unsicherheiten um die Zuschreibungen kommt dem Beitrag von Josquin dabei eine besondere Rolle zu. Im Mittelpunkt steht ein Ausschnitt aus der Klage der verlassenen Dido (Dulces exuviae) aus dem vierten Buch der Metamorphosen des Ovid (IV, 651–654). Es ist ein Schlüsselmoment der Episode, denn es geht um Didos Entschluss zum Selbstmord.25 Josquins Vertonung ist außergewöhnlich, es handelt sich um eine cantus-firmus-lose vierstimmige Komposition, die formal, satztechnisch und tonal experimentell wirkt – allerdings ohne den normativen Rahmen des vierstimmigen polyphonen Satzes infrage zu stellen, im Gegenteil. Der Satz unterscheidet sich nicht von dem einer Motette.26
Das musikalische Verhältnis zur antiken Vorlage, das hier gesucht wird, ist also gerade nicht das einer strukturellen Anpassung – wie es die Tritonius-Oden auszeichnet. Im Gegenteil, auf den ersten Blick wirkt es sogar so, dass im musikalischen Satz jeglicher Bezug zur Antike vorsätzlich gemieden wird. Auch in diesem Fall steht folglich, wie bei den groß besetzten Liedern, kein nachahmendes, sondern ein distantes Verhältnis zum Text im Vordergrund, offenbar allerdings in einem abweichenden Begründungszusammenhang. Es geht, anders als in den Liedern, nicht um musikalisch-poetische Evidenz durch die Erzeugung eines ästhetischen Eigenwertes, sondern um die musikalische ›Beschreibung‹ eines antiken Textes. In einem solchen Verfahren wird der historische Abstand also gerade nicht aufgehoben, sondern willentlich betont. Die Klage der Dido wird mit jenen kompositorischen Mitteln dargestellt, welche die Zeit um 1500 bereithielt, sie wird ›beschrieben‹.
In der antiken Rhetorik wurde eine solche Beschreibung als ›ekphrasis‹ oder ›descriptio‹ bezeichnet. Damit sollten v. a. abwesende Bildwerke anschaulich vermittelt werden, der Zuhörer sollte sich folglich in einen Zuschauer verwandeln. In der Kunsttheorie des 15. Jahrhunderts wurde die ›ekphrasis‹ zu einem wichtigen Moment, um gewissermaßen ästhetische Präsenz erst erzeugen und vermitteln zu können.27 Durch das Verfahren in Dulces exuviae partizipiert damit auch die Musik an der Möglichkeit zu einer solchen Präsenz, aber auf eine unerwartete Weise. Ein Vergleich mag das veranschaulichen: Um 1495 malte Sandro Botticelli seine Verleumdung des Apelles, eine komplexe Auseinandersetzung mit dem Problem, dessen erste Schicht die Übertragung einer Beschreibung Lukians in die optische Wirklichkeit um 1500 bildete.28 Josquins Musikalisierung eines antiken Textes steht einer solchen Engführung nahe. Im Gemälde Botticellis wird die antike Beschreibung mit den visuellen Mitteln der Gegenwart erfahrbar gemacht, in Dulces exuviae sind es die kompositorischen Mittel. In beiden Fällen verschwimmen die Grenzen, nämlich in der Frage, was denn nun eigentlich der ›Gegenstand‹ und was seine ›Beschreibung‹ ist. Jedoch ›verschwindet‹ bei Botticelli der Text, auf den sich der Maler bezieht, während er durch Josquins Komposition erst wirklich zur Geltung kommen soll. Es geht eben nicht um einen Text, der selbst ›ekphrasis‹ ist, sondern um einen, der die Auffassung auslöst, Musik könne ›ekphrasis‹ sein.
Josquins ›ekphrasis‹ richtet sich auf das Verhältnis zur Antike, um sie mit den Mitteln der Gegenwart erfahrbar zu machen. Anders als in den Oden geht es nicht um eine bloße Nachahmung oder Wiederentdeckung, sondern, hierin Botticelli (und anderen) wenigstens vergleichbar, um eine Klärung im Sinne eines ästhetischen Eigenwertes. Die Musik der Gegenwart vermag damit auf eine Weise zu wirken, die derjenigen der Antike nicht nur vergleichbar, sondern ihr wohl auch überlegen ist. Gerade eine solche grundsätzliche Klärung verstärkt den Charakter des Experiments, denn sie richtet sich auf das Außergewöhnliche, auf einen Ausnahmezustand gewissermaßen. Daraus erklärt sich die Textwahl, gebunden an die affektive Extremsituation der zum Suizid entschlossenen Dido. Akzeptiert man diese Deutung, handelt es sich bei einer solchen Ovid-Vertonung zwar um einen isolierten Einzelfall, aber mit dem Anspruch einer paradigmatischen Klärung. Dies könnte dann auch erklären, warum daraus, wiederum im Gegensatz zu den Oden, kein funktionierender Gattungszusammenhang (etwa vierstimmiger Sätze über antike Texte) erwachsen sollte. Die vollkommen neue Art, über das musikalische Verhältnis zur Antike nachzudenken, sollte dennoch Konsequenzen haben für das Verständnis aller Musik.29