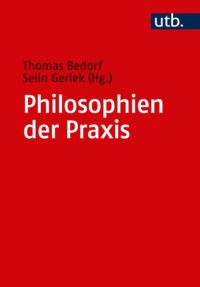Kitabı oku: «Philosophien der Praxis», sayfa 7
|48|3. Praxis als „Aktivität des Geistes“
Wie kann man unsere menschlichen Angelegenheiten, unser Tun und Handeln, begreifen, wenn man immer schon in Praxis verstrickt ist? Hegel meint, dass die naheliegenden skeptischen und relativistischen Gefahren verschwinden, wenn man das scheinbare Rätsel als den sachlichen Kern versteht. Die anleitende Problemformulierung ist dann: Wie versteht man, dass der Geist im Anderen seiner selbst „bei sich ist“, also sein eigenes Tätigsein begreift?
Hegels Vorschlag, die Form und die Ansprüche der Vernunft als derart situiert zu begreifen, verdankt sich einem skeptischen Problem der zeitgenössischen Reflexionsphilosophie: Ist die Idee eines objektiven Gegenstandsbezugs des Denkens einmal fraglich geworden, dann lässt sich diese Irritation durch keine „dogmatische“ Metaphysik mehr reparieren. Das war Kants Entdeckung: Es reicht nicht, das Bestehen solchen Gegenstandsbezugs unter Voraussetzung einer vermeintlich wohlbestimmt vorgegebenen Objektivität (der Objekte des sinnlichen und des noumenalen Erkennens ebenso wie der Normen des Handelns) einfach zu behaupten; seine Möglichkeit lässt sich nur mehr aus der Form der subjektiven vernünftigen Fähigkeit selbst begründen. Denkt man über das Denken nach, dann muss sich dabei auch die Möglichkeit seines Vernünftigseins zeigen lassen – andernfalls wäre die Vorstellung, man dächte, unsinnig. Die Kritische Philosophie entwickelt so das transzendentale erkenntnistheoretische Argument, dass für ein vernünftiges Subjekt ein objektiver Gegenstandsbezug notwendig möglich ist (sofern es sich eingedenk seiner Endlichkeit amphibolischer Selbstüberhebung enthält), und dass ein vernünftiges Subjekt durch Einsicht in die Form seines Wollens bereits über das Prinzip sittlichen Handelns verfügt, nämlich die Idee der reinen (und damit allgemeinen, transsubjektiven) Selbstbestimmung subjektiven Wollens überhaupt.
Kants Modell der Spontaneität der Verstandestätigkeit macht zwar verständlich, wie gelingender Sachbezug möglich ist; es erklärt aber nicht, ob er, wenn er wirklich besteht, vernünftig gestiftet ist, oder nur beiläufig besteht. Dafür müsste man die Spontaneität der Verstandestätigkeit als eine echte, den Sachbezug produktiv stiftende Aktivität verstehen; und der Grund und die Quelle dieser Aktivität kann nur Subjektivität im Allgemeinen sein. Das meinen Fichte und Schelling (und streiten über die Ausgestaltung solcher Subjektivität – individualistisch bei Fichte, überindividuell bei Schelling). Hegel übernimmt als aufregendsten zeitgenössischen Vorschlag diese Vorstellung, das Denken (und damit unser ganzes menschliches Tätigsein) als eine für die menschliche Welt konstitutive Aktivität aufzufassen. Weil die zeitgenössische Diskussion diese Auffassung stets im Bild der erkenntnistheoretischen Subjekt-Objekt-Beziehung entwickelte, lag es nahe, eine solche konstitutive Aktivität allgemein dem Subjekt zuzuschreiben. Deshalb interessiert sich Hegel so für die Grammatik des Ausdrucks „leben“: „Leben“ ist das Urbild einer Tätigkeit, die ihren Ursprung und ihre Norm in sich selbst hat, und sich durch ihren Vollzug selbst erhält und reproduziert. Auch hier ist umstritten, wie wörtlich man Hegels Erläuterung des Lebendigen als Form des Geistes verstehen darf (vgl. bejahend Riedel 1965, Kap. III, und vorsichtiger Pinkard 2012). Versteht man sie nicht wörtlich, dann beschreibt „Leben“ analogisch den subjektiven Modus geistiger Vollzüge und die Art und Weise, in der wir im geistigen Tun mit den unverfügbaren Voraussetzungen unseres Tuns – der Natur – umgehen (vgl. Menke 2005 und Khurana 2017, v.a. Kap. IV.).
|49|3.1. Konstitutionstheorie oder Formreflexion: Wie lässt sich die „Wirklichkeit der Vernunft“ verstehen?
Auf den ersten Blick führt die Frage, wie man „den Geist“ als „bei sich im Anderen“ versteht, direkt in eine Sackgasse. Man kann unsere menschlichen Angelegenheiten nicht einfach auf eine subjektive Konstitution zurückführen. Man müsste sich dann die Normen, an denen sich die Güte subjektiver Aktivität vernünftigerweise beurteilen lassen muss, als von derselben Aktivität konstituiert vorstellen, die sie bemessen – so würden vernünftiger Vollzug und eitle Selbstermächtigung ununterscheidbar. Die geistphilosophische Umformulierung ändert an dieser Folgerung scheinbar nichts: Zwar bezieht sich der Ausdruck „Geist“ nicht mehr (einfach und nur) auf individuelle „Subjekte“, sondern ist ein sachliches Scharnier zwischen der Rede über „je mein“ geistiges Tun, und der Rede über überindividuelle „soziale“ Vollzügen aus einer generischen „Wir“-Perspektive (vgl. exempl. Stekeler-Weithofer 2005, 48f.). So ermächtigt sich aber lediglich ein anderes, höherstufig-generisches eitles Subjekt selbst – nämlich „das geistige Tätigsein“, das beständig seine eigene Praxis schafft. Man hätte zwar die Vernunft situiert (im Verhältnis zwischen individuellen Vollzügen und den normativen Institutionen), alle vernünftigen Geltungsansprüche aber relativiert. Denn die Normen, unter denen unsere individuellen geistigen Vollzüge „besser“ und „schlechter“ sind, wären nach diesem Bild das Produkt der gemeinsamen Praxis: bloße Konventionen, deren „Geltung“ in ihrer Genese gründete.
Diese Konsequenz ergibt sich aus einer Lesart der hegelschen Situierung der Vernunft, die verlockend, aber weder notwendig noch (letztlich) überzeugend ist. Man kann sie konstitutionstheoretisch nennen: Sie versteht Hegels Modell der „Aktivität des Geistes“ als Antwort auf die Frage, wie die Vernünftigkeit unserer Vollzüge zustandekommt. Diese Frage nach dem Zustandekommen vernünftiger Vollzüge ist aber nicht dieselbe wie die nach der Form, in der sie wirklich sind (nach ihrer „Seinsweise“).
Diese konstitutionstheoretische Lesart Hegels erklärt seine Attraktivität für moderne Praxistheorien. Sie beschreibt Vernunft – ihre Gestalt, ihre interne Normativität, ihren Zusammenhang – als das Produkt sozialer Praktiken, und erklärt die Konstitution begrifflicher Gehalte wie die Konstitution praktischer Gründe, indem sie die sozialen Praktiken rekonstruiert, die ihre notwendigen und hinreichenden Bedingungen sind; und sie erklärt die normative Gestalt dieser Praktiken, indem sie sie als durch die individuellen Vollzüge bedingt versteht, aus denen die Praktiken fortwährend hervorgehen (vgl. exemplarisch Pippin 2008 und 2010). Diese Beschreibung der „Performativität“ von Praxis (s. Volbers 2014, Kap. 3.4) macht klar, dass das Mitwirken anderer Subjekte eine Bedingung für das Gelingen subjektiver Vollzüge ist; sie erklärt, wie die Ansprüche einer situierten Vernunft uns nicht wie „von außen“ betreffen, sondern dadurch, dass sie in dieser Praxis eine Rolle spielen, die ihrerseits durch „unser“ Tun und Handeln bewirkt |50|ist. Es wäre sinnlos, von der Vernunft und ihren Ansprüchen unabhängig von dieser sozialen und geschichtlichen Situiertheit zu reden.
Damit erbt die konstitutionstheoretische Lesart als Variante des hergebrachten Modells konstitutiver Subjektivität aber auch deren doppeltes Defizit (vgl. Cassirer 1920, 280f.): Erstens entgeht sie dem geltungstheoretischen Zirkel nicht, sondern deutet ihn nur zur „Performativität“ um. Die Idee „vernünftiger Ansprüche“ geht dabei aber entweder im Kollaps in einen relativistischen Historismus verloren, oder muss einen vorkritischen Gegebenheitsdogmatismus reaktivieren. Zweitens macht die konstitutionstheoretische Lesart die neue, durch das „Geist“-Modell ermöglichte Perspektive wieder rückgängig: Sie fragt nicht nach der wirklichen Form unserer geistigen Vollzüge, sondern übersetzt diese Frage in die nach der (faktiven oder logisch bedingenden) Herkunft dieser Wirklichkeit zurück. So zu fragen heißt aber, als Prinzip unserer geistigen Vollzüge eben gerade nicht sie selbst, sondern etwas anderes aufsuchen: das, was sie „konstituiert“ und worauf zurückbezogen sie gedacht werden müssen.
Diese Umformulierung der Frage unterläuft der konstitutionstheoretischen Lesart, weil sie die Radikalität der geistphilosophischen Umstellung unterschätzt. Sie schließt aus (erstens) dem Gedanken, dass die Idee von Vernünftigkeit nicht unabhängig von einer Vorstellung ihrer Wirklichkeit in geistigen Tätigkeiten gefasst werden kann, und (zweitens) der Einsicht, dass die Vorstellung von einer Ausübung geistiger Tätigkeiten allemal an unsere menschlichen Angelegenheiten gebunden bleibt, weil unsere Praxis eben (wirklich und unhintergehbar) das Medium jeder Vorstellung von „Vernunft“ ist, dass (folglich) vernünftige Ansprüche an unser Denken und Handeln als letztlich kontingente, jedenfalls willkürlich veränderliche Produkte unserer Praxis verstanden werden müssten (vgl. Schürmann 2015b, 170ff.). Die Alternative zur Frage nach der Konstitution der Vernunft ist die Frage nach ihrer Form: danach, was die Vernünftigkeit unserer Vollzüge ist. Statt nach den Gelingensbedingungen faktischer, einzelner geistiger Vollzüge wird gefragt, was es überhaupt heißt, geistige Vollzüge als gelungen zu begreifen. Im ersten Fall wird man Bedingungen zu formulieren versuchen, unter denen ein Vollzug φ als mehr oder weniger gelungen beurteilbar ist. Im zweiten Fall wird man „das wirkliche φ-en“ durch die Spannung zwischen der Beschreibung meines subjektiven Vollzugs und der allgemeinen Form des φ-ens. Man wird Vernunft als das Verhältnis von subjektivem und objektivem Geist erläutern, und zwar anläßlich und anhand meines konkreten, situativ eingebetteten und überbestimmten φ-ens.
Konstitutionstheorie und Formreflexion ähneln sich sehr: Beide verstehen die Sozialität der Vernunft als begrifflich an soziale Vollzüge gebunden, und beide verstehen die Normativität der Vernunft also genealogisch bestimmt (vgl. Menke 2005, Khurana 2017). Beide Lesarten schließlich erklären die Konstitution begrifflicher Gehalte im theoretischen wie praktischen Denken „holistisch“, durch nichts anderes als den Bezug auf soziale Praktiken (vgl. Bertram 2002). Sie |51|unterscheiden sich aber darin, womit sie anfangen, und worin sie ihr (geglücktes) Ende erwarten.
Die konstitutionstheoretische Lesart beginnt mit einer Theorie von Praktiken: einer faktiven Beschreibung von Institutionen, auf die sie die Kraft normativer und begrifflicher Ansprüche zurückführt. Die formreflexive Geistphilosophie zielt auf die wesentliche Spannung (das „dialektische Verhältnis“) zwischen dem (unbedingten, zeitenthoben-objektiven) Anspruch theoretischer und praktischer Gründe einerseits, und andererseits dem Umstand, dass solche Ansprüche nur in einer spezifischen (historischen, sozialen, denkerischen) Situation bestehen, indem sie sich an mehr oder weniger vernünftigen Vollzügen exemplifizieren. Ihr glückliches Ende hat solche Formreflexion in dem Gedanken, dass ein subjektiver geistiger Vollzug dann „gut“ ist, wenn er den objektiv repräsentierten Normen des überindividuellen, allgemeinen Tätigseins entspricht, und diese Entsprechung besteht, wenn der Gedanke an die Norm diese Norm selbst objektiv vorstellt und erfüllt. Im geistigen Tun „bei sich im Anderen sein“ heißt, die Form des Gedankens, den man fasst, als Exempel des wirklichen Vollzugs geistigen Tätigseins begreifen.
Hegels geistphilosophische Umformulierung will Tätigkeit in ihrer wirklichen, aktuellen Ausführung begreifen. Sie ist deshalb nicht bloß ein geistesgeschichtlicher Bezugspunkt der auf sie reagierenden materialistischen Positionen (vgl. weiter Schürmann 2017, 126ff.), sondern (jenseits der schiefen, ideologisch dem neuzeitlichen Empirismus verpflichteten Sortierung „idealistischer“ vs. „materialistischer“ Philosophien) auch sachlich das Urbild einer wahren (nämlich einer mit idealistischen Mitteln formulierten) materialistischen Praxisphilosophie (vgl. Holz 2010; Rödl 2007, 14f.). Womit aber fängt diese auf das Begreifen der Form wirklichen geistigen Tätigseins zielende Praxisphilosophie an?
3.2. Wie fängt Praxisphilosophie „unbefangen an“?
Wie fängt man das Nachdenken über wirkliches geistiges Tätigsein an, so dass dabei keine bloß empiristische Beschreibung von Praktiken herauskommt? Hegel schlägt in der methodologischen Vorrede zu den Grundlinien der Philosophie des Rechts vor, den Anfang nicht in einem besonderen Gegenstandsbereich, sondern in einer bestimmten denkerischen Haltung zur Sache zu suchen – nämlich der Haltung des (mit ironischer Absicht so genannten) „unbefangene[n] Bewußtsein[s]“ (Hegel 1821, 25). „Unbefangenheit“ ist keine Haltung inszenierter Naivität (und also auch keine Orientierung an einer angeblichen „alltäglichen Normalität“), sondern die Tugend, sich reflexiv von den sprachlichen und denkerischen Deformationen überkommener Denkmodelle zu befreien. Unbefangen ist klar, dass, „[w]as vernünftig ist, […] wirklich; und was wirklich […] vernünftig“ ist (ausdrücklich nicht als eine Forderung an die Wirklichkeit, sie möge irgendwie „vernünftiger“ werden – dann wäre das Nachdenken „selbst nur Eitelkeit“ –, und auch nicht als eine Forderung an das Nachdenken, sich irgendwie nach einer |52|Wirklichkeit zu richten – dann wäre es bloßes Meinen, für dessen Richtigkeit etwas anderes als es selbst zuständig wäre; s. Hegel 1821, 24f.). „Unbefangen“ anfangen heißt „[d]as was ist zu begreifen“ (Hegel 1821, 26).
Das ist eine formale Selbstverständlichkeit: was als Etwas gedacht wird, ist, insofern es für das begriffliche Denken faßlich ist, „vernünftig“ (andernfalls es nicht denk- und vorstellbar wäre). Und indem man umgekehrt Etwas als das, was es ist, denkt und „begreift“, ist das vernünftige Nachdenken „wirklich“. Der normative Ausdruck „vernünftig“ funktioniert hier attributiv: Wirkliches ist vernünftig, insofern es als das, was es ist, nur im kategorialen Rahmen unseres Denkens thematisiert werden kann. Streng genommen wäre es sinnlos, von „wirklichem Nicht-Vernünftigem“ zu reden. – Man darf den Ausdruck „vernünftig“ dabei nicht nur in einer (etwa: moralisch oder politisch) bewertenden Tonlage hören – so, als wäre etwa eine (unterstellt: fraglos) unvernünftige Praktik deshalb, weil sie wirklich ist, in einem bewertenden Sinn „vernünftig“ und damit irgendwie der Kritik enthoben. Hegels Merksatz kontrastiert „vernünftig“ mit seinem kontradiktorischen Gegensatz „nicht-vernünftig“; der polare, privative Gegensatz „unvernünftig“ spielt seine Rolle im Verhalten zum Vernünftigen. So gehört zum Reden über eine fraglos problematische Praktik dazu, sie als problematisch und insofern unvernünftig anzusprechen; andernfalls hätte man etwas Entscheidendes an ihrer Wirklichkeit verfehlt. Wirklichkeit ist stets mehr oder weniger (un-)vernünftig, aber nie nicht-vernünftig.
„Unbefangen“ sucht man (ohne vorschnelle Verpflichtung auf eine bestimmte, gar terminologische Repräsentation) zu begreifen, was einer Sache wesentlich ist. Die Sache, um die es Hegels Praxisphilosophie geht, sind unsere menschlichen Angelegenheiten: unser geistiges Tätigsein. Tätigsein ist ein Vollzug: es ist, was es ist, im wirklichen Denken, im wirklichen Handeln. So kehrt in Hegels Geistphilosophie genau dasjenige Darstellungsproblem wieder, auf das sie reagierte. Einen wirklichen Vollzug ausdrücken heißt, eine Bewegung in ihrem Fortgang, in ihrem Gerade-dabei-Sein ausdrücken: als Vollziehen, das seinen Ursprung und sein Prinzip in sich selbst hat. Deshalb setzt Praxisphilosophie nicht mehr einfach bei einem „Subjekt“ an, sondern bei dem Verhältnis zwischen subjektivem und objektivem Geist. Man kann einen Vollzug nur in zwei spiegelbildlichen Perspektiven ausdrücken, die jeweils das, was sie mitteilen wollen, verzerren: In der aufs Subjekt konzentrierten Perspektive wird der Vollzug von seinem Subjekt her thematisiert; das Ergebnis sind Handlungssätze wie „Ich φ-e“ oder „Ursula ist dabei, zu φ-en“. In der aufs Resultat konzentrierten Perspektive wird der Vollzug von seiner perfektiven, abgeschlossenen, objektiven Gestalt, als vom Subjekt unabhängiger generischer Handlungsbegriff thematisiert. Hegel nennt diese resultative Gestalt des Vollzugs, wie sie in Sätzen wie „es wurde φ getan“ oder „es fand ein φ-en statt“ ausgedrückt wird, „die Tat“.
Hegels darstellungsreflexiver Punkt ist nun, dass die Form von Vollzügen durch das Zusammenspiel dieser beiden verschiedenen Artikulationsweisen charakterisiert ist – diese Verschiedenheit aber „unsichtbar“ wird, wenn man nur auf die propositionalen Gehalte der resultierenden Beschreibungen achtet (wenn man die praktischen Reden nur als Sätze auffasst). In beiden Fällen ist die „Form des Satzes […] die Erscheinung des bestimmten Sinnes oder der Akzent, der seine Erfüllung unterscheidet; daß aber das Prädikat die Substanz ausdrückt und |53|das Subjekt selbst ins Allgemeine fällt, ist die Einheit, worin der Akzent verklingt“ (Hegel 1807, 59). Diese Nivellierung ist, weil sie zur repräsentationalen Form des Satzes gehört, unvermeidlich: Die sprachliche Form drängt das Vorstellen gleichsam fort von dem, worum es gehen soll – dem Vollzug –, und hin auf entweder das Subjekt des Vollzugs, oder auf die allgemeine resultative Form, die er exemplifiziert. Genau an dieser Stelle entsteht die konstitutionstheoretische Auffassung: Sie verliert im „Verklingen des Akzentes“ die Spannung zwischen der subjektiven und der objektiven Perspektive auf den Vollzug aus dem Blick und muss deshalb die Wirklichkeit des Vollziehens auf dessen Ursprung: seine Quelle, „Ursache“, Bedingungen zurückführen. Damit aber hat sie unbemerkt nicht mehr den Vollzug selbst (seine Wirklichkeit), sondern seine Bedingungen (seine Möglichkeit) im Blick. – Den Vollzug selbst, meint Hegel, bekommt man nur als Spannung zweier irreduzibler Beschreibungsperspektiven auf konkretes Tätigsein in den Blick. Deshalb kann man den Vollzug selbst nur mitteilen und darstellen, indem man solche „einerseits-andererseits“-Perspektiven immer wieder durchspielt und nach ihrem inneren Zusammenhang fragt. Die innere Spannung jeder Tätigkeitsbeschreibung in (subjektivistischen) Handlungssätzen und in (objektivistischen) Ereignisbeschreibungen ist kein zu erduldendes Dilemma, sondern „diese Bewegung“ muss als Nachvollzug „ausgesprochen werden; sie muß nicht nur jene innerliche Hemmung, sondern dies Zurückgehen des Begriffs [d.h. des geistigen Vollzugs des Begreifens] in sich muß dargestellt sein“ (Hegel 1807, 61).
Auch ohne Sarkasmus kann man über das Missverhältnis zwischen der Einladung zu „unbefangener“ Lektüre und den Formulierungen stolpern, mit denen Hegel seine eigene Darstellungsstrategie mitteilt. Sie stammen aus der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes, dem zuletzt geschriebenen Kapitel des Buches, und man könnte ihre Dunkelheit werkgeschichtlich auf die systematische „Jugend“ seines Verfassers schieben. Sachlich ist Hegels sprachliche Bemühtheit durch den unbefangenen Anfang gut begründet: Die Phänomenologie soll eine Darstellung des „erscheinenden Wissens“ sein. Sie fragt, wie man, wenn man geistig tätig ist, um sein eigenes geistiges Tätigsein weiß (wie einem dieses Wissen erscheint), und trägt dem Problem der Darstellung von Vollzügen dadurch Rechnung, dass sie die phänomenologische Erzählung in die Perspektiven von Figur und Erzähler (von „erfahrendem Selbstbewusstsein“ und beobachtendem Phänomenologen) differenziert. Das „Wissen“, das dabei zur Erscheinung gebracht wird, muss also verbal, d.h. praxisphilosophisch verstanden werden; das Verbalsubstantiv „Wissen“ bezeichnet nicht einen sogenannten „mentalen Zustand“ (das täte eher das Partizip Präsens oder eine adjektivische Derivation daraus), sondern den Vollzug eines Tuns, etwas, das man irgendwie macht. Statt als (unklaren und irreführenden) terminologischen Festlegungsvorschlag solle man Hegels vielgescholtenen „Jargon“ vielleicht besser als Ringen um sachlich angemessene Formulierungen verstehen (was im Fall der Vorrede noch dadurch erschwert wird, dass sie begriffliche Erträge andeuten soll, deren Bedeutung und Reichweite das nachfolgende Buch erst entwickeln kann: „Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, daß es wesentlich Resultat, daß es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist; und hierin eben besteht seine Natur, Wirkliches, Subjekt oder Sichselbstwerden zu sein“; Hegel 1807, 23f.).
|54|Praxisphilosophie fängt also an mit der „Darstellung“ des Nachvollzugs derjenigen „Bewegung“ an, in der wir unsere menschlichen Angelegenheiten verstehen und artikulieren.