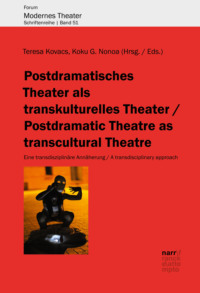Kitabı oku: «Postdramatisches Theater als transkulturelles Theater», sayfa 5
Postkoloniale Kritik des inter-, multi- und transkulturellen Theaters
Theaterwissenschaftler_innen wie Rustom Bharucha,1 Osita Okagbue2 und Helen Nicholson3 argumentieren seit den 1990ern, wie in jenen Zeiten zunächst interkulturell angedachte Projekte, die von abendländischen Theatermacher_innen initiiert, gesteuert und gestaltet werden, die Performancetraditionen ihrer beispielsweise indischen und afrikanischen Kooperationspartner_innen beschneiden, indem sie diese aus dem gesellschaftlichen Kontext reißen, in ein westliches Konstrukt zwängen oder deren komplexe kulturelle Verweise ignorieren bzw. nicht entziffern können. Neben diesen Herausforderungen auf der Produktionsebene formulieren Kulturwissenschaftler_innen wie Birgit Mandel4 und Wolfgang Schneider5 ebenso Missstände hinsichtlich des Erreichens unterschiedlicher Gruppen von Rezipient_innen. Viele kulturelle Gruppierungen bleiben trotz trans-, inter- und multikultureller Ausrichtung den hiesigen Theateraufführungen fern.
Trotz derlei Herausforderungen werden Konzepte von Inter-, Multi- und Transkulturalität in den letzten Jahren breit rezipiert und finden in der Theaterpraxis allerlei Anwendung. Während Interkulturalität die Kommunikation und Verhandlung zwischen den Kulturen betont, baut – grob formuliert – transkulturelles Theater auf den Austausch kultureller Traditionen unter der Maßgabe, etwas „Neues“ zu schaffen, so Wolfgang Sting:
Interkulturelles Theater bewegt sich also zwischen Exotismus (Bestaunen des Fremden), Internationalität (multikulturelles, nichtdialogisches Nebeneinander), Transkulturalität (universell Verbindendes und Neues neben und jenseits bestehender Kulturen), Hybridkulturalität (kulturelle Mischformen). Während Exotismus und Internationalität keinen Perspektivwechsel und Dialog intendieren, beschäftigen sich Transkulturalität und Hybridkulturalität mit der Vielsprachigkeit der Kulturen und entwickeln neue Ausdrucksformen.6
Sting betont, dass ein alleiniges „Bestaunen des Anderen“ und ein „multikulturelles Nebeneinander“ wenig Perspektiven für die Reflexion divers-kultureller Gesellschaften bieten. Doch meines Achtens tendieren ebenso Theaterarbeiten, die eine eher transkulturelle Ausrichtung auf ihre Fahnen schreiben, dazu, ein in der Tendenz westlich ausgerichtetes Modell von Ästhetik zu favorisieren. Auch wenn „Neues neben und jenseits bestehender Kulturen“ generiert wird, geschieht dies oft nach einem westlich tradierten Muster.
So geht der südafrikanische Theaterwissenschaftler Samuel Ravengai der Dominanz abendländischer Theaterkonzepte gegenüber außereuropäischen Performancetraditionen auf den Grund. In The Dilemma of the African Body as a Site of Performance in the Context of Western Training (2011) argumentiert er, dass westliche Schauspielmethoden Körpervorstellungen und performative Praktiken bestimmter afrikanischer Traditionen nicht fassen können:
My hypothesis is that the psycho-technique is a culture-specific system that arose to deal with the heavy realism of Ibsen, Chekhov, Strindberg, Odets and others. I believe that there is a Western realism, which can be differentiated from an African realism. […] Consequently the psycho-technique tends to favour a Western-groomed body and seems to disorientate any other differently embodied body.7
Ravengai kritisiert, dass selbst afrikanische Schauspielschulen – wie etwa zimbabwische – ausschließlich eine auf Stanislavskys Methoden gründende Spieltechnik lehren, die viele Ausdrucksebenen der Absolvent_innen ausblendet oder gar negiert. Nach dieser Lesart weist bereits eine Grundkomponente transkultureller Theaterarbeit – die Darstellungs- und Spieltechniken – aufgrund der Dominanz westlicher Methoden eine Schlagseite auf.
Schließlich erläutert Helen Nicholson in ihrem Buch Applied Drama: The Gift of Theatre (2005), dass Zielsetzungen im Bereich der transkulturell ausgerichteten Projekte des Applied Theatre wie beispielsweise Freiheit und Autonomie des Subjekts vornehmlich auf Vorstellungen des europäischen Theaters des 18. und 19. Jahrhunderts rekurrieren. So argumentiert sie, dass sich Augusto Boals Konzept des „Theatre of the Oppressed“, welches seit Jahrzehnten in trans- und interkultureller Praxis eingesetzt wird, primär auf Konzepte der Aufklärung bezieht:
Boal imbues his spect-actors with special qualities of creativity, autonomy, freedom and self-knowledge, and although his language and terminology is often Marxist in tone, it is on this idealist and Enlightenment construction of human nature that Boal depends for his vision of social change.8
„Autonomy“ ebenso wie die „Enlightenment construction of human nature“ sind Grundfesten des europäischen Theaters seit der Aufklärung und zweifelsohne beeinträchtigen sie, sobald sie als Prämisse von Theaterarbeit gesetzt sind, andere performative und gesellschaftliche Konzepte. Nicholsons Argumentation folgend, wird bereits durch eine solche ästhetisch-philosophische „Vision“ eine gesellschaftspolitische Richtung der Theaterprojekte vorgegeben, die dem europäisch-abendländischen Wertekanon entspricht bzw. vornehmlich auf diesen rekurriert. Mit Rückblick auf ihre eigenen Erfahrungen in der transkulturellen Applied-Theatre-Arbeit kritisiert sie insbesondere die fehlende Reflexion der westlichen Dominanz innerhalb des kreativen und ästhetischen Austauschs, welche regionale Kontexte oftmals über- bzw. ausblendet:
This suggests that an uncritical reading of Boal’s theories of creative exchange has the potential to obscure the significance of context to applied drama. It is left to those who use his techniques, therefore, to consider how the creative dialogue enabled by TO (Theatre of the Oppressed) strategies might illuminate different situations. Practitioners with a range of political perspective apply Boal’s methods to many different situations and problems, and this means that developing a coherent and creative praxis involves recognising that all dramatic dialogues are not only contextually and contently located but also variously politically situated.9
Auf der anderen Seite kann argumentiert werden, dass Theaterprojekte an transkulturellen Schnittstellen womöglich deshalb Konzepte der westlichen Agenda favorisieren, weil diese, insbesondere seit postdramatische Formen am Theater dominieren, eine Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten und ein Verständnis von Ästhetik bereitstellen, welche sich für die Verhandlung diverser kultureller Traditionen und der Generierung neuer Formen besonders eignen.
Post-Hegel: Das transkulturelle Potential des postdramatischen Theaters
Hans-Thies Lehmann deutet in der Betonung der Formenvielfalt des postdramatischen Theaters auf das ungeheure Potential von Theater hin, sich Neuerungen – wie etwa der zunehmenden kulturellen Vielfalt – zu stellen. Bei genauerer Lektüre seines weltweit rezipierten Werkes Postdramatisches Theater wird ersichtlich, dass erste Ansätze über die weitreichenden Möglichkeiten schon in Hegels Vorlesungen über die Ästhetik zu finden sind, obwohl dessen Theorie wiederum auch als Beispiel par excellence für den abendländisch-kolonialen Gestus einer idealistischen Ästhetik stehen kann, die andere Kulturen degradiert.1 Hegels rassistische Bemerkungen zu afrikanischen Kulturen sind bekannt,2 sein Wirken sollte sicherlich einer intensiven postkolonialen Kritik unterzogen werden, doch hält es ebenso fruchtbare Überlegungen für die transkulturelle Wirkungsmacht von Kunst bereit. Lehmann macht ebenfalls eine Ambivalenz in Hegels Werk aus, die hinsichtlich der Frage, inwieweit Hegels Überlegungen zur Ästhetik ein transkulturelles Potential in sich birgt, weiterführend sein kann. Diese äußert sich in der anfangs von Hegel favorisierten, nahezu apodiktisch erscheinenden, doch in den Vorlesungen zunehmend brüchiger werdenden Grundannahme, dass die Gesamtidee einer Gesellschaft sich in der Kunst widerspiegelt, so Lehmann:
Die klassische idealistische Ästhetik verfügte über das Konzept der „Idee“: Entwurf eines begrifflichen Ganzen, das die Details konkretisieren (zusammenwachsen) lässt, indem diese sich, zugleich in der „Realität“ und im „Begriff“, entfalten. Jede historische Phase einer Kunst konnte so von Hegel als konkrete und spezifische Entfaltung der Idee von Kunst betrachtet werden, jedes Kunstwerk als besondere Konkretisation des objektiven Geistes einer Epoche oder „Kunstform“. […] Wenn das Vertrauen in derartige Konstruktionen – etwa des Theaters, von dem dann das Theater einer Epoche eine spezifische Ausfaltung wäre – schwand, so zwingt der Pluralismus der Phänomene dazu, das Unvorhersehbare und „Plötzliche“ der Erfindung, den unableitbaren Moment der Intervention anzuerkennen.3
Nach dieser Argumentation wird in Hegels These des Endes der Kunst das Konzept des ausgestalteten Entwurfs der Idee ad acta gelegt. Das Theater tendiert nach Hegels Auffassung allerdings schon seit der Antike dazu, die Vorstellung des Kunstschönen, und damit das „sinnliche Scheinen der Idee“ in der Kunst zu stören:
Wenn Hegel das Kunstschöne als eine vielschichtige „Versöhnung“ der Gegensätze, insbesondere des Schönen und des Sittlichen versteht, so kann man in der Tat behaupten, dass unter dem Begriff des „Dramatischen“ Hegel jene Züge am Ästhetischen zur Geltung bringt, die den Anspruch auf Versöhnung scheitern lassen.4
Lehmann sieht in Hegels Dramenverständnis also bereits postdramatische Züge aufflackern. Er bezieht sich dabei auf die Überlegungen von Christoph Menke, der wenige Jahre zuvor – Mitte der 1990er Jahre – in Die Tragödie im Sittlichen feststellt: „Das Drama ist bei Hegel, auch schon in seiner griechischen Gestalt, auf dem Weg zu einer nicht mehr schönen Kunst. Im Drama beginnt das Ende der Kunst, in der Kunst.“5 Die Besonderheit des Theaters in der Hegelschen Kunstgeschichte und die damit einsetzende Befreiung der Kunst aus den Fesseln des Kunstschönen verdeutlicht sich in der „doppeldeutigen“ Rolle der Schauspieler_innen, einerseits hinter der Maske „nur“ eine vorgegebene Rolle zu spielen und gleichzeitig zu beanspruchen, ein Individuum zu sein, das selbst entscheidet, diese Maske zu tragen: „Die Schauspieler spalten sich von sich als sittlicher Charakter, als Mitglied des Gemeinwesens, und depotenzieren ihn zu einer Maske, durch die nicht sie bestimmt sind, sondern die an- und abzulegen sie, als ‚wirkliche Subjekte‘, die Macht und Freiheit haben.“6 Hegel gesteht so dem Ästhetischen im Theater eine äußerst bedeutsame Rolle für die Darstellung von Vielfalt jenseits der gesellschaftlichen Bräuche und Sittlichkeit zu. Theater wird mit Hegel zu einem Ort, an welchem der denkende Mensch frei aus der Sittlichkeit herausgeht und im Spiel neue Wege gehen kann. So argumentiert Lehmann:
Das theatrale Spiel insgesamt stellt im Grunde eine Undenkbarkeit für die Philosophie des Geistes dar: das an sich wesenlose subjektive Spiel des Spielenden, der Zeichen künstlich produziert, dieses bloße einzelne Ich, erfährt sich als Gründer und Stifter des Wesentlichen, der sittlichen Gehalte, Schöpfer der dramatis personae als in sich bereits Schönheit und Sittlichkeit vereinenden Gestalten.7
Innerhalb dieser postdramatischen Tendenz, die im Theaterschaffen an sich schon das Ende der klassischen Kunst sieht und – so endet Lehmann sein Unterkapitel über Hegel – „ein Modell für die Auflösung des Theaterbegriffs an(mutet)“8, verbirgt sich ebenso der Hinweis, dass sich gerade die Bühne eignet, eine ungeahnte kulturelle Vielfalt aus sich selbst heraus, unabhängig von der Norm der Mehrheitsgesellschaft, entwickeln zu können.
In eine ähnliche Richtung argumentiert die Kulturwissenschaftlerin Renate Reschke in Die Asymmetrie des Ästhetischen (1995).9 Allerdings bezieht sie dieses Potential des Ästhetischen nicht auf Theater, sondern auf das ästhetische Denken an sich. Sie zeigt, wie, beginnend mit Hegel, innerhalb der philosophischen Diskurse über die Ästhetik asymmetrische Formen zutage treten, indem Grenzen überschritten und so tradierte Strukturen des westlichen Denkens aufgebrochen werden. Während viele andere Bereiche abendländischer Philosophie eine Symmetrie – zum Beispiel die klassischen Formen der Antike oder die „klaren“ Regeln der Logik – bevorzugen, bildet das asymmetrische Denken, so Reschke, ein Korpus, das sich dieser Gleichmäßigkeit und Regelhaftigkeit entzieht, wortwörtlich aus der Reihe tanzt und aus diesem Grunde oftmals von den traditionellen Methoden abendländischer Diskurse nicht begriffen und erfasst werden kann. Reschke setzt als Startpunkt dieser asymmetrischen Denkbewegung die von Hegel aufgegriffene antike Metapher von der weisen Eule der Minerva, die ihren Flug der Erkenntnis erst in der Dämmerung beginnt. Sie sieht in ihr und weiteren Hegelschen Überlegungen zur Ästhetik einen ersten Moment innerhalb der abendländischen Geschichte des Denkens, in welchem der Diskurs sich aus den symmetrischen, wohlgeordneten Strukturen der Wissensgenerierung herauswagt und Sphären betritt, welche die klaren Gesetzmäßigkeiten der Logik samt deren Methoden dialektischer Beweisführung aushebeln:
Die Ästhetik, die am programmatischen „Ende der Kunst“ aktiv wird und ihre Einsichten formuliert, kündete […] auch von der Aussagekraft des Metaphorisch-Asymmetrischen. Die kluge Eule kommt zu ihren Erkenntnissen gegen jede systematische Einseitigkeit und vorbei an den Sicherheiten begrifflicher Fixierungen.10
Mit Blick auf Hegels Vorlesungen über die Ästhetik formuliert dieser tatsächlich eine Art Ahnung oder gar Vermächtnis, dass sein Gebäude des dialektischen abendländischen Denkens, der Weg des spekulativen Prozesses zum absoluten Geist, den er in der Phänomenologie des Geistes beschreibt, keinen universalen Anspruch mehr haben kann. Am Ende der von seinem Schüler Heinrich Gustav Hotho aufgezeichneten und herausgegebenen Vorlesungen, just nach seinen Überlegungen zur Tragödie und Komödie, wird diese Wende in der Hegelschen Philosophie nochmals deutlich:
Doch auf diesem Gipfel führt die Komödie zugleich zur Auflösung der Kunst überhaupt. Der Zweck aller Kunst ist die durch den Geist hervorgebrachte Identität, in welcher das Ewige, Göttliche, an und für sich Wahre in realer Erscheinung und Gestalt für unsere äußere Anschauung, für Gemüt und Vorstellung geoffenbart wird. Stellt nun aber die Komödie diese Einheit nur in ihrer Selbstzerstörung dar, […] so tritt die Gegenwart und Wirksamkeit des Absoluten nicht mehr in positiver Einigung mit den Charakteren und Zwecken des Daseins hervor, sondern macht sich nur in der negativen Form geltend, dass alles ihm nicht Entsprechende sich aufhebt und nur die Subjektivität als solche sich zugleich in dieser Auflösung als ihrer selbst gewiss und in sich gesichert zeigt.11
Hegel ahnt, dass die Komödie eine Wirklichkeit bzw. Subjektivität hervorbringt, die sein Modell des absoluten Geistes nur noch in einer negativen Form, in einer Art des Auflösens und Aufhebens, begreifen kann. Das heißt, dass er die Zukunft der Kunst nicht in einer Identitätserfahrung sieht, in der sich die „Idee“ der Gesellschaft in der Kunst offenbart, sondern in der Aufhebung dieser herkömmlichen Einheit. Er macht so indirekt für die ästhetische Erfahrung eine folgenschwere Prognose. Die Zukunft liegt nicht in einer gemeinschaftlichen Versöhnung vom einzelnen mit dem Ewigen bzw. Göttlichen, der Idee der Gemeinschaft, sondern in der Auflösung dieses tradierten Bundes. So enden seine Vorlesungen mit einem Wunsch:
Möge meine Darstellung Ihnen in Rücksicht auf diesen Hauptpunkt Genüge geleistet haben, und wenn sich das Band, das unter uns überhaupt und zu diesem gemeinsamen Zwecke geknüpft war, jetzt aufgelöst hat, so möge dafür, das ist mein letzter Wunsch, ein höheres, unzerstörliches Band der Idee des Schönen und Wahren geknüpft sein und uns von nun an immer fest vereinigt haben.12
Dieses neue Band, das sich nicht mehr in der schönen Erscheinung des absoluten Geistes konstituieren kann, erschafft sich aus dem Wissen, dass diese „durch den Geist hervorgebrachte Identität“ – zumindest in der Kunst – nicht mehr darstellbar scheint. Hegel deutet am Ende der Vorlesungen über die Ästhetik nicht nur auf Formen des Theaters, die Lehmann Ende des 20. Jahrhunderts als postdramatische beschreibt, sondern auch auf dessen Potential, kulturelle Vielfalt zu fassen und Transkulturalität jenseits der „Idee“ einer singulären kulturellen Tradition darzustellen. Diese, zugegeben, noch etwas kryptische Andeutung, lässt sich anhand drei hier nun genauer betrachteten Theater- und Tanzproduktionen in Südafrika und Deutschland, die in den letzten zehn Jahren erarbeitet wurden, zu tiefergehenden Überlegungen weiterentwickeln.
Mistral in Berlin
In dem gemeinsam erarbeiteten Duett Mistral1 begegnen sich Susanne Linke und Koffi Kôkô, zwei Vertreter_innen spezifischer kultureller Tanztraditionen, die gleichsam Akteur_innen einer global und international agierenden Tanzszene sind:
Susanne Linke, als Vertreterin der Tanzmoderne von Mary Wigman und des Deutschen Tanztheaters, trifft auf die jahrhundertealte „Körperbibliothek“ des zeitgenössischen afrikanischen Performers: Eingeschrieben in die Körper zweier Ausnahmetänzer begegnen sich Moderne und Traditionen. Tänzerische Präsenz, Körpergedächtnis, Technik, kultureller Kontext und Geschlecht werden zu Ausgangspunkten einer einzigartigen Begegnung von performativem Wissen und gesellschaftspolitischen Fragen. Und das in einer radikalen Gegenüberstellung: Susanne Linke und Koffi Kôkô führen einen Dialog darüber, wie das Wissen großer Tanztraditionen zwischen Kulturen und über Generationen hinweg zu vermitteln ist.2
Zu Beginn des Stückes schreiten sie gemeinsam eine Zigarre rauchend über die Bühne und werden kurz darauf aus dem Paradies der zweisamen Einigkeit hinausgeworfen. Beide beginnen ihre jeweilige Choreografie zunächst auf der Bühne voneinander getrennt, suchen ihren Ausdruck in ihren reichhaltigen Bewegungsgedächtnissen und deren kulturellen Verortungen: Koffi Kôkô, in Benin geboren, ist Voodoo-Priester und einer der bekanntesten Vertreter des afrikanischen zeitgenössischen Tanzes. Seine Bewegungssprache entwickelt er zum Teil aus Ritualen Westafrikas heraus. Susanne Linke ist eine der führenden Vertreterinnen des europäischen Solotanzes. Sie verbindet Traditionen des deutschen Ausdruckstanzes von Mary Wigman und Dore Hoyer mit Positionen des modernen Tanzes aus der Folkwang-Tradition (Kurt Jooss, Hans Züllig, Pina Bausch). Beide kombinieren in ihrem Schaffen diese Traditionen mit zeitgenössischen Interpretationen und Bewegungsformen, doch sind die Wurzeln ihres Tanzes in diesem Teil der Aufführung stets erkennbar. Auf der Bühne eröffnen sie einen ästhetischen Raum, der zwei ganz unterschiedliche Rhythmen, Bewegungsfolgen und ebenso spirituelle Wirkungsfelder erschafft. Doch diese beiden Spannungsfelder kommen aufeinander zu und geraten in einen Dialog, so schreibt Sandra Luzina:
Er lässt seine Hände sprechen und lädt den Raum mit seiner Energie auf. Sie bewegt sich leichtfüßig über die Bühne und strahlt bei aller Fragilität eine große Stärke aus. Wunderbar, wie die beiden, die auf der Bühne zu alterslosen Figuren werden, zueinander finden: Sie nähern sich mit Neugier und gegenseitigem Respekt. Ein Höhepunkt ist das heitere Duett zu afrikanischen Trommelrhythmen: Koffi Kôkô prescht vor, Susanne Linke greift die Bewegungsmotive auf, interpretiert sie aber auf ihre eigene Weise. Beide fassen sich an den Händen und setzen mit großer Zartheit einen Fuß vor den anderen – stets sensibel des Grunds gewahr, auf dem sie schreiten.3
Doch nicht nur der Respekt gegenüber dem anderen und ihrem bzw. seinem jeweiligen Bewegungsrepertoire ist in dieser Inszenierung bemerkenswert. Der Umgang mit dem unterschiedlichen Geschlecht und der verschiedenen Hautfarbe spielt manchmal eine Rolle und dann wiederum nicht. Das in heutigen Tagen auf deutschen Bühnen brisante Thema „Schwarz – Weiß“ wird nicht nur über die Hautfarbe der beiden Tänzer_innen angedeutet, sondern spiegelt sich in deren Anzugsfarbe wider. Sie sind mal beide weiß, mal beide schwarz, mal der eine schwarz, mal der andere weiß. Auch Machtverhältnisse geschlechtlicher Art treten an einer Stelle in den Vordergrund, dann wiederum verschwimmen sie. Spannungen und Konflikte zwischen den Geschlechtern und ethnischer Zugehörigkeit werden so nicht überspielt, bekommen jedoch immer nur einen bestimmten Raum und werden überwunden oder finden sich in einem Dialog zusammen. Mistral macht deutlich, dass hier nicht ein schwarzer Mann aus Afrika und eine weiße Frau aus Europa aufeinandertreffen, sondern zwei Tänzer_innen mit diversen, vielschichtigen kulturellen Hintergründen und Tanzpraktiken, die selbstverständlich häufig mit Geschlecht und Herkunft einher gehen, aber nicht immer. Ihre tänzerischen Statements sind mal stabil, mal wandelbar, mal gegensätzlich, mal divers und mal vereint.
Linke und Kôkô verknüpfen auf diese Weise unterschiedliche Performancekulturen, betonen aber auch, dass sie jeweils ein Geflecht unterschiedlicher Traditionen verkörpern. Obwohl die Ausgangssituation auf den ersten Blick dichotom aufgeladen ist (Mann und Frau, Schwarz und Weiß), wird diese Binarität zugunsten der Darstellung einer Vielfalt aus kulturellen Traditionen, Verortungen und Kodierungen immer wieder aufgehoben. Kulturelle Differenzen werden dabei nicht aufgelöst, Unterschiede bleiben bestehen, aber bewegen sich auf diversen Ebenen und werden neu verhandelt, überdacht, gemeinsam präsentiert. Trotz der Diversität an Differenzen, die sich ebenso innerhalb des jeweils eigenen Tanzrepertoires ergeben, da beide aus verschiedenen zeitgenössischen und traditionellen Formen und Bedeutungsebenen schöpfen, scheint kein Körper und keine Technik die andere durchgängig zu dominieren. Linke und Kôkô präsentieren ihre Bewegungsformen mal selbstbewusst, mal vorsichtig, mal übernimmt der eine die Form des anderen, mal stehen sie sich in ihrer Unterschiedlichkeit gegenüber.
Beide Tänzer_innen verfolgen eine transkulturelle Dramaturgie, die sich darin äußert, dass sie ihre Vielschichtigkeit im Verlauf des Stückes herausarbeiten und miteinander in Dialog bringen und so einen neuen ästhetischen Raum schaffen. Linke und Kôkô spielen zwar mit den üblichen (post)kolonialen Dichotomien, heben diese jedoch immer wieder auf und verdeutlichen schon allein anhand ihres jeweiligen körperlichen Tanzgedächtnisses, dass diese nicht einer bestimmten Tradition zuzuordnen sind, sondern bereits verschiedene Kulturen verflechten. Entscheidend für die Besonderheit ihrer ästhetischen Verfahrensweise scheint jedoch das „Sowohl als auch“ zu sein, die Betonung des Eigenen, des Gemeinsamen, der Verschiedenheit zu sich selbst und zu dem anderen. Der ästhetische Raum, den Kôkô und Linke kreieren, zeugt von Wandel und Stetigkeit, Authentizität und Klischee, wiederkehrenden Mustern und Neuerungen, Vereinzelung und Gemeinsamkeit, Konflikt und Dialog. Mistral entwickelt Hegels Andeutung am Ende dessen Vorlesungen über die Ästhetik weiter und entfaltet ein Potential im Ästhetischen, welches über die „Auflösung“ und „negative Form“, die Hegel als Merkmal der Wende des Ästhetischen im Drama seiner Zeit festsetzt, hinausgeht. Linke und Kôkô unterstreichen, dass eine Vereinigung ihrer Tanztraditionen nicht über Auflösung ihrer Traditionen, sondern über die Betonung der Verschiedenheit und Pluralität möglich ist. Sie schaffen eine Sphäre der Unterschiedlichkeit, Konflikte und des Auseinandersetzens, aber auch des Dialogs und Zusammenkommens in diversen Momenten der Aufführung.