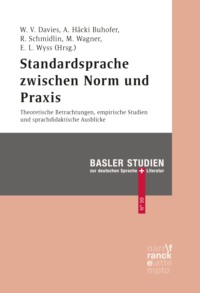Kitabı oku: «Standardsprache zwischen Norm und Praxis», sayfa 6
Es gilt, zwischen dem Zweifeln selbst und den Zweifelsfällen zu unterscheiden (Dürscheid 2011: 155). Das didaktisch Interessante scheint der Prozess des Zweifelns zu sein, das Abwägen von Korrektheit und Angemessenheit. Antos (2003: 43) (vgl. Dürscheid 2011: 161) bringt es so auf den Punkt: „Dumme, Ignoranten, Stolze können nicht zweifeln. Ihnen fehlt gerade jenes Wissen, das sie benötigten, um Lücken, Unklarheiten oder Grenzen überhaupt erst erkennen zu können.“ Bleibt zu hoffen, dass die digitalen Möglichkeiten, lexikographische und grammatikographische Mittel zu nutzen, sowie korpusgestützte Analysen von Zweifelsfällen (vgl. dazu Konopka 2011) vermehrt Einzug in die Lehrerausbildung halten. Nicht nur, um Korrektheit und Angemessenheit von Varianten gezielt zu überprüfen, sondern auch um damit umgehen zu lernen, dass Varianten ihren Status ändern können und ihre Angemessenheit an einen spezifischen Verwendungszusammenhang gebunden sein kann, aber nicht muss.11
6. Literatur
Ammon, Ulrich (1995): Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten. Berlin, New York: de Gruyter.
Ammon, Ulrich, Hans Bickel, Jakob Ebner, Ruth Esterhammer, Markus Gasser, Lorenz Hofer, Birte Kellermeier-Rehbein, Heinrich Löffler, Doris Mangott, Hans Moser, Robert Schläpfer†, Michael Schlossmacher, Regula Schmidlin & Günter Vallaster (2004): Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. Berlin, New York: de Gruyter.
Ammon, Ulrich, Hans Bickel & Alexandra Lenz (2016): Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol sowie Rumänien, Namibia und Mennonitensiedlungen. Berlin, Boston: de Gruyter.
Antos, Gerd (2003): „Imperfektibles“ sprachliches Wissen. Theoretische Vorüberlegungen zu „sprachlichen Zweifelsfällen“. In: Linguistik online 16, 4/03.
Auer, Peter (2014): Enregistering pluricentric German. In: Silva, Augusto Soares da (Hrsg.): Pluricentricity. Language Variation and Sociocognitive Dimensions. Berlin, Boston: de Gruyter Mouton, 19–48.
Besch, Werner (1990): Schrifteinheit – Sprechvielfalt. Zur Diskussion um die nationalen Varianten der deutschen Standardsprache. In: German Life and Letters 43/2, 91–102.
Bickel, Hans & Christoph Landolt (2012): Schweizerhochdeutsch. Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen Schweiz. Mannheim: Bibliographisches Institut.
Davies, Winifred V. (2000): Linguistic norms at school. A survey of secondary-school teachers in a central German dialect area. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, LXVII, 129–147.
De Cillia, Rudolf (2014): Innersprachliche Mehrsprachigkeit, Sprachnorm und Sprachunterricht. In: Ransmayr, Jutta, Andrea Moser-Pacher & Ilona Elisabeth Fink (Hrsg.): Österreichisches Deutsch und Plurizentrik. Innsbruck: Studien Verlag, 9–19.
Dudenredaktion (2011) (Hrsg.): Richtiges und gutes Deutsch. Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim: Dudenverlag.
Duden (2013): Die deutsche Rechtschreibung. Hrsg. von der Dudenredaktion. 26. Aufl. Berlin: Bibliographisches Institut GmbH.
Duden (2015): Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Hrsg. von der Dudenredaktion. Berlin: Dudenverlag.
Dürscheid, Christa (2011): Zweifeln als Chance? Zweifeln als Problem? Sprachliche Zweifelsfälle im Deutschunterricht. In: Köpcke, Klaus-Michael & Arne Ziegler (Hrsg.): Grammatik – Lehren, Lernen, Verstehen. Zugänge zur Grammatik des Gegenwartsdeutschen. Berlin, Boston: de Gruyter, 155–173.
Dürscheid, Christa & Patrizia Sutter (2014): Grammatische Helvetismen im Wörterbuch. In: Zeitschrift für angewandte Linguistik 60/1, 37–65.
Dürscheid, Christa & Stephan Elspaß (2015): Variantengrammatik des Standarddeutschen. In: Kehrein, Roland, Alfred Lameli & Stefan Rabanus (Hrsg.): Areale Variation des Deutschen – Projekte und Perspektiven. Berlin, New York: de Gruyter, 563–584.
Dürscheid, Christa, Stephan Elspaß & Arne Ziegler (2011): Grammatische Variabilität im Gebrauchsstandard – das Projekt Variantengrammatik des Standarddeutschen. In: Konopka, Marek et al. (Hrsg.): Grammar & Corpora/Grammatik und Korpora 2009. Tübingen: Narr, 123–140.
Ebner, Jakob (2009): Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch. Mannheim: Dudenverlag.
Elspaß, Stephan (2005): Zum sprachpolitischen Umgang mit regionaler Variation in der Standardsprache. In: Kilian, Jörg (Hrsg.): Sprache und Politik. Deutsch im demokratischen Staat. Mannheim etc.: Duden, 294–313.
Elspaß, Stephan, Julia Engel & Konstantin Niehaus (2013): Areale Variation in der Grammatik des Standarddeutschen – Problem oder Aufgabe?. In: German as a Foreign Language, 2/2013, 44–64.
Engelberg, Stefan & Lothar Lemnitzer (2009): Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. Tübingen: Stauffenburg-Verlag.
Fiehler, Reinhard (2000): Über zwei Probleme der Untersuchung gesprochener Sprache. In: Sprache und Literatur 85/2000, 23–42.
Götz, Ursula (1995): Regionale grammatische Varianten des Standarddeutschen. In: Sprachwissenschaft 20, 222–238.
Greule, Albrecht (2002): Deutsch am Scheideweg: National- oder Internationalsprache? Neue Aspekte der Sprachkultivierung. In: Hoberg, Rudolf (Hrsg.): Deutsch – Englisch – Europäisch. Impulse für eine neue Sprachpolitik. Mannheim etc.: Dudenverlag, 54–66.
Häcker, Roland (2009): Wie viel? Wozu? Warum? Grammatik in der Schule. In: Konopka, Marek & Bruno Strecker (Hrsg.): Deutsche Grammatik – Regeln, Normen, Sprachgebrauch. Berlin, New York: de Gruyter, 309–332.
Häcki Buhofer, Annelies (2002): Steuert Sprachbewusstheit den eigenen Sprachgebrauch? Überlegungen zum Zusammenhang an Beispielen aus der deutschen Schweiz. In: Der Deutschunterricht 3/2002, 18–30.
Hägi, Sara & Joachim Scharloth (2005): Ist Standarddeutsch für Deutschschweizer eine Fremdsprache? Untersuchungen zu einem Topos des sprachreflexiven Diskurses. In: Linguistik online 24, 3/05.
Henggeler, Kerstin (2008): Zum Normverständnis und Korrekturverhalten von Deutschlehrern. Eine linguistische Untersuchung bei Lehrpersonen der Sekundarstufe II. Universität Zürich: Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit.
Henning, Mathilde (2012): Was ist ein Grammatikfehler? In: Günthner, Susanne et al. (Hrsg.): Kommunikation und Öffentlichkeit. Sprachwissenschaftliche Potenziale zwischen Empirie und Norm. Berlin etc.: de Gruyter, 125–151.
Klein, Wolf Peter (2003): Sprachliche Zweifelsfälle als linguistischer Gegenstand. Zur Einführung in ein vergessenes Thema der Sprachwissenschaft. In: Linguistik online 16, 4/03.
Klein, Wolf Peter (2009): Auf der Kippe? Zweifelsfälle als Herausforderung(en) für Sprachwissenschaft und Sprachnormierung. In: Konopka, Marek & Bruno Strecker (Hrsg.): Deutsche Grammatik – Regeln, Norm, Sprachgebrauch. Berlin, New York: de Gruyter, 141–165.
König, Werner (1989): Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundesrepublik Deutschland. Ismaning: Hueber.
Konopka, Marek (2011): Grammatik verstehen lernen und korpusgestützte Analysen von Zweifelsfällen. In: Köpcke, Klaus-Michael & Arne Ziegler (Hrsg.): Grammatik – Lehren, Lernen, Verstehen. Zugänge zur Grammatik des Gegenwartsdeutschen. Berlin, Boston: de Gruyter, 265–285.
Krech, Eva-Maria, Eberhard Stock, Ursula Hirschfeld & Lutz-Christian Anders (2010): Deutsches Aussprachewörterbuch. Berlin: de Gruyter.
Langenscheidt (2003): Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen wollen. Hrsg. von D. Götz et al. Berlin: Langenscheidt.
Läubli, Martina (2006): Nationale Varietäten: Eine Herausforderung für die Lexikografie. Wie deutschsprachige Wörterbücher mit Helvetismen umgehen. In: Dürscheid, Christa & Martin Businger (Hrsg.): Schweizer Standarddeutsch. Beiträge zur Varietätenlinguistik. Tübingen: Narr, 113–130.
Markhardt, Heidemarie (2005): Das Österreichische Deutsch im Rahmen der EU. Frankfurt am Main etc.: Lang.
Meyer, Kurt (2006): Schweizer Wörterbuch. So sagen wir in der Schweiz. Mit einem Beitrag von Hans Bickel. Frauenfeld: Verlag Huber.
Österreichisches Wörterbuch (2012): Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. Hrsg. im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 42. Aufl. Wien: öbv.
Rastner, Eva-Maria (1997): Sprachvarietäten im Unterricht. Eine Umfrage unter Österreichs LehrerInnen zu Standardsprache – Umgangssprache – Dialekt. In: Informationen zur Deutschdidaktik 21/3, 80–97.
Reiffenstein, Ingo (2001): Das Problem der nationalen Varietäten. Rezension zu Ulrich Ammon: Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten. Berlin, New York 1995. In: ZfdPh 120, 78–99.
Schläpfer, Robert, Jürg Gutzwiller & Beat Schmid (1991): Das Spannungsfeld zwischen Mundart und Standardsprache in der deutschen Schweiz. Spracheinstellungen junger Deutsch- und Welschschweizer. Eine Auswertung der Pädagogischen Rekrutenprüfungen 1985. Aarau etc.: Sauerländer.
Schmidlin, Regula (2011): Die Vielfalt des Deutschen: Standard und Variation. Gebrauch, Einschätzung und Kodifizierung einer plurizentrischen Sprache. Berlin, New York: de Gruyter.
Schmidlin, Regula (2013): Gebrauch und Einschätzung des Deutschen als plurizentrische Sprache. In: Schneider-Wiejowski, Karina, Birte Kellermeier-Rehbein & Jakob Haselhuber (Hrsg.): Vielfalt, Variation und Stellung der deutschen Sprache. Berlin, New York: de Gruyter, 23–41.
Schneider, Jan Georg (2013): Sprachliche ‚Fehler‘ aus sprachwissenschaftlicher Sicht. In: Sprachreport 1–2/2013, 30–37.
Studler, Rebekka (2013): Einstellungen zu Standarddeutsch und Dialekt in der Deutschschweiz. Erste Ergebnisse einer Fragebogenstudie. In: Hettler, Yvonne et al. (Hrsg.): Variation, Wandel, Wissen. Studien zum Hochdeutschen und Niederdeutschen. Frankfurt am Main etc.: Lang, 203–222.
Trudgill, Peter & Jean Hannah (2008): International English. A guide to the varieties of standard English. London: Hodder Education.
Wahrig (2006): Deutsches Wörterbuch. Hrsg. vom Bertelsmann-Lexikon-Institut. Gütersloh: Wissen Media Verlag.
Wardhaugh, Ronald (1987): Languages in Competition. Dominance, Diversity, and Decline. Oxford: Basil Blackwell.
Die Begrenztheit plurizentrischer Grenzen: Grammatische Variation in der pluriarealen Sprache Deutsch1
Konstantin Niehaus
1 Einführung
2 Plurizentrisch oder pluriareal?
3 Empirische Zugänge zur Pluriarealität – das Projekt ‚Variantengrammatik des Standarddeutschen‘
4 Grammatische Fallbeispiele
5 Sprachdidaktische Bedeutung der Pluriarealität
6 Fazit und Ausblick
7 Literatur
1. Einführung
Der folgende Beitrag stellt das A-CH-Projekt ‚Variantengrammatik des Standarddeutschen‘1 vor, präsentiert einige seiner Ergebnisse und diskutiert die Frage, welche Bedeutung den gewonnenen Erkenntnissen in der Sprachdidaktik in Zukunft zukommen kann.
Die bisherige Forschung zur arealen Variation innerhalb des Standarddeutschen konzentriert sich ganz wesentlich auf die linguistischen Ebenen des Wortschatzes (vgl. ‚Variantenwörterbuch des Deutschen‘, Ammon et al. 2004 [im Folgenden: VWB]) und der Aussprache (‚Atlas zur Aussprache des Gebrauchsdeutschen‘, Kleiner 2011ff.). Die areale Variation in der standarddeutschen Grammatik hingegen ist bislang nicht systematisch untersucht worden, obwohl doch ausgerechnet die Grammatik grundlegend für die Konstitution sprachlicher ‚Systeme‘ – wie ich sie für areale Varietäten hier annehmen will2 – wäre. Zumindest aber sollte uns die grammatische Variabilität des Standarddeutschen etwas über die Stärke des Faktors Arealität für das Standarddeutsche, vielleicht sogar generell für die Sprache Deutsch, verraten. In Bezug auf das innere Varietätenspektrum des Deutschen würde eine Untersuchung der grammatischen Variation im Standarddeutschen Aufschluss darüber geben, ob denn tatsächlich die „neuhochdeutsche Standardsprache […] anders als die Dialekte kaum regionale syntaktische Variation“ (Fleischer & Schallert 2011: 29) zeigt – und in welchem quantitativen Rahmen sowie an welchen sprachgeografischen Unterschieden sich dies feststellen lässt. Und freilich wären aus einer etwaigen Arealität des Standarddeutschen auch sprachdidaktische Folgerungen für den Deutschunterricht zu ziehen, bedenkt man allein die national wie teilweise föderal geprägten Strukturen in den Bildungssystemen deutschsprachiger Länder. Alles in allem scheint es also dringend angeraten, die grammatische Variabilität im Standarddeutschen empirisch breit und systematisch zu erforschen. Ein erstes Ziel des folgenden Beitrags ist es, einen Einblick in die bisherige Erforschung dieser Variabilität durch das Projekt ‚Variantengrammatik des Standarddeutschen‘ zu geben. Hierzu werde ich einige grammatische Fallbeispiele präsentieren. Anhand dieser Beispiele soll illustriert werden, inwieweit das Standarddeutsche überhaupt über grammatische Variation verfügt und welche Bereiche der Grammatik überhaupt betroffen sind.
Meine Darstellung verfolgt jedoch noch ein zweites Ziel: Das Projekt ‚Variantengrammatik‘ geht davon aus, dass es sich bei der deutschen Sprache nicht um eine plurizentrische, sondern vielmehr um eine pluriareale Sprache handelt. Obwohl das plurizentrische Modell heute in weiten Teilen der Germanistik als akzeptierte Lehrmeinung gelten kann, ist dieses mit einigen problematischen Grundannahmen behaftet. Demgegenüber bietet die pluriareale Sichtweise theoretische wie methodische Vorteile, die im Folgenden herausgestellt werden sollen.
In einem abschließenden Punkt werde ich auch noch darauf eingehen, welche sprachdidaktischen (und sprachpolitischen) Vorteile ein pluriarealer Ansatz bietet. Dies ist das dritte und letzte Ziel des Beitrags.
Zum Aufbau der folgenden Ausführungen: Ich werde mit einer knappen Darstellung der Diskussion um plurizentrische vs. pluriareale Forschungsmeinungen beginnen und dabei den Schwerpunkt bereits auf die erwähnten Vorteile des pluriarealen Modells legen. Hieran schließt sich eine genauere Darstellung des Projekts ‚Variantengrammatik des Standarddeutschen‘ an, das aufbauend auf ebenjenem pluriarealen Ansatz einige methodische Spezifika entwickelt hat. Diese gilt es darzustellen, um die dann folgenden Beispiele einordnen zu können: Einzelne grammatische Phänomene werden analysiert. Sie zeigen, dass grammatische Variation im Standarddeutschen in vielen Formen auftreten kann und durchaus nicht an nationalen Grenzen haltmacht. Überlegungen zu sprachdidaktischen Implikationen schließen diesen Teil ab. Diese Ausführungen werden mangels größerer sprachdidaktischer Forschungen eher knapp und vorläufig ausfallen müssen. Die Darstellung endet mit einem kleinen Fazit und einem Ausblick auf weitere Forschung.
2. Plurizentrisch oder pluriareal?1
Vor ca. drei Jahrzehnten löste sich die Sprachgermanistik allmählich von der Vorstellung eines mehr oder weniger einheitlichen ‚Binnendeutschen‘ und forcierte plurizentrische Darstellungen zum Standarddeutschen. Wegweisend waren dabei die Arbeiten von Clyne (1992) und besonders Ammon (1995), letztere ist denn auch eingegangen in die Konzeption des VWB und ist von Schmidlin (2011) und Kellermeier-Rehbein (2014) fortgeführt und erweitert worden. Das plurizentrische Modell teilt das Standarddeutsche bzw. den Gebrauch des Standarddeutschen nach Nationen ein, die Deutsch als Amtssprache führen, mit Deutschland, Österreich und der Schweiz als Vollzentren sowie Ostbelgien, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol als Halbzentren (vgl. Ammon 1995: 96). Die deutschen Standardvarietäten fungieren dabei als kodifizierte, amtlich und schulisch institutionalisierte ‚Dachsprachen‘ (vgl. Ammon 1995: 2–4). Variation innerhalb einer Nation wird dabei als nicht varietätenkonstitutiv angesehen, d.h. es gibt nach plurizentrischer Vorstellung z.B. keine ‚bayerische‘ Standardvarietät, sondern „einfache unspezifisch nationale“ oder „sehr unspezifisch nationale“ Varianten innerhalb einer deutschländischen/bundesdeutschen Standardvarietät – dies im Gegensatz zu absolut „spezifisch nationalen“, ausschließlich in einem Land auftretenden Varianten (vgl. hierzu Ammon 1995: 106–110). Theoretisch bedeutet das, dass Mehrheitsvarianten ausschlaggebend für die Nomenklatur und bedeutsamer für das Modell insgesamt sind als Minderheitsvarianten. Das plurizentrische Modell versucht schließlich auch, politisch ‚up-to-date‘ zu bleiben, indem zum einen die sprachgeschichtlich gewachsene Wichtigkeit nationaler Kommunikationsräume betont wird (vgl. von Polenz 1999: 125), zum anderen laut Plurizentrikern ehemalige politische Räume wie die DDR keine Grundlage für eine Varietät des Standarddeutschen (mehr) bilden können, ein Ausschluss, der mit politischen Argumenten (Übernahme der Zwei-Staaten-eine-Nation-Lehre der BRD, vgl. Ammon 1995: 386–389), nicht mit (sozio-)linguistischen begründet wird.
Bereits ab den 1990er Jahren gab es starke Kritik am plurizentrischen Modell. Aus dieser Phase hervorzuheben sind dabei Wolf (1994), Scheuringer (1997), Koller (1999) und – in Reaktion auf Ammon (1995) und von Polenz (1999) – auch noch Reiffenstein (2001). Sie alle wandten sich auf der Basis der Lexik, die damals die bevorzugt beachtete linguistische Ebene war (auch in plurizentrischen Arbeiten), gegen eine rein nationale Gliederung des Deutschen: weil die Existenz des in vielen Fällen ‚grenzüberschreitenden‘ Wortschatzes der standardnahen Alltagssprache der postulierten nationalen Spezifik faktisch widerspreche, weil ein konkretes Zentrum pro Land im Sinne von plurizentrisch nicht auszumachen sei (vgl. zu beidem Wolf 1994: 71–74), weil eine ‚nationale‘ Variante nur eine areale Form von vielen sei (vgl. Scheuringer 1997: 343) und weil kulturpolitisch eine (Über-)Betonung nationaler Spezifika ohnehin bedenklich sei (vgl. Koller 1999: 137). Reiffenstein (2001) nimmt eine Sonderstellung unter den Vertretern des pluriarealen Ansatzes ein: Er schlägt vielmehr ein ‚regio-plurizentrisches‘ Modell vor und betont den Aspekt, dass gerade historische Kontinuitäten in Sprache und Kultur einflussreicher seien als politische Konstrukte, wobei bei dieser historisch-kulturellen Raumkonzeption jedoch durchaus Kernräume und Zentren auszumachen seien (vgl. Reiffenstein 2001: 87–88). Alle oben genannten Kritikpunkte wurden in der Folge immer wieder von Vertretern pluriarealer Modelle aufgegriffen, darunter Eichinger (2005a, 2005b) und Elspaß (2005). Letzterer deutet z.B. an, dass der politisch statt empirisch motivierte, theoretische Ausschluss eines möglichen DDR-Standarddeutsch dem tatsächlichen Sprachgebrauch nicht notwendigerweise folgen muss (vgl. Elspaß 2005: 302–303).
Ein aus heutiger Sicht theoretischer Vorteil des pluriarealen Modells ist es dagegen, über Aussehen und Stärke der Areale weniger strikte Vorannahmen zu tätigen bzw. generell schlicht mehr Möglichkeiten neben der derzeit gültigen nationalen Gliederung in Betracht zu ziehen. Nationale areale Varianten können im pluriarealen Modell immer noch ihren Platz finden, sie sollen ja gleichberechtigt neben arealen Varianten des Standarddeutschen bestehen statt durch diese ersetzt werden.2 Bei Farø (2005) sowie in der jüngeren Diskussion (z.B. Dürscheid et al. 2015) wird ein weiteres Argument vorgebracht: Minderheitsvarianten sollten für eine möglichst exhaustive Beschreibung der Variabilität ebenso für die Konstitution von Varietäten berücksichtigt werden wie Mehrheitsvarianten, vgl. Abb. 1 (adaptiert nach Scherr & Niehaus 2013: 78).

Abb. 1: relative Varianz, adaptiert nach Scherr & Niehaus (2013: 78)
Modellhaft soll hier gezeigt werden, dass sich das Vorkommen einer Variante x und einer Variante y keineswegs auf ein Areal beschränken muss, wie dies hier nur für Variante z gilt. Relative Varianten, die mal Mehrheits- mal Minderheitsvariante sein können (z.B. x in Areal A mit 70 % gegenüber nur 30 % in Areal B), können neben absoluten bestehen. Methodisch soll deswegen die im plurizentrischen Ansatz oft fehlende oder mangelnde Betrachtung der relativen Varianz überwunden werden (vgl. z.B. Dürscheid et al. 2015: 218–219). Neu ist also, dass auch geringere Anteile als 50 % an einer Variable zur Charakterisierung eines Areals berücksichtigt werden können, d.h. auch Minderheitsvarianten eines bestimmten Areals ausdrücklich als dort in Verwendung stehend ausgewiesen werden.
Wie eine Methodik nach dem pluriarealen Modell dabei konkret aussehen kann, werde ich im nächsten Punkt ausführen, und zwar an Beispielen aus dem Projekt ‚Variantengrammatik des Standarddeutschen‘.