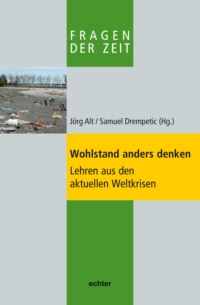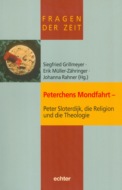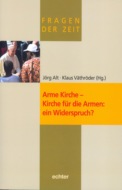Kitabı oku: «Wohlstand anders denken», sayfa 2
Teil I: Situationsbeschreibung
Jörg Alt
Aus dem Ruder gelaufen –
Krise des Finanzsystems und die Folgen
Hintergründe
Man hätte gewarnt sein können: Bereits 1996 hat eine Studie der Weltbank ergeben, dass sich allein für die Zeit seit dem Ende des Bretton-Woods-Systems 96 ‚Bankenkrisen‘ und 175 ‚Finanzkrisen‘ feststellen lassen.1 Ebenso war bekannt, dass Adam Smith, der Prophet der Marktwirtschaft, in seinem Buch Wealth of Nations eine staatliche Regulierung des Bankensektors befürwortete. Denn: Er wusste aus eigener Erfahrung um die Gefahr, dass „einige wenige“ ihre Freiheit „so ausüben, dass sie die Sicherheit des ganzen Landes gefährden können“.2
Und doch gelang es den Prophetenjüngern Friedman, von Hayek, den Chicago Boys und anderen, die Politik davon zu überzeugen, dass niemand anderes als die „unsichtbare Hand des Markt“ am besten wisse, wie Ressourcen weltweit zugeteilt werden sollten – eine Folgerung der Efficient Market Hypothesis. Und so unternahmen es Politiker wie Margaret Thatcher, Ronald Reagan und andere, Regulationen abzubauen und ‚den Märkten‘ bislang ungekannte Freiheiten zu eröffnen.
Nach dem Wegfall staatlicher Regulierungen verloren auch die ‚zunfteigenen‘ Handelsplätze, die Börsen, an Bedeutung. Diese wurden einst gegründet, um dem Handel verlässliche Rahmenbedingungen zu geben und dadurch Kaufen und Verkaufen berechenbar zu machen, indem Käufern und Verkäufern gleicher Wissensstand gesichert und Abläufe transparent gemacht werden sollten. Aber bald entdeckten einige, dass man außerhalb der Börse noch schnellere und riskantere Geschäfte tätigen konnte, die entsprechend höhere Gewinne versprachen. Dieser außerbörsliche ‚Telefonhandel‘ (alias Over-the-counter- oder OTC-Handel) ist möglich für jeden, der per Internet und Telefon Zugang zu elektronischen Handelsplattformen (multilateral trade facilities) hat. So entstand der „Schattenbankensektor“, in dem Hedgefonds, Investmentfonds, Private-Equity-Firmen, private Geldverleiher und ähnliche ihre Anlagen tätigen.
Der Siegeszug von Computern brachte den nächsten Quantensprung: Es entstand der computerbasierte Hochfrequenzhandel, das sogenannte Algo-Trading. Der Name kommt von den Algorithmen, mit denen Händler die Kauf- und Verkaufsentscheidungen von Computern programmieren und wodurch Handelsbewegungen mit großem Volumen und hoher Geschwindigkeit durch miteinander kommunizierende Computer getätigt werden.
Aber noch mehr wurde getan, um Profite zu erzielen. Findige Experten entwickelten ein „innovatives Finanzprodukt“ nach dem anderen, was zur Folge hat, dass der Finanzsektor sich zunehmend zu einer eigenen Verdienstquelle entwickelt. Das begann mit etwas, das anfänglich sinnvoll war, etwa ein Future zur Absicherung von Wechselkursschwankungen im Terminhandel. Dieses Future wurde nun wiederum beliehen, verkauft und gekauft oder versichert, in abgeleitete (von lateinisch „derivare“) und „komplex strukturierte Produkte“ verpackt, die wiederum gekauft, verkauft oder versichert werden können usw. Schlussendlich wurden diese Produkte derart komplex, dass weder die Emittenten noch die Händler noch die Käufer den Überblick bewahrten, was sie nun eigentlich kauften und wer wem etwas schuldete.
Folgen
Der schwer kontrollierbare Schattenbankensektor wuchs und wächst rapide, auch heute noch, denn: Je stärker die Regierungen der Welt versuchen, den Finanzmarkt zu regulieren, desto mehr Handelsaktivitäten werden in diesen intransparenten Markt verlegt, entsprechend steigt sein Umsatzvolumen:
– In den USA werden über den Schattenbankensektor mit 16 Billionen US$ schon jetzt mehr Kredite vergeben als über den regulären Bankensektor (13 Billionen US$),
– Das weltweite Volumen des Schattenbankensektors stieg von 25 Billionen US$ (2002) auf 60 Billionen US$ (2010),3
– Auch China hat ein Problem mit dem Schattenfinanzsektor und zwielichtigen Kreditgebaren: Hier wird der Sektor auf 400 Milliarden US$ geschätzt – das sind zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Da aber viele Kredite an Kleinunternehmer zu Wucherzinsen gingen, stehen ganze Wirtschaftszweige auf der Kippe. In der Tageszeitung Die Welt war am 14.10.2011 unter der Überschrift „China taumelt dem großen Finanzcrash entgegen“ zu lesen: „Da gleichzeitig auch das offizielle Bankenwesen Chinas in heftigen Turbulenzen steckt, könnte dies in einem Schneeballeffekt zu einer Finanzkrise in dem Land führen, die solche Ausmaße hätte, dass das Griechenland-Problem im Vergleich dazu ein Sonntagsspaziergang gewesen wäre. Die Regierung hat daher in den vergangenen Tagen hektische Maßnahmen ergriffen – ob sie helfen, darf bezweifelt werden.“
Das Geschehen auf den Finanzmärkten löst sich zunehmend von der Realwirtschaft, das heißt dem Bereich der Wirtschaft, wo reale Güter erzeugt und Dienstleistungen erbracht werden. „Das Volumen der Devisentransaktionen (ist inzwischen) fast 70 Mal so hoch wie jenes des gesamten Welthandels mit Gütern und Dienstleistungen. In Deutschland, Großbritannien und den USA ist das Volumen des Aktienhandels annähernd 100 Mal höher als jenes der Unternehmensinvestitionen, und der Handel mit Zinsinstrumenten (Anleihen, Schatzscheine etc.) übersteigt das Volumen der gesamten Realinvestitionen in noch größerem Ausmaß.“4 Nach einer Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich werden jeden Tag weltweit Devisen und darauf basierende Derivate für 4 Billionen US$ gehandelt, eine Steigerung um 20% von 2007 bis 2010.5 Das Volumen von weltweit gehandelten Derivaten lag am 31.12.2010 bei 601,048 Billionen US$.6 Zum Vergleich: Das Weltsozialprodukt (gross world product) 2010 betrug 63,170 Billionen US$.7
Der Computerhandel mit seinen Entscheidungen im Nanosekundentakt überfordert zunehmend die Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten der menschlichen Akteure in den Handelsplätzen der Welt, etwa, wenn es zum Flash crash kommt: Dazu kommt es, wenn computergesteuerte Kauf- und Verkaufsprogramme Kauf- und Verkaufswellen in Gang setzen können, bevor der Mensch oder die Börsenaufsicht verstehen, was geschieht, und entsprechend eingreifen können. Bekannt war ein Ereignis am 06.05.2010, wo um 14:25 Uhr durch eine Verkaufsorder des Investmentfonds Waddel & Reed Financial innerhalb allerkürzester Zeit der Dow Jones Index um fast 1000 Punkte (das sind neun Prozent!) abstürzte, was erst durch Aussetzung des Handelsgeschehens aufgefangen werden konnte. Solche Situationen belegen zudem, dass an den Börsen keine rationalen Entscheidungen mehr getroffen werden, sondern nach ‚Gefühlslage‘ entschieden wird, vor allem, indem man sich an Trends einfach nur deshalb anhängt, um sie nicht zu verpassen.
Durch Anlageverhalten, Beteiligungen, Kauf und Verkauf von Unternehmensbeteiligungen sind Finanzmarktakteure von einer Größe und Komplexität entstanden, dass sie inzwischen als „SIFIs“ (Systemrelevante Internationale Finanzinstitutionen) bezeichnet werden, bei denen die Gefahr besteht, dass deren Probleme ganze Staaten oder gar Wirtschaftsregionen beeinträchtigen. Einer aktuellen Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich zufolge kontrollieren 147 Finanzkonzerne, das bedeutet 1,7% der multinationalen Unternehmen, über ihre direkten und indirekten Beteiligungen ungefähr 80% der weltweiten Umsätze. Dabei sind bekannte Namen, wie etwa die Nummer 1, die Barclays Bank, aber auch eher unbekannte Namen, wie etwa die Nummer 2, die Capital Group Companies, die Beteiligungen in Höhe von 1 Billion US$ verwaltet.8 Demgegenüber ist der weltweite Reichtum geradezu egalitär verteilt: Hier verteilen sich 80% auf fünf bis zehn Prozent der Besitzenden. Es ist offensichtlich, welche Macht eine derartige Konzentration gegenüber der Politik hat.
Dabei geht es in den Finanzkrisen nicht nur um die weltweite Vernichtung von ‚Vermögen‘ jener, die Geld für Anlagen haben. Es geht auch um reale Jobs und um Lebensmittel.
Mit den Banken geriet die Weltkonjunktur insgesamt ins Schleudern. Import, Export, Investitionen und Konsum gingen zurück, was Arbeitsplätze kostete oder Kurzarbeit und Gehaltseinbußen nach sich zog, was wiederum die Inlandsnachfrage beeinträchtigte, was die Konjunktur und Arbeitsmarktsituation erneut negativ beeinträchtigte usw. Die Weltfinanzkrise vernichtete nach Schätzungen von IWF und ILO 30 000 000 gut bezahlte Arbeitsplätze. Am meisten natürlich dort, wo überhaupt Jobs sind, aber auch dort, wo die Jobsituation ohnehin schon schlecht ist.9 Besonders hart betroffen waren exportorientierte Länder: In Sambia wurde beispielsweise ein Drittel aller Jobs in der Kupferindustrie vernichtet, einem Land ohne Arbeitslosen- und Sozialversicherung, wo jeder Job zwischen 15 und 25 Familienmitglieder ernähren muss.10 Verschärft wird die Situation dort, wo viele Jugendliche heranwachsen und Jobs suchen. Der UNICEF-Jahresbericht 2011 weist darauf hin, dass weltweit 81 000 000 Jugendliche arbeitslos waren, soviel wie noch nie zuvor, dass aber nirgends die Situation so schlimm sei wie in Nordafrika, wo bis zu 25% aller Jugendlichen betroffen sind.11
Auch der Welthunger stieg wieder an, und dies, obwohl eigentlich niemand bestreitet, dass es auf der Erde genügend zum Essen gibt. Die Preissteigerungen begannen ab der zweiten Hälfte 2007, als viele Investoren ihre Gelder in den Gütermarkt und dort beispielsweise gehandelte „Agrarrohstoffe“ umlenkten, um anderweitige Verluste ausgleichen zu können. Entsprechend berichtet der aktuelle Foodwatch-Report, dass zum März 2011 600 Milliarden US$ durch Versicherungen, Pensionsfonds und andere Anleger in Papiere investiert waren, die Investmentbanken und Hedgefonds für Wetten mit Rohstoffen, darunter Mais und Weizen, aufgelegt haben.12 Damit unterliegen nun auch Agrarrohstoffe den Preisschwankungen, die computergesteuerte Handelssysteme erzeugen, inklusive heftiger Preissteigerungen, die, je nach Berechnungsgrundlage, in den letzten Jahren zwischen 100% und 150% liegen.13 Hinzu kommt, dass Nahrungsmittelpreise in armen Haushalten ganz anders zu Buche schlagen als in reichen Haushalten: Während in einem Industrieland Nahrungsmittel typischerweise 10% bis 20% der monatlichen Haushaltsausgaben umfassen, liegt ihr Anteil in armen Ländern bei 60% bis 80%. Steigen Grundlebensmittel auf dem Weltmarkt um 50%, macht dies im Haushaltsbudget reicher Länder eine sechsprozentige, in armen und Lebensmittel importierenden Ländern eine 21%ige Steigerung aus.14
Welche Auswirkung eine Kombination von Arbeitslosigkeit und überteuerten Lebensmitteln haben kann, haben der Arabische Frühling und die Aufstände in Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen und Ägypten gezeigt, wo bei den Ursachen auch überteuerte Lebensmittel und hohe Arbeitslosigkeit eine Rolle gespielt haben. Aber: Auch in reichen Ländern kommt es angesichts der Auswirkungen zunehmend zu teilweise gewalttätigen Protesten gegen die Sparpolitik der Staaten, die zugunsten der Banken und zulasten der Bürger geht: Was in Athen und London passierte, kann morgen in Paris, Berlin und Spanien geschehen – gerade in Spanien, wo die Jugendarbeitslosigkeit inzwischen bei unvorstellbaren 45% liegt.
Technische Lösungsansätze
Natürlich sind sich alle darüber im Klaren, dass ‚man etwas tun muss‘. Und natürlich gibt es technische Lösungsansätze, mit denen im nationalen, europäischen und internationalen Kontext versucht wird, die schlimmsten Auswüchse der gegenwärtigen Krisen zu mildern oder gar aufzufangen. Einige Beispiele sind:
– Einschränkung des Eigenhandels der Banken, also des Handels der Banken ohne Kundenauftrag,
– Erhöhung des Eigenkapitals bei Banken, um sie weniger abhängig von öffentlicher Stützung zu machen,
– Einschränkung des Computerhandels,
– Verbot von ungedeckten Leerverkäufen und Kreditausfallsversicherungen, die etwa beim Spekulieren gegen den Staatsbankrott eine wichtige Rolle spielten,
– Transparenz des Schattenbankensektors,
– Ermöglichen von Bankeninsolvenzen, um Risiken, die von systemrelevanten Banken ausgehen, zu verringern,
– Verbot des Handels mit Lebensmitteln,
– Und so weiter.
Probleme beim Gegensteuern
Freilich: Ein Gegensteuern ist, selbst wenn man weiß, wie es laufen könnte, nicht so leicht umzusetzen: Staaten haben es extrem schwer, die Deregulierung rückgängig zu machen, selbst dort, wo sie entschlossen dazu sind. Staaten sind an Gesetz und Verträge gebunden sowie demokratischer Kontrolle unterworfen, was ihr Vorgehen deutlich erschwert im Vergleich zu Kapitalgesellschaften, deren Vorstände wichtige Entscheidungen hinter verschlossenen Türen fällen können und bestenfalls einmal im Jahr ihren Aktionären und Anlegern Rechenschaft geben müssen. Konkret: Den eben erwähnten 147 Mega-Finanzmarktakteuren, die über eine gemeinsame Unternehmenskultur und grenzübergreifende Strukturen verfügen, stehen 194 politische Staaten gegenüber, die durch politische, gesellschaftliche, rechtliche, kulturelle und so weiter Unterschiede charakterisiert sind und sich entsprechend schwertun, bei irgendetwas zu kooperieren. Das zeigen weltweit beispielsweise die Positionen innerhalb der G20, wo Länder wie Brasilien, Indien oder China die Weltfinanzkrise (nicht zu Unrecht!) primär für ein Problem der westlichen Staaten erklären. Dann gibt es innerhalb der westlichen Staaten die unterschiedlichen Kulturen des angelsächsischen und des kontinentaleuropäischen Bankensystems, dann gibt es wiederum das sehr spezielle deutsche Dreibankensystem mit Sparkassen, Privat- und Genossenschaftsbanken.
Darüber hinaus darf man die Macht und den aktiven Widerstand der Finanzmarktakteure gegen alle Versuche, seine Profitabilität zu beschneiden, nicht unterschätzen. Verbündete haben sie durch Vertreter der universitären Lehrstühle, die immer noch der ‚orthodoxen neoliberalen Mainstream-Lehre‘ anhängen, durch Minister oder Mitarbeiter in Regierungsbehörden, die zuvor im Finanzsektor gearbeitet haben und deren Tür entsprechenden Lobbyisten weit offen steht,15 oder durch Redakteure einschlägiger Fachzeitungen. Die Regierungen nicht nur der USA und Großbritanniens stehen unter enormem Druck der Finanzmarktakteure, die drohen, ihre Geschäfte dorthin zu verlagern, wo man sie weiterhin ungestört lässt.
Und schließlich muss man die menschliche Natur nüchtern einschätzen: Es wird immer Leute und Institutionen geben, die machen, was mangels Kontrolle möglich ist, bevor es jemand anders macht, und so weiter.
Aber selbst wenn es einer nennenswerten Anzahl von Regierungen gelingen würde, eine Reihe der vorgenannten technischen Lösungsansätze umzusetzen, besteht die Gefahr, dass es sich dabei nur um Lückenstopfen und Flickwerk handelt.
Grundsätzliche Fragen
Viel grundsätzlicher wäre zu fragen, wie denn eine gerechtere, funktionsfähige, alternative gesellschaftspolitische Ordnung aussehen könnte, nachdem die reine Planwirtschaft (Sozialismus, Kommunismus) ebenso versagt hat wie die reine Marktwirtschaft. Bundeskanzlerin Merkel preist, etwa auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2009, nicht zu Unrecht die Soziale Marktwirtschaft als „dritten Weg“ an, die der Nachkriegs-Bundesrepublik zu großem Wohlstand verholfen hat und die zu wesentlichen Teilen aus der Katholischen Soziallehre inspiriert wurde. „Der Staat ist der Hüter der sozialen Ordnung, aber Wettbewerb braucht Augenmaß und soziale Verantwortung“, so Merkel.16
Aus ethischer Perspektive darf jedoch nicht übersehen werden, dass auch dieser Ansatz mit Nachteilen behaftet ist. Um nur einen zu nennen: Auch die Soziale Marktwirtschaft konnte nicht verhindern, dass national und weltweit Einkommen und Vermögen immer weiter auseinandergedriftet sind. Das Vermögen der sogenannten „High Net Worth Individuals“ stieg 2010 auf einen neuen Höchststand: Weltweit besaßen 10,9 Millionen Menschen ein Vermögen von 42,7 Billionen US$, während immer noch nahezu eine Milliarde Menschen Hunger leiden.17 Ein Grund dafür ist sicher auch, dass ein wichtiger Aspekt der Katholischen Soziallehre, nämlich die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, nie wirklich umgesetzt wurde. Zurückgehend auf die angelsächsische Tradition stand und steht Eigentum in der Verfügung des Individuums. Vom durch unternehmerisches Handeln gemehrten Reichtum profitieren die Armen etwa durch den trickle-down-effect oder durch die Ausübung sozialer Verantwortung in freier Entscheidung, zum Beispiel durch Almosen oder Stiftungen. In der Tradition der Katholischen Soziallehre würde das Solidaritätsprinzip „der Gemeinschaft die Befugnis ein(räumen), nicht allein den Gebrauch, den der Eigentümer von seinem Eigentum machen darf, sondern das Eigentum selbst ... so zu ordnen, dass das Eigentum nicht nur seine Individual-, sondern seine Sozialfunktion erfüllt.“18 Es darf bezweifelt werden, dass ernst zu nehmende Versuche in dieser Richtung in einer demokratischen Gesellschaft mehrheitsfähig wären.
Ausblick
Es bleibt die Frage, wie trotz aller Komplexitäten und Widrigkeiten zumindest angefangen werden kann, dem Finanzmarkt wieder Regeln aufzuerlegen und das dort Geschehende wieder an den Nutzen für das Gemeinwohl rückzubinden. Nach all den Problemen, die es innerhalb der G20 gibt, legt sich nahe, zumindest für die Europäische Union einen entschiedenen Anlauf zu versuchen. Und dies aus zwei Gründen:
Zum einen ist die EU immer noch der weltgrößte Wirtschaftsraum, vielleicht sogar der weltgrößte Konsumraum. Das gibt Gewicht, um den Märkten Regeln aufzuerlegen, denn: Finanzmarktakteure werden sich gründlich überlegen, ob sie sich aufgrund beschlossener Regulierungen endgültig aus diesem Wirtschaftsraum verabschieden.
Sodann ist innerhalb der Europäischen Union, im Unterschied zu China und den USA, der demokratische Rückhalt für solche Reformen größer (siehe auch Boecker in diesem Band). Ebenso sind die Beziehungen, die Zivilgesellschaft und Kirchen zu Parteien und Parlamenten haben, besser geeignet, einschneidende Maßnahmen auf den Weg und zur Abstimmung zu bringen. Die Chance der gegenwärtigen Krise könnte zudem sein, dass der Zwang zur Zusammenarbeit der Europäischen Union ein Plus an Demokratie und Transparenz bringt, welches die Akzeptanz in der Bevölkerung nochmals erhöhen dürfte.
Anmerkungen
1 Caprio, Gerard / Klingebiel, Daniela (1996) Bank Insolvencies: Cross Country Experience. Policy Research Working Paper No. 1620. Washington: World Bank.
2 Kapitel II.i, Seite 94.
3 Zu diesen beiden Punkten Neue Zürcher Zeitung vom 02.11.2011: „Schattenbanken im Visier der G20“.
4 Schulmeister, Stephan (2009) Tobin or not Tobin? Die Finanztransaktionssteuer – Konzept, Begründung, Effekte. In: Informationsbrief Weltwirtschaft & Entwicklung. Dezember 2009.
5 ntv (Nachrichtenfernsehen) vom 01.09.2010: „Devisenhandel schwillt an“.
6 Neue Zürcher Zeitung vom 18.05.2011: „Leicht höheres Derivate-Volumen“.
7 CIA-Factbook (2011) Chapter „Economy, Overview“. Internet: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
8 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Hg.) (2011) The Network of Global Corporate Control. Internet: http://arxiv.org/abs/1107.5728
9 IMF/ILO (Hg.) (2010) The Challenges of Growth, Employment and Social Cohesion. Discussion document. (Seite 4.) Internet: http://www.osloconference2010.org/discussionpaper.pdf
10 Green, Duncan (2009) A Copper Bottomed Crisis. The Impact of the Global Economic Meltdown on Zambia. Oxfam International Discussion Paper. Internet: http://www.oxfam.org.uk/ resources/policy/economic_crisis/downloads/ impact_economic_crisis_%20zambia.pdf
11 UNICEF (2011) The State of the World’s Children 2011 – Adolescence, an Age of Opportunity. (Seite 46.)
12 Foodwatch (Hg.) (2011) Die Hungermacher – Wie Deutsche Bank, Goldman-Sachs & Co auf Kosten der Ärmsten mit Lebensmitteln spekulieren. (Seiten 13 und 36 f.) Internet: http://www.foodwatch.de/kampagnen_themen/nahrungsmittel/ report_die_hunger-macher/index_ger.html
13 Siehe ebenfalls Foodwatch, Seite 12: Zunahme von 150% bei Weizen, Mais und Reis.
14 Wahl, Peter (2008) Food Speculation: The Main Factor behind the Price Bubble in 2008. WEED Briefing Paper.
15 Die Verquickung von Regierungsposten und wichtigen Jobs im Finanzsektor ist besonders offensichtlich und wird viel kritisiert in den USA, siehe etwa New York Times vom 17.10.2009: „The Guys from ‚Government Sachs‘ “.
16 Focus vom 31.01.2009: „Soziale Marktwirtschaft als Exportschlager“.
17 „HNWIs“ sind Personen mit einem „investierbaren Vermögen“ von 1 Million US$ oder mehr. In: Capgemini/Merill Lynch Wealth Management (Hg.) World Wealth Report 2011. (Seite 4.) Die FAO schätzte die Zahl der Hungernden 2010 auf 925 Millionen (Pressemitteilung vom September 2010).
18 Nell-Breuning, Oswald von (1968) Baugesetze der Gesellschaft. Freiburg: Herder. Seite 76.