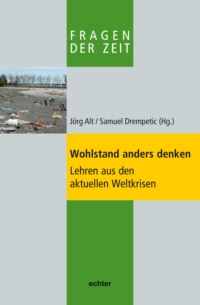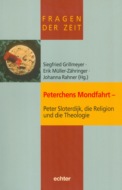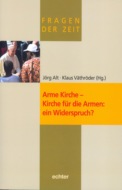Kitabı oku: «Wohlstand anders denken», sayfa 3
Gerhard Berz
Klimawandel und Naturkatastrophen –
Risiken und Handlungsnotwendigkeiten aus wirtschaftlicher Sicht
Die Schadenbelastungen aus Wetterkatastrophen nehmen weltweit drastisch zu. Die Ursachen sind in erster Linie steigende Bevölkerungs- und Wertekonzentrationen, gerade auch in stark exponierten Regionen, und eine erhöhte technische und wirtschaftliche Verwundbarkeit. Gleichzeitig gewinnt der rasch voranschreitende Klimawandel immer größeren Einfluss auf die Häufigkeit und Intensität von Wetterextremen. Dadurch nehmen auch die Schadenpotenziale extremer Wetterkatastrophen stark zu. In dieser kritischen Situation kommt es darauf an, das von der Menschheit ausgelöste Klima-‚Experiment‘ durch eine radikale Verringerung der Treibhausgasemissionen rasch in den Griff zu bekommen. Da der Klimawandel aber auf absehbare Zeit nicht mehr zu stoppen, sondern bestenfalls zu verlangsamen ist, müssen umgehende, nicht zuletzt auch finanzielle, Vorsorgemaßnahmen zur Anpassung an die erwarteten neuen Klimaverhältnisse und ihre Auswirkungen ergriffen werden.
Katastrophentrends und ihre Ursachen
Die Zunahme der Schäden aus Naturkatastrophen, die seit Jahrzehnten weltweit beobachtet und von der Versicherungswirtschaft akribisch dokumentiert wird, zählt zu den ersten und stärksten Indizien für die Auswirkungen der globalen, von der Menschheit verursachten Umweltveränderungen. Darüber herrscht breiter Konsens sowohl in Wissenschaft und Wirtschaft als auch in der Politik, den Medien und nicht zuletzt in der Bevölkerung. Dabei spielt die augenfällige Häufung von Wetterkatastrophen in Form von Stürmen, Überschwemmungen, Unwettern, Hitzewellen und Waldbränden eine wesentliche Rolle. Der Grund: Sie sind fast immer auf außergewöhnliche, oft sogar nie zuvor registrierte Extremwerte meteorologischer Größen wie Temperatur, Niederschlag und Wind zurückzuführen.
Das spiegelt sich besonders deutlich in den Statistiken und Analysen der Naturkatastrophen wider, welche die Münchener Rück, jetzt Munich Re, seit vielen Jahren auf der Basis ihrer detaillierten weltweiten Erhebungen veröffentlicht.1 Hier zeigt sich beispielsweise: Von den fast 20 000 Naturkatastrophen, die zwischen 1980 und 2010 ausgewertet wurden (siehe Abbildung 1), waren nur 14% Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis, also Naturereignisse, die ihren Ursprung in der Erdkruste haben. Auf sie hat der Mensch, nach allem, was wir wissen (und hoffen können), kaum Einfluss. Der ganz große Rest, nämlich etwa sechs von sieben Naturkatastrophen, entstammt der Atmosphäre – und hier besteht aller Grund zu der Befürchtung, dass sich der globale Klimawandel gerade hier immer stärker auswirkt.

Wetterextreme in allen ihren Ausprägungen sind besonders kritisch. Sie treten vergleichsweise selten auf und wir sind deshalb schlecht darauf eingestellt. Das zeigt sich bei den Schadenwirkungen dieser Extremereignisse, ob bei den Opferzahlen, wo weit über die Hälfte auf Wetterkatastrophen entfallen, oder den volkswirtschaftlichen Schäden (78%) und ganz besonders den versicherten Schäden (90%); dort schlägt sich die weltweit hohe Versicherungsdichte bei Sturmschäden nieder.
Vergleicht man die Zahlen der vergangenen Jahrzehnte (siehe Abbildung 2), wird die ganze Dramatik offenbar: Wetterkatastrophen in Form von Stürmen, Unwettern, Überschwemmungen et cetera treten dreimal so häufig auf wie noch Anfang der 1980er-Jahren, während die geophysikalischen Katastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis nur leicht zugenommen haben.
Die generelle Katastrophenzunahme geht zum überwiegenden Teil auf eine Reihe sozioökonomischer Faktoren zurück:
1. Die unverminderte globale Bevölkerungszunahme ist
der ‚Motor‘ der Entwicklung: Bis Mitte des Jahrhunderts wird die Weltbevölkerung, wenn keine unvorhersehbaren Einschnitte passieren, um bis zu weitere 3 Milliarden Menschen auf 9 bis 10 Milliarden anwachsen.

2. Verstädterung und steigender Lebensstandard führen in den meisten Regionen der Welt dazu, dass sich immer mehr Menschen und materielle Werte auf engstem Raum konzentrieren, insbesondere in den großen Ballungsräumen, den sogenannten Megacitys. Hier entwickeln sich die größten Zeitbomben. Während es im Jahr 1950 auf der Welt etwa 80 Millionenstädte gab und davon die Mehrzahl in den Industrieländern lag, sind es heute über 400 Millionenstädte, von denen rund 300 in der Dritten Welt liegen.
3. Viele dieser Großstädte liegen in stark exponierten Regionen, beispielsweise an den Küsten und ganz besonders am sogenannten ‚Feuerring‘ rings um den Pazifik, wo sich der größte Teil der weltweiten Erdbeben- und Vulkantätigkeit abspielt und die mit Abstand meisten tropischen Wirbelstürme auftreten. Aber auch in Deutschland ballen sich Siedlungs- und Industriegebiete in bekannten Überschwemmungszonen entlang der Flüsse und Küsten.
4. Moderne Gesellschaften und Technologien sind anfälliger geworden. Das haben ‚Mega‘-Katastrophen wie der Hurrikan „Katrina“ 2005 in New Orleans und das Erdbeben von Japan 2011 deutlich gemacht. Dabei galt Japan bisher als eines der am besten auf Erdbeben und andere Katastrophen vorbereiteten Länder der Welt. Es stellt sich die bange Frage, was passieren wird, wenn sich eines Tages das ‚große Kanto-Beben‘ von 1923 in Tokio, der größten Metropolregion der Welt, wiederholen wird.
5. Und schließlich kommt man nicht an den Folgen der globalen Umweltveränderungen vorbei. Überall auf der Erde hinterlässt die Menschheit immer größere Spuren. Ob es die Überfischung der Meere, die Übernutzung der Wasserressourcen, die Zerstörung der Böden, die Abholzung der Urwälder oder die Verringerung der Artenvielfalt ist – wo man auch hinsieht, verändert und zerstört die Menschheit zunehmend die Umwelt. Der menschgemachte Klimawandel hat dabei eine besondere Dimension, weil er sich wirklich global auswirkt und gleichzeitig noch viele Generationen nach uns in Mitleidenschaft ziehen wird.2
Klimawandel und Wetterextreme
Die Veränderungen in Exponierung und Vulnerabilität reichen nicht aus, die ganze Zunahme der Katastrophenschäden zu erklären. Das hat die Münchener Rück in ihrem Millenniumsbericht zur Entwicklung der Naturkatastrophen im letzten Jahrtausend nachgewiesen.3 Vielmehr weisen immer mehr Indizien darauf hin, dass die globalen Umweltveränderungen, allen voran der Klimawandel, zunehmend die Häufigkeit und Intensität von Wetterkatastrophen beeinflussen. Auch der vierte Statusbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change misst dem Zusammenhang zwischen der globalen Erwärmung und der Häufigkeit atmosphärischer Extremereignisse herausragende Bedeutung bei.4
Denn genau hier werden die Folgen des globalen Klimawandels besonders deutlich sichtbar: Schon eine relativ kleine Verschiebung der Mittelwerte kann dazu führen, dass sich die Überschreitungswahrscheinlichkeiten kritischer Schwellenwerte drastisch erhöhen. Selbst eine harmlos erscheinende Erhöhung von saisonalen Mitteltemperaturen kann dabei enorme wirtschaftliche Konsequenzen haben. Der Hitzesommer 2003 in West- und Mitteleuropa hat das auf dramatische Weise bestätigt: Die großräumigen um mehr als 3 °C (teilweise sogar bis zu 6 °C) höheren Mitteltemperaturen verursachten riesige Waldbrände und Dürreschäden in Land- und Forstwirtschaft, große Einnahmeausfälle in der Flussschifffahrt und krisenhafte Engpässe bei der Elektrizitätsversorgung. Die wirtschaftlichen Schäden beliefen sich auf über 10 Milliarden Euro und machen – vor allem auch wegen der über 70 000 zusätzlichen Todesfälle – dieses extreme Witterungsereignis zu einer der größten Naturkatastrophen in Europa seit Jahrhunderten. Setzt sich der Erwärmungstrend wie erwartet fort, dann könnte ein derartiger Sommer in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mehr oder weniger zum Normalfall werden. Eisverkäufer, Biergartenwirte, Getränkeindustrie und Klimaanlagenhersteller werden das gerne hören. Aber andere Bereiche der Wirtschaft, insbesondere die Land-, Forst- und Energiewirtschaft, müssen sich auf erhebliche Probleme einstellen, für die sie sich schon jetzt geeignete Anpassungs- und Vorsorgestrategien überlegen sollten.
Gleichzeitig sind heißere Sommer meist auch unwetterträchtiger: Durch die Überhitzung werden konvektive Prozesse in der Atmosphäre verstärkt und es verschärfen sich die Gegensätze zwischen kontinentalen und maritimen Luftmassen, da letztere der Erwärmung aufgrund der thermischen Trägheit der Ozeane hinterherhinken. Die Kaltfronten, hinter denen die kühlere Meeresluft immer wieder aufs Festland vorstößt und dort die Hitzelagen beendet, beziehen aus diesen Luftmassengegensätzen ihre Energie und überziehen das Land mit Gewittern, Hagelschlägen und Starkwinden.
Die immer heftigeren Sommergewitter bringen außerdem stärkere Sturzfluten mit sich. Trotz tendenziell geringerer Sommerniederschläge können dabei lokal und kurzzeitig außerordentlich hohe Regenmengen niedergehen. In Städten und Gemeinden überfordern sie dann häufig die darauf nicht ausgelegten Kanalisationsnetze; in hügeligem oder bergigem Gelände lösen sie plötzliche Überflutungen sowie Muren und Erdrutsche aus. Die zunehmende Niederschlagsvariabilität erhöht also im Sommer sowohl das Trockenheits- als auch das Überschwemmungsrisiko – ein nur auf den ersten Blick paradox erscheinender Trend.
Heiße Sommer und schneearme Winter führen zu einem immer stärkeren Zurückschmelzen der Alpengletscher, mit erheblichen Konsequenzen für die Abflussverhältnisse in den Alpentälern ebenso wie in allen großen Flüssen, die in den Alpen entspringen. Hier haben wir langfristig starke saisonale Abflussschwankungen zu erwarten: erhöhte Werte im Winter und Frühjahr, stark verringerte im Sommer und Herbst. Durch den Anstieg der Schnee- und (Perma-)Frostgrenze werden zudem vermehrt Erdrutsche, Muren, Felsstürze und Gletscherseeausbrüche auftreten.
Im Winter zeichnet sich zudem eine Verstärkung der Sturmgefahr in West- und Mitteleuropa ab. Steigende Temperaturen verhindern hier im Flachland immer öfter eine großräumige Schneedecke, wie sie früher in den strengeren Wintern regelmäßig auftrat. Über ihr konnte sich vielfach ein stabiles Kältehoch bilden. Das wirkte dann wie eine Barriere gegen die vom Nordatlantik heranziehenden Sturmtiefs und lenkte sie überwiegend in höhere Breiten ab, bevor sie die dicht besiedelten Küstenzonen Westeuropas treffen konnten. Je milder die Winter werden, desto weiter scheinen sich die kontinentalen Kältehochs nach Osten zurückzuziehen, sodass die Sturmtiefs jetzt häufiger und tiefer aufs Festland vorstoßen können. Das hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten vor allem in West- und Mitteleuropa zu einer Reihe gewaltiger Sturmkatastrophen geführt (zum Beispiel die Orkane „Daria“, „Vivian“ und „Wiebke“ 1990, „Anatol“, „Lothar“ und „Martin“ 1999 sowie „Kyrill“ 2007).
Bei den tropischen Wirbelstürmen, den Hurrikanen, Taifunen und Zyklonen, ist die ‚Beweislage‘ bisher umstritten: Eine Gruppe von Wissenschaftlern verweist auf die Wasseroberflächentemperatur von 26 °C bis 27 °C, die als Voraussetzung dafür gilt, dass sich tropische Wirbelstürme entwickeln können. Erwärmen sich die Ozeane, dann wird diese kritische Oberflächentemperatur über immer größeren Meeresgebieten und in immer längeren Zeiträumen überschritten; das deutet auf eine steigende Anzahl von Wirbelstürmen hin. Eine andere Gruppe stützt sich auf Modellrechnungen und vertritt die Meinung, es sei eher mit einem Anstieg der potenziellen Intensität der Sturmwirbel zu rechnen. Sie belegt dies insbesondere mit den Beobachtungen der letzten Jahrzehnte im Nordatlantik, die dort eine deutlich erhöhte Anzahl vor allem der sehr starken Hurrikane zeigen. Eine dritte Gruppe hält schließlich den Einfluss der Klimaänderung für gering im Vergleich zu den starken natürlichen Schwankungen von Häufigkeit und Intensität, beispielsweise in Verbindung mit den pazifischen El-Niño- / La-Niñaoder den atlantischen NAO-Episoden (North Atlantic Oscillation). Dabei verweist sie auf die hohe Hurrikanaktivität im Nordatlantik während der 1950er- und 1960er-Jahre, die nach einer wesentlich ruhigeren Phase in den 1970er- und 1980er-Jahren erst Mitte der 1990er-Jahre wieder erreicht und inzwischen deutlich übertroffen wurde.
Fasst man die Verbindungen zwischen der globalen Erwärmung und verschiedenen Auswirkungen zusammen, ergibt sich eine lange Liste mehr oder weniger gut abgesicherter Veränderungen, die schon heute in die mittel- und langfristigen Vorsorgeüberlegungen einbezogen werden sollten.

Daneben existieren aber noch zahlreiche Rückkoppelungsmechanismen in der Atmosphäre, den Ozeanen, der Kryosphäre und den Böden, von denen die Wissenschaft bisher zum Teil noch recht unsichere Vorstellungen hat. Eines der größten Fragezeichen steht hinter den möglichen Reaktionen der Ozeane, die für die weitere Entwicklung der globalen Umweltveränderungen von entscheidender Bedeutung sein können. Große Überraschungen sind deshalb vorprogrammiert. Umso wichtiger erscheint es, dass die Menschheit das ‚Experiment mit dem Planeten Erde‘, das bisher völlig außer Kontrolle abläuft, so rasch wie möglich in den Griff zu bekommen versucht. Andernfalls könnten die unmittelbaren Auswirkungen in Form von Naturkatastrophen und die langfristigen Folgen wie die Verschiebung von Klimazonen und der steigende Meeresspiegel zu einer existenziellen Bedrohung für große Teile der weiter stark wachsenden Weltbevölkerung werden.
Klimaschutz und Anpassungsstrategien aus wirtschaftlicher Sicht
Diese Konsequenzen des Klimawandels erfordern umgehende Klimaschutz- und Anpassungsstrategien, die auch die Verantwortung der Industrieländer für die entstandene Klimaproblematik gegenüber den Ländern der Dritten Welt deutlich machen. Mit Blick auf die sich zuspitzende Verknappung und Verteuerung fossiler Energieträger liegen dabei alle Energiesparstrategien „auf der sicheren Seite“ und sind gleichzeitig der wichtigste und am schnellsten umzusetzende Beitrag zum Klimaschutz. In einer umfassenden Studie des früheren Chefökonomen der Weltbank, Nicholas Stern, wurden die Kosten eines ungebremsten Klimawandels auf 5% bis 20% der globalen Wirtschaftsleistung pro Jahr geschätzt, während nachhaltige Klimaschutzmaßnahmen nur etwa ein Prozent pro Jahr kosten würden.5 Dass sich Klimaschutz ‚rechnet‘, steht aus ökonomischer Sicht also völlig außer Frage.
Die Versicherungswirtschaft hat die Plausibilität und gleichzeitig die Brisanz dieser Veränderungen längst erkannt.6 Früher als andere Wirtschaftsbereiche hat sie erstmals schon Anfang der 1970er-Jahre auf die Gefahren eines globalen Klimawandels als Folge des ungebremsten Ausstoßes von Treibhausgasen hingewiesen. Sie hat damit auch hier wieder jene besondere Sensibilität für jedwede Änderungen ihres Risikoumfelds unter Beweis gestellt, die wohl ihr wichtigstes Erfolgsrezept darstellt.
Trotz der überwiegend negativen Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft darf nicht übersehen werden, dass die Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Wetterkatastrophen auch neue Marktpotenziale eröffnet. Die Innovationsbereiche in den Versicherungsunternehmen können hier attraktive neue Produkte entwickeln. Für Unternehmen, die sich geschickt positionieren (zum Beispiel mit Hilfe von Umfeldanalysen und Alleinstellungsmerkmalen), können die Auswirkungen des Klimawandels interessante Chancen eröffnen; denn die Nachfrage nach Naturgefahrendeckungen wird weiter deutlich zunehmen.
Da Länder der Dritten Welt von den Auswirkungen des Klimawandels besonders stark betroffen sind (siehe hierzu Müller in diesem Band), die Ursachen dafür aber in erster Linie von den Industrieländern zu verantworten sind, wurde bei den Klimaverhandlungen im Dezember 2008 in Posen der Vorschlag einer Klimaversicherung eingebracht, der Ausdruck einer globalen Solidarität bei der Finanzierung der klimabedingten Schäden ist. Der Vorschlag wurde von der Munich Climate Insurance Initiative (MCII), in der Versicherungsexperten und Vertreter der Weltbank, von Forschungsinstituten und von Nichtregierungsorganisationen kooperieren, entwickelt und soll nun als wichtiges Anpassungs-instrument in dem Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll verankert werden.7
Die Finanzwirtschaft hat längst erkannt, dass sie selbst einen wesentlichen Beitrag zum Schutz des globalen Klimas leisten kann, und hierzu inzwischen zahlreiche Initiativen entwickelt, die sie unter anderem in Kooperation mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen vorantreibt.8 Die größte Wirkung geht dabei von einer Umsteuerung der riesigen Vermögensanlagen aus: weg von umweltschädlichen ‚Dinosaurier‘-Industrien und hin zu nachhaltig umweltfreundlichen Wirtschaftsbereichen. Wie kaum ein anderer Wirtschaftssektor wird sie davon auch selbst profitieren können.
Ausblick
Da wir in Deutschland nicht auf einer ‚Insel der Seligen‘ leben, wo wir von Naturkatastrophen und den Auswirkungen des Klimawandels nicht betroffen wären, sondern im Gegenteil wegen der hohen Bevölkerungsund Wertekonzentrationen mit besonders hohen Schadenpotenzialen konfrontiert sind, haben wir allen Grund, umgehende und umfassende Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. Dabei sind nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern auch jeder Einzelne gefordert, denn nur im Zusammenwirken aller werden wir die notwendige ‚große Transformation‘ von der fossilbasierten Überflussgesellschaft zu einem nachhaltigen Lebensstil schaffen, durch die sowohl der globale Klimawandel noch unter Kontrolle gebracht werden kann als auch die gegenüber den nachfolgenden Generationen unverantwortliche Ausplünderung unseres Planeten vermieden wird. Es steht außer Frage, dass es eher Erfolg verspricht, wenn diese Ziele proaktiv angesteuert werden, als wenn erst unter dem Zwang der Ressourcenverknappung mit Notmaßnahmen reagiert werden muss.
Resümee
Naturkatastrophen nehmen weiter an Zahl und Ausmaß zu. Es wird nur schwer möglich sein, die sozioökonomischen Trends und die Auswirkungen des globalen Klimawandels in absehbarer Zeit so in den Griff zu bekommen, dass diese Zunahme gestoppt wird. Verstärkte Vorsorgemaßnahmen, insbesondere die grundlegende Veränderung der Energieversorgung und unserer Lebensstile, können allerdings den Zunahmetrend verlangsamen und die Folgen abmildern. Die Finanzwirtschaft kann hier nicht nur finanziellen Schutz vor den Schadenwirkungen des Klimawandels bieten, sondern auch aktiv und effizient zum Klimaschutz beitragen.
Anmerkungen
1 Munich Re (Hg.) (2011) Topics Geo – Naturkatastrophen 2010. Internet: http://www.munichre.com/de/reinsurance/ magazine/publications/default.aspx
2 Berz, Gerhard (2010) Wie aus heiterem Himmel? Naturkatastrophen und Klimaänderung – Was uns erwartet und wie wir uns darauf einstellen sollten. München: dtv premium.
3 Münchener Rück (Hg.) (1999) topics 2000 – Jahrtausendrückblick Naturkatastrophen. Internet: http://www.munichre.com/de/reinsurance/magazine/publications /default.aspx
4 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Climate Change 2007 – Summary for Policymakers. Internet: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/spm.html
5 Stern, Nicholas (2006) The Economics of Climate Change – The Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press.
6 Münchener Rück (Hg.) (2004) Wetterkatastrophen und Klimawandel – Sind wir noch zu retten? Edition Wissen.
7 Höppe, Peter / Gurenko, Eugene (2007) Scientific and Economic Rationales for Innovative Climate Insurance Solutions. Climate Policy, 6, Seiten 607–620.
8 United Nations Environment Programme – Finance Initiatives (2002) Climate Risk to Global Economy. CEO Briefing of the Climate Change Working Group. Internet: http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/CEO_briefing_ climate_change_2002_en.pdf
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.