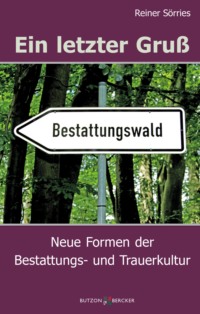Kitabı oku: «Ein letzter Gruß», sayfa 2
Im Sinne von Diversity Management muss die Situation dieser Personenkreise unbedingt mit bedacht werden, um ihre Situation als gesellschaftliche Randsiedler zu verbessern. Bestatter, Friedhofsgärtner und Steinmetze sehen sich zudem mit dem Vorurteil konfrontiert, mit dem Tod anderer Menschen Geschäfte zu machen.
Diskriminierungsmechanismen greifen also sowohl bei jenen, die in der letzten Lebensphase stehen, als auch bei denen, die diesen Weg begleiten und organisieren. Viele Anstrengungen, diese Situation zu verbessern, beruhen auf den Initiativen einzelner Personen, Gruppen oder Institutionen, während sie noch nicht als gesellschaftliches Anliegen gesehen werden.
Da aber heute letztlich jeder sein Recht auf Individualität beansprucht, erlangt die Verschiedenheit als Teil der Identität ihre eigene Bedeutung. Und ein Blick auf diese Verschiedenheit kann dazu beitragen, auch den Wandel der Bestattungs- und Trauerkultur besser zu verstehen, ihn vielleicht sogar als Chance zu begreifen.
III. Gender
Die Verschiedenheit von Frau und Mann ist keineswegs nur eine biologische, sondern auch eine sozial konstruierte, indem dem jeweiligen Geschlecht bestimmte Verhaltensweisen nicht nur zugeschrieben, sondern auch abverlangt werden. Mit diesem Sachverhalt befasst sich nach Anfängen in den 1960er- und 1970er-Jahren in den USA auch in Deutschland seit den 1980er-Jahren die sogenannte Geschlechterforschung als eigene Disziplin, auch hierzulande als Gender Studies bezeichnet.
Das den Geschlechtern traditionell zugeordnete Trauerverhalten kann diesen Sachverhalt verdeutlichen. Auf einer Zeichnung von Rudolf Jordan, darstellend das Begräbnis des jüngsten Kindes von 1857 ist dies prototypisch dargestellt. (Abb. 1)
Während die Frau überwältigt vom Schmerz um das tote Kind in gebückter Haltung die Hände vors Gesicht geschlagen hat, bleibt der Mann aktiv, trägt den Sarg des Kindes und blickt mit offenen Augen nach vorne. Die Frau ist passiv, der Mann aktiv. Das Töchterchen hingegen übernimmt die Rolle des unverständigen Kindes, das die Situation nicht begreift und wie unbeteiligt wirkt.

Abb. 1: Rudolf Jordan, Begräbnis des jüngsten Kindes, 1857
Die Passivität der Frau und die Aktivität des Mannes im Trauerfall spiegeln sich in der Folge auch in der Konvention der Trauerkleidung. Während die Frau über Monate, bisweilen über Jahre Gefangene einer peniblen Trauermode war, beschränkte sich das Tragen von Trauerkleidung beim aktiven Mann auf kurze Zeit, die rasch dem Trauerflor am Ärmel wich, um ihm die Hände fürs Tun frei zu halten.
Diese Rollenzuschreibung an Mann und Frau im 19. Jahrhundert korrespondiert mit dem Sachverhalt, dass das Bestattungsgewerbe in dieser Zeit eine Männerdomäne geworden war. Davor war über viele Jahrhunderte die Frau jene Person, die sich als Begine, als Totenwäscherin, als Seelnonne, als Toten- oder Leichenfrau um die Bestattung der Verstorbenen kümmerte. Die neue Arbeitsteilung im 19. Jahrhundert folgte dem ökonomischen Interesse des Mannes, der als Fuhrunternehmer oder Sargtischler das gesamte Bestattungsgewerbe an sich zog, als es ihm die neue Gewerbefreiheit möglich machte.
Galten diese Rollenverteilungen im 19. Jahrhundert als gegeben und unumstößlich, so wurden sie im Laufe der Emanzipationsbewegung kritisch hinterfragt. Aber es dauerte bis in die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, bis Frauen begannen, ihre Passivität ins Gegenteil zu verkehren. Schließlich wehrten sie sich nicht mehr gegen eine „Trauer als zweifelhaftem Privileg der Frauen“13, sondern erhoben darauf einen geschlechtsspezifischen Anspruch
Den Beginn des Umdenkens kann man ziemlich genau in die 1990er-Jahre datieren, als sich Soziologinnen empirisch und wissenschaftlich damit befassten. Die erste geschlechtsspezifische Untersuchung zum Verhalten von Frauen gegenüber Sterben, Tod und Trauer verfasste in Großbritannien die Biografieforscherin Sally Cline, die u. a. in leitender Position am Institut für Women’s Studies an der Cambridge University tätig war. 1997 erschien ihre Studie „Women Death and Dying“, die unter dem Titel „Frauen sterben anders“ ins Deutsche übersetzt wurde. Sie öffnete damit den Blick auf einen differenzierten Umgang mit Männern und Frauen in Pflege und Palliative care. Auch, so ihre These, besäßen Frauen eine grundsätzlich andere, eine im Vergleich zu den Männern eher innere Einstellung zum Tod. In Deutschland waren es die Paderborner Professorin Hannelore Bublitz und die Berliner Soziologin Dorothea Dornhof, die ähnliche Forschungen betrieben, zunächst aber nur in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlichten.14 Als die Kulturwissenschaftlerin und Soziologin Julia Schäfer 2002 die „Perspektiven einer alternativen Trauerkultur“ beleuchtete, fand sich im Zuge dieser Studie erstmals ein Exkurs zu „Trauer und Geschlechtsspezifik“: „Mit diesem Exkurs sollen geschlechtsspezifische Unterschiede, die es hinsichtlich Tod und Trauer gibt, thematisiert werden.“15
Es ist allerdings bemerkenswert, dass beinahe zeitgleich zum Beginn akademischer Studien vergleichbare Erkenntnisse bereits Einzug in die Praxis hielten. Frauen nahmen ihre besondere Rolle wahr und beanspruchten ihren Platz im Bestattungswesen, weil sie Frauen sind.
Bestattung in Frauenhänden
Es sollen eigene, negative Erfahrungen gewesen sein, die Ajana Holz bei Sterbefällen erlebt hatte. Sie hatte dabei wenig Hilfe und Unterstützung erfahren, und dies veranlasste sie, mit ihrer damaligen Freundin und Lebenspartnerin Brigitte 1999 das Bestattungsinstitut „Die Barke“ zu gründen. Insbesondere schien es ihr seinerzeit kaum möglich, Bestattungen gemäß ihrer lesbisch-feministischen Vorstellungen durchzuführen. Sie erinnerte sich an die alten Traditionen der Totenfrauen und Leichenwäscherinnen, die über Generationen hinweg die Totenfürsorge betrieben hatten. Ihr wurde gleichzeitig die besondere Aufgabe der Frau am Lebensbeginn bewusst, und so übertrug sie diese Kompetenz auf das Lebensende. Ajana Holz, die in Erwägung gezogen hatte, Hebamme zu werden, versteht sich nun als Seelen-Hebamme am Lebensende. Heute betreibt sie mit ihrer Lebensgefährtin Merle von Bredow das Bestattungsinstitut „Die Barke“ mit dem Grundsatz, „den würdevollen und sanften Umgang mit den Toten wieder in Frauenhände zu nehmen“.16 Beide Frauen sind 1964 bzw. 1967 geboren und gehören somit, wenn man so will, der jüngeren Generation an, als sie anfingen, sich der Betreuung von Kindern, Frauen und Menschen in Krisensituationen zu widmen. Sie können ebenfalls beide auf eine schamanische Ausbildung verweisen, womit sie die Geistigkeit ihres Tuns betonen, das Vorrang besitzt vor den üblichen handwerklichen und organisatorischen Tätigkeiten des Bestatters. In ihrer täglichen Praxis bestatten sie Menschen beiderlei Geschlechts, aber sie machen keinen Hehl aus ihrer Einstellung, dass Frauen und auch Kinder besonderer Sorgfalt bedürfen: „Es ist uns ein Herzensanliegen, vor allem Frauen und Kindern nach ihrem Tod einen geschützten Raum, unseren ganzen Respekt und unsere liebevolle Fürsorge zu geben, bis sie der Erde oder dem Feuer übergeben werden!“ Sie verstehen sich als „Anwältinnen“ für die Würde der Toten und für das Recht der Menschen auf ihren ureigenen Abschied und wollen mit ihrer Arbeit eine Brücke zwischen Leben und Tod bauen, die für sie untrennbar zusammengehören. Frauen, so sagen sie, können das von Natur aus besser, denn wie die Geburts-Hebammen am Lebensbeginn die Neugeborenen empfangen, so empfangen wir am Lebensende die Toten und begleiten sie und die Abschied nehmenden Lebenden in diesem Übergang.17
Derselben Generation gehört Claudia Marschner an, die auf Umwegen zum Bestattungsgewerbe kam, ihre (negativen) Erfahrungen sammelte und schließlich 1992 ihr eigenes Institut gründete, um – wie sie sagt – alles anders zu machen. Mit ihren bunten Särgen, der Beisetzung der Rocker in ihrer dunklen Motorradkluft und rosa Särgen für Lesben eroberte sie die Aufmerksamkeit der Medien und prägte die Vorstellung von dem, was man eine alternative Bestatterin nennt. Sie huldigt der Überzeugung, dass jeder Mensch in seiner Verschiedenheit die ihm angemessene Bestattung verdient. Man mag einräumen, dass manches auch wie pures Marketing klingt, aber sie wäre nicht erfolgreich, wenn es nicht eine Klientel gäbe, die ihre Verschiedenheit auch im Bestattungsfall leben möchte. Zugleich sei zugegeben, dass hier ein Nischenprodukt angeboten wird, weil sich die Mehrheit der Bevölkerung immer noch den traditionellen Formen verpflichtet fühlt. Aber wie die Bestatterinnen der „Barke“ kann Claudia Marschner im hart ausgefochtenen Konkurrenzkampf nur bestehen, weil sich eine wachsende Zahl von Menschen ihrer Eigenart bewusst wird. Man kann gar nicht sagen, dass sie eine Tür aufgestoßen haben, vielmehr war der Druck auf diesen neuen Raum bereits so gestiegen, dass sie die Türe einfach öffnen mussten.
Dafür bot Berlin, wo Claudia Marschner tätig ist, das ideale Umfeld: eine Großstadt mit ihrer lebhaften Kultur und einer kreativen AIDS-Szene, die offen oder sogar begierig war auf Neues. Eine Bestattung in Frauenhänden bietet unter ähnlichen Vorzeichen Claudia Bartholdi in der Großstadt Hamburg an und verweist ebenfalls auf die ursprünglichen Zusammenhänge von Geburt und Tod: „Schon immer haben Frauen Geburt und Tod begleitet. Ihr Wissen unterstützt die einfühlsame und fürsorgliche Begleitung der notwendigen Handlungen! Auch wir besinnen uns wieder auf die Tradition der Totenwäscherinnen und übernehmen die Abschiednahme und Totenwache in familiären Räumen.“ Milieu und Szene sind offenbar der Nährboden für das frei werdende Bewusstsein einer Individualität, die sich andernorts noch zurückhält. „Die Barke“ hingegen, mit Firmensitz in Schwäbisch Hall und daher eher in einem konservativen Umfeld beheimatet, bietet ihre Dienste bewusst bundesweit an. Daraus ist zu schließen, dass das Pflänzlein einer alternativen Bestattungskultur erst vorsichtig keimt, aber der Weg in die Zukunft ist gewiesen. Sie hat inzwischen auch mittelgroße Städte wie etwa Aachen erreicht, wo Regina Borgmann und Christa Dohmen-Lünemann seit 2007 das Bestattungsinstitut „InMemoriam“ betreiben, und man könnte die Reihe der Frauen fortsetzen, die ihre eigenen Wege gehen.
Drei Dinge sind ihnen gemeinsam: die Rückbesinnung auf die weibliche Tradition der Totenfürsorge, das Bewusstsein vom Gleichklang von Geburt und Tod und, damit verbunden, ihre Weisheit, dass der Tod ein Übergang ist in eine andere Welt. Ihre Dienstleistungen mögen sich in der Praxis vielleicht gar nicht so sehr von denen ihrer männlichen Kollegen unterscheiden, doch vermitteln sie ihren Kunden ein anderes Gefühl. Sie sprechen es nicht in erster Linie an, aber sie bedienen eben auch den Wunsch einer Frau, von einer Frau bestattet zu werden. Ein anderes Körperbewusstsein und eine damit verbundene Scham, die auch den leblosen Leichnam noch für schützenwert hält.
Von den genannten Pionierinnen abgesehen haben sich mittlerweile viele Frauen aufgemacht, die Bestattung bewusst aus Frauenhänden anzubieten. Aber selbst, wo ihnen der Weg in die Selbstständigkeit nicht gelingt, sind sie doch mittlerweile als Mitarbeiterinnen in männergeführten Bestattungsunternehmen sehr willkommen. Neben ihrem Organisationstalent wird ihnen eine besondere Einfühlsamkeit zuerkannt, und die Frauen gehen diesen Schritt vermehrt. Der Bestatterberuf ist seit 2003 Ausbildungsberuf, und bereits 2010 waren von 467 Personen in der Ausbildung zur Bestattungsfachkraft 239 Frauen. Eine steigende Zahl von Bestattungsunternehmern findet es gut, wenn Angehörige wählen können, ob sie von einem Mann oder einer Frau betreut werden wollen. Das gilt für die Vorderbühne, wo es um Beratung und Absprachen geht, aber ebenso für die Hinterbühne, wo die Verstorbenen denen, die sie einsargen und zurechtmachen, hilflos ausgeliefert sind.
Dabei herrscht unter den Frauen eine bewusste Reflexion ihrer Praxis, die allerdings bis heute kaum theoretisch unterfüttert ist. Selbst Erni Kutter, Diplom-Sozialpädagogin und Vorkämpferin für eine weibliche Trauerkultur, die versucht, in das Phänomen der Frauentrauer tiefer einzudringen, verweist letztlich nur auf das „uralte Frauenwissen“, von dem Impulse für die „Entstehung einer neuen Sterbe- und Gedenkkultur“18 ausgehen. Sie verweist auf die traditionelle Beziehung der Frauen zur Kranken- und Totenfürsorge, auf altes schamanisches Wissen ebenso wie auf spirituell-magische Hintergründe der mittelalterlichen Beginen. Aus meiner Sicht macht sie deutlich, dass es sich hier um Gefühle handelt, die den Ausschlag geben, wenn Frauen, die sich ihrer Verschiedenheit bewusst werden, sich bei Geschlechtsgenossinnen besser aufgehoben wissen.
Die weiblichen Bestatterinnen kommen jedoch nicht nur einem erwachenden Bedürfnis nach der Betreuung der Frauen durch Frauen entgegen, sondern sie nehmen Einfluss auf die Bestattungskultur an sich, denn immer mehr Männer orientieren sich an den weiblichen Idealen und befleißigen sich derselben Sensibilität. Viele Vertreter der neuen Bestattergeneration sind Quereinsteiger/innen und kommen aus unterschiedlichsten Berufen; sie haben sich aufgrund eigener Erfahrungen – gelungenen wie weniger gelungenen Abschieden von nahestehenden Menschen – an einem bestimmten Punkt ihrer jeweiligen Biografie entschieden, ein eigenes Bestattungsinstitut zu gründen. So heißt es auf der Website des „BestatterInnen Netzwerk“19, sie seien ein bundesweiter Kreis inhabergeführter Bestattungsunternehmen, die sich einem gemeinsam erarbeiteten Leitbild20 verpflichtet haben. Vielem darin fühlen sich „normale“ Bestatter/innen ebenso verpflichtet, aber ein besonderer Gedanke ist schon, dass sich die alternativen Bestatter/innen als Wegbegleiter in der kostbaren Zeit zwischen Tod und Bestattung für die Toten und ihre Angehörigen verstehen. Kostbare Zeit ist hier der Schlüsselbegriff, mit dem sie der durch den Tod belasteten Zeit eine neue Qualität verleihen. Und sie verstehen die Toten nicht als Objekte ihres Tuns, sondern als schutzbedürftige Menschen und Teil des Beziehungsgeflechtes, innerhalb dessen es eines Interessenausgleichs zwischen Toten, Angehörigen und Institutionen bedarf.
Friedhöfe für Frauen
Wie die Bestattung seit dem 19. Jahrhundert eine Domäne der Männer geworden war, so gehörte es umgekehrt zum Bild der Frau, dass sie sich um die Pflege der Gräber kümmert. Grabpflege war reine Frauensache, solange die Familie das Standardmodell der Lebensgestaltung war. Dies hat sich, wie wir alle wissen, längst geändert, und eine Vielzahl von Lebensformen ist nicht an ihre Stelle, ihr aber wohl zur Seite getreten. Das Single-Sein als eine weitverbreitete Lebensform erfordert hier neue Strukturen, macht Familiengräber überflüssig und lässt überhaupt die Frage nach der Sinnhaftigkeit und Bedeutung des Grabes entstehen. Die anonyme Bestattung war gewiss auch eine Antwort auf die Frage nach einer ungewissen Sorge um das Grab. Wo keiner da ist, der diesen Ort der Trauer braucht und sich darum kümmert, ist er verzichtbar. Doch schließt das nicht den Wunsch der Betroffenen nach einer Grabstelle aus.
Als eine Lösung bietet sich das Gemeinschaftsgrab an, in dem man sich schon zu Lebzeiten einen Platz sichert. Dort kann man sich aufgehoben wissen, bleibt indes so vereinzelt, wie man vielleicht gelebt hat. Wird das Single-Sein indes durch andere Wohnformen ergänzt, in denen Gleichgesinnte zusammenleben, so bietet sich zugleich ein gemeinsames Grab an. Diesen Entschluss fassten 2009 die Frauen der Genossenschaft FrauenWohnen in München: „Die Genossenschaft FrauenWohnen bietet ihren Mitfrauen die Möglichkeit, in einem gemeinsamen Gräberfeld auf dem neuen Friedhof in Riem bestattet zu werden. Dies ist eine Alternative zur anonymen Bestattung oder auch ein Ort für Frauen, die keine Angehörigen haben, die das Grab pflegen können bzw. wollen.“21 Die Frauen der Münchner Wohngemeinschaft wollen demnach nicht nur zusammenleben, sondern nach dem Tod zusammenbleiben, gewissermaßen als „Nachbarinnen für immer“, wie die Süddeutsche Zeitung ihren Bericht über den Frauenfriedhof titelte. Dabei war den Münchner Frauen durchaus bewusst, dass sie nichts Neues erfunden hatten, sondern auf die alte Tradition der Friedhöfe für Ordensfrauen zurückgriffen. Die Frauen wollten wissen, wo sie ihre letzte Ruhe finden. Beim Vereins-Grab haben sie die Gewissheit, dass sie von den Mitgliedern besucht werden – ein schöner Gedanke für jene, die keine Familie haben.
„Gräberfeld Schiefe Kiefer für Frauen der Genossenschaft FrauenWohnen“ nennt sich das Projekt offiziell in der Trägerschaft eines nicht eingetragenen Vereins, der seinen Vereinszweck in seiner Satzung folgendermaßen formuliert: „Der Zweck des Vereins ist die Anmietung, Verwaltung und Pflege des Gräberfelds Nr. 53 auf dem neuen Friedhof Riem für die Bestattung von Mitfrauen des Vereins.“22 Auf dem Gräberfeld steht eine blaue Stahlskulptur mit dem Titel „Raumzeichnung“, die der Verein in Auftrag gegeben hat. Man habe, so wird berichtet, schon seine Einweihung mit Prosecco begossen, wie man das vielleicht auch bei Trauerfeiern tut. (Abb. 2)
Dieses Friedhofsmodell wird nicht das einzige bleiben und belegt exemplarisch, dass das gruppenspezifische Gemeinschaftsgrab als wesentlicher Teil des Wandels der Friedhofskultur Ausdruck des Bewusstseins von Verschiedenheit ist. Die Frauen, die hier zusammenleben, haben eine Wohnform gewählt, die ihrer selbst gewählten Lebensform entspricht und verschieden ist von dem, was man lange Zeit für das Übliche gehalten hat. Dass man entsprechend eine andere Bestattungsform wählt, ist naheliegend. Dass es seit 2014 in Berlin einen Friedhof für Lesben gibt, muss als logische Konsequenz dieser Entwicklung angesehen werden. Auf ihn werden wir an anderer Stelle noch näher eingehen.

Abb. 2: München, Friedhof Riem, Gräberfeld Schiefe Kiefer für Frauen der Genossenschaft FrauenWohnen, 2009, Foto: Dagmar Kuhle
War bereits davon die Rede, dass Grabpflege Frauensache ist, so ist Erinnerung Männersache. Dies hat bereits der römische Geschichtsschreiber Tacitus in dem Satz FEMINIS LUGERE HONESTUM EST VIRIS MEMINISSE23 – Für Frauen ist das Trauern ehrenvoll, für Männer das Gedenken festgehalten, und diese Worte waren einst sogar für den Eingang zum berühmten Friedhof Père-Lachaise in Paris vorgesehen. Weitaus mehr als Frauen standen Männer im gesellschaftlichen Mittelpunkt und pflegten ihre memoriale Zukunft. Selbst als im 20. Jahrhundert Frauen die Gesellschaft zu erobern begannen, war ihnen ein entsprechendes Gedenken nicht gewiss. Diese Erkenntnis führte in Hamburg 2001 zur Eröffnung der „Garten der Frauen“ genannten Gedenkstätte: „Durch den Garten der Frauen sollen Frauen, die Hamburgs Geschichte mitgeprägt haben, in bleibender Erinnerung gehalten werden. Denn im Gegensatz zum Umgang mit bedeutenden männlichen Persönlichkeiten, deren Verdienste gewürdigt werden und deren Andenken bewahrt wird, geraten weibliche Persönlichkeiten schnell in Vergessenheit.“24 Angelegt wurde der „Garten der Frauen“ auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf und entwickelte sich rasch zu einem Kulturprojekt.
Allerdings blieb es beim „Garten der Frauen“ nicht bei einem Gedenkort, sondern er dient zugleich als Begräbnisstätte für Frauen, die sich als Mäzeninnen dieses Ortes verstehen und in dieser Frauenwelt bestattet sein wollen: „Im Garten der Frauen können sowohl Sarg- als auch Urnengrabstellen erworben werden. Wer eine Grabstelle erwirbt, wird gleichzeitig Mäzenin für den Erhalt der historischen Grabsteine.“25 Es sind Schauspielerinnen, kulturschaffende Frauen sowie Frauen aus den Bereichen Politik, Bildung und Soziales, die sich für dieses Projekt engagieren und zumindest teilweise auch an diesem Ort bestatten lassen. Etwa 60 Frauen fanden bisher (2015) hier ihre letzte Ruhestätte.
Der „Garten der Frauen“ ist in seiner Weise ein deutliches Signal nicht nur der Emanzipation, sondern auch einer neuen Trauerkultur, in der der Unterschied der Geschlechter zu einem neuen Wesensmerkmal wird. Frauen sind anders, sie empfinden das und sie gestalten entsprechend ihr Leben anders und ihr Sterben.