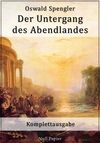Kitabı oku: «Deutsche Geschichte», sayfa 21
Wenn Albert nicht wie Goethes Faust wünschte, dem Meere Land abzugewinnen, um mit freiem Volk auf freiem Boden zu stehen, so beschützte er doch die Rechte und Freiheiten des Volkes so viel er konnte. Als Erzbischof Konrad von Hochstaden mit der Stadt Köln in einen schweren Streit geriet, gelang es Albert zweimal, eine Vermittelung herbeizuführen, wobei jedem das Seine gegeben wurde, was bei der Masse verwickelter Rechtsfragen und übergreifender Ansprüche außerordentlich schwierig war. Das Vertrauen, das beide Teile in Alberts Gerechtigkeitsliebe, Unbestechlichkeit und Sachkenntnis setzten, lässt seinen Charakter im schönsten Licht erscheinen. Bei der Sühne, der die verhängnisvolle kriegerische Auseinandersetzung folgte, fehlte seine Mitwirkung. Auch in Würzburg wurde er bei einem Streit zwischen Bischof und Bürgerschaft zur Vermittlung herangezogen und hat sie nicht versagt. Gerade diese Teilnahme an wichtigen öffentlichen Akten zeigt die frische Tätigkeit des gelehrten Dominikaners und seinen unbefangenen Sinn für die weltlichen Lebensverhältnisse.
So unbegrenzt war das Zutrauen zu Alberts Allvermögen, dass er nicht nur für den Erbauer der Dominikanerkirche und des neuen Domes in Regensburg gehalten wurde, sondern auch den Plan zum Kölner Dom soll er entworfen haben, nachdem der alte romanische im Jahre 1248 abgebrannt war. Dabei hätten ihm die Jungfrau Maria und die Patrone und Meister der Baukunst, die Vier Gekrönten, geholfen; denn die Heiligen bemühten sich nicht weniger um ihn als der Teufel. Überhaupt soll er die gotische Bauweise in Deutschland eingeführt haben, die deshalb kurzweg die Albertinische Kunst geheißen habe. Es spricht aus dieser durch nichts zu begründenden Sage das Gefühl, dass ein neuer Geist aus diesem Manne sprach, auf den man darum alles Neue und Große bezog. Wie seine Art der Naturbetrachtung, so widersprach er auch in religiösen Dingen oft der üblichen Auffassung. »Wenn wir denen vergeben, die uns an Leib, Ehre oder Gut schadeten, das ist uns mehr nütze, als wenn wir über Meer gingen und uns ins heilige Grab legten.« »Wenn wir Lieb und Leid in rechter Demut aus Gottes Hand empfangen und beides als Gottes Gabe erkennen, so ist uns das mehr nütze, als wenn wir alle Tage einen Wagen voll Birkenreiser auf unserem Rücken zerschlügen.« »Wenn der Mensch krank ist, so glaubt er oft, dass sein Leben unnütz sei vor Gott. Wenn er aber nicht des Gebetes und der guten Werke pflegen kann, schaut seine Krankheit und sein Verlangen tiefer in die Gottheit als zehnhundert Gesunde.« Der Katholizismus war unüberwindlich groß, als er noch den Protestantismus und die Mystik in sich schloss. Erhob sich Albert über das Formelhafte und Äußerliche sowohl wie über das krampfhaft Übertriebene, was kirchliche Gebräuche so leicht verfälscht, bewegte er sich doch treu in den Schranken der Kirchlichkeit und gab viele Proben herzlicher Frömmigkeit. Auch die Askese wusste er zu schätzen und übte sie in verständiger Weise, ließ sich aber doch, als er Bischof wurde, vom Gelübde der Armut entbinden. Liebesgeschichten sind nie von ihm berichtet worden, wie viel Gerüchte auch über ihn umgingen, und wie rücksichtslos er auch als Nekromant angegriffen wurde. Die Sage von der argen Herzogstochter, die neun Jünglinge liebte und dann umbrachte, und die auch ihn besitzen wollte, führt ihn als zauberkundig, aber als unverführbar ein. Doch war er ein Freund der Frauen und der Frauenbildung. Im Gegensatz zur Bibel forderte er, dass im Falle des Ehebruchs nicht nur der Mann die Frau, sondern auch die Frau den Mann entlassen dürfe. Das Recht, die ehebrecherische Frau zu töten, sprach er dem Manne ab.
In allen seinen Anschauungen hielt er die Mitte ein, nicht im Sinne des Mittelmäßigen, Verwaschenen, Verplatteten, sondern so, dass er das Entgegengesetzte zu verbinden suchte, wie es wirklich im Wesen der Menschen verbunden ist. Er war ein Gegner der Gütergemeinschaft, wie sie Plato lehrte; aber wenn er den Privatbesitz für zulässig und sogar löblich erklärte, so sagte er doch, dass der Mensch nicht unbedingt Herr seiner Güter sei. Privatbesitz, der über das hinausgehe, was man zur Befriedigung der Lebensbedürfnisse benötige, müsse den Ärmeren zugute kommen. Der Besitzer überflüssiger Güter sei eigentlich nur Verwalter des Armengutes. Im Falle der Not werde Privatbesitz Gemeinbesitz, weil nach dem Naturrecht im Notfalle alles gemeinsam sei. Das folge aus der Zusammengehörigkeit aller im Staate. Im Allgemeinen lehnte er sich in allen den Staat betreffenden Fragen an Aristoteles, zuweilen an Augustinus. Das Fundament des Staates ist ihm die Gerechtigkeit; er erinnert an das Wort des Augustinus: »Ohne Gerechtigkeit sind die Staaten weiter nichts als große Räuberbanden.« Wenn der Zweck des Staates ist, die Bürger zu versittlichen, so bildet dabei doch die Wirklichkeit des Lebens eine Grenze. So hielt er z. B. das Zinsnehmen für gestattet. Den Krieg sah er als ein Übel an, nicht aber den Soldatenstand für unsittlich oder unerlaubt; denn im Interesse seiner Souveränität müsse der Staat gerüstet sein und dürfe zur Verteidigung auch Kriege führen; Kriege gegen heidnische Völker zum Zwecke der Bekehrung dagegen verwarf er, ganz abweichend von den herrschenden Ansichten und Gepflogenheiten. Widerstand gegen Tyrannen hielt er für erlaubt. Der Staat war ihm nicht Machtstaat, sondern in erster Linie Kulturstaat.
Das Umfassen aller Gebiete des Glaubens, des Denkens und des Lebens macht Albert so groß. In alles, was er tat oder bearbeitete, vertiefte er sich gründlich, mit Leidenschaft. Die Menge seiner Schriften ist so groß, dass man meint, er müsse sein Leben mit der Feder in der Hand zugebracht haben. Doch schätzte ihn der Orden nicht nur als Prediger und als Universitätslehrer, sondern auch als Verwalter. In der Freundschaft war er treu und in der Anerkennung fremden Verdienstes so selbstlos und hingebend, dass er, als die Lehre des Thomas von Aquino in Paris angegriffen wurde, trotz seines hohen Alters, denn er war in der Mitte der achtziger Jahre, dorthin reiste, um seinen verstorbenen Schüler und Freund zu verteidigen. Es war ihm eine lange Lebenszeit beschieden, damit er alle Stufen des Lebens durchschreiten und ihre verschiedenen Aufgaben erfüllen könne. Er starb neunzigjährig im Jahre 1280.
Der Rheinische Bund
Man hat die Zeit, die dem Untergang der Hohenstaufen folgte, während der ausländische Fürsten zu Königen gewählt wurden, die Deutschland teils gar nicht, teils nur flüchtig betraten, das Interregnum, das Zwischenreich, genannt und pflegt sie als eine Zeit des Niedergangs, des allgemeinen Verderbens zu betrachten. Wie richtig das auch ist, so ist doch kein Niedergang so durchgreifend, dass sich nicht Keime regten, in denen ein herrlicher Flor für die Zukunft sich vorbereitet; denn die Kette des Lebens reißt niemals ganz ab. Schwächungen der Zentralgewalt haben nicht selten den großen Vorteil, dass das Einzelne sich kräftiger rühren kann, dass aus der Tiefe des Volkes schöpferisch emportreibt, was der Anregung durch die Not bedurfte, dem die mangelnde Aufsicht Raum gibt. Das ist gerade bei den Deutschen mit ihrer Neigung zu individuellen Bildungen der Fall, deren Reichtum wohl zuweilen das Ganze zu überwuchern droht, aber doch der Kultur zugute kommt. Zwischen der Vertretung des Ganzen – der Zentralgewalt – und dem Einzelnen muss stets ein Kampf und ein Ausgleich stattfinden; darin, dass jedes Einzelne strebt, ein Ganzes zu werden, und dass das Ganze jedes Einzelne einschränken muss, ohne es zu vergewaltigen, darin bestehen die schwierigen Verwicklungen des Lebens, darin besteht aber auch das Leben.
Schon während der Regierungszeit Friedrichs II., der selten im Lande war und eine schwache Vertretung hatte, verfielen die Städte auf das Mittel der Einung, um sich der durch den König gestärkten Fürsten zu erwehren. Nachdem diese gesetzlich die volle Landeshoheit erhalten hatten, die königliche Oberhoheit für ihr Gebiet so gut wie ganz ausgeschaltet war, trachteten sie danach, ihre zerstreuten Güter und Rechte zu einer zusammenhängenden Landesherrschaft auszugestalten, innerhalb welcher die unabhängigen Städte sie störten, deren Reichtum ohnehin zur Eroberung reizte. Von Anfang an stützten die Städte ihre Freiheit auf die Königsgewalt, deren Stärke ihr Interesse war. Bei dem fast gänzlichen Erlöschen derselben griffen sie zur Selbsthilfe, um nicht der um sich greifenden Fürstenmacht zur Beute zu fallen. Leise und unscheinbar war der Beginn einer Einrichtung, die sich bedeutend auswirken sollte: im Jahre 1220 verbündeten sich die benachbarten Städte Mainz und Worms, indem sie ihren Bürgern gegenseitig Rechtsgleichheit zugestanden. Einige Jahre später erklärte Heinrich, der Sohn Friedrichs II., den er zum Regenten Deutschlands bestimmt hatte, alle Verbrüderungen oder Eide, wodurch sich Mainz, Bingen, Worms, Speier, Frankfurt, Gelnhausen und Friedberg verbunden hätten, für aufgelöst und nichtig. Bereits also erregte die bescheidene Kraftentfaltung einiger Städte Ärgernis. Im Jahre 1231 legte Heinrich den versammelten Fürsten die Frage vor, ob Städte untereinander Bündnisse abschließen dürften und erhielt, wie zu erwarten war, eine verneinende Antwort. Selbstverständlich widersprachen Verbindungen zwischen gleichartigen Reichsgliedern dem Reichsrecht, denn sie lösten eine Gruppe aus dem Gesamtverbande und verlagerten das Gleichgewicht; auch wenn sie nicht ausdrücklich gegen andere gerichtet waren, so bedeuteten sie doch eine Herausforderung oder Gefahr. Andererseits schlossen die Fürsten nach Belieben Bündnisse untereinander und war ihre Übermacht gegenüber einzelnen Städten so entschieden, dass diese auf Verbrüderung angewiesen waren, und Städtebünde wie durch Naturgewalt sich immer wieder bildeten. Zwei Jahre nach dem Tode Kaiser Friedrichs verbanden sich Köln und Boppard, ein Jahr später Münster, Dortmund, Soest und Lippstadt. Im Todesjahr Konrads IV., 1254, erneuerten Mainz und Worms ihr altes Schutz- und Trutzbündnis. Der Gedanke, möglichst viele Städte im Reich zu einem großen Bunde zusammenzuschließen, ging von Mainz aus, dessen Blüte damals fast die Kölns übertraf, und die leitende Persönlichkeit scheint Arnold aus dem Geschlecht der Walpode gewesen zu sein. Der Name kommt vom Amte des Gewaltboten, das die Familie seit dem Anfang des zwölften Jahrhunderts bekleidete. Arnolds Name ist in den Urkunden, die sich auf den sogenannten Rheinischen Bund beziehen, fast immer an erster Stelle genannt, sodass man Ursache hat, in ihm den eigentlichen Begründer zu sehen. Sonst weiß man nichts von ihm, als dass er die Dominikanerkirche gründete, die, nachdem sie im 15. Jahrhundert zerstört und wieder aufgebaut war, beim Bombardement von Mainz im Jahre 1793 abbrannte. Aus dem Dunkel der Vergangenheit scheint sein Name wie ein ferner Stern, ein Quell des Lichts, zu dem man verehrend und dankbar aufschaut, ohne sein Wesen zu erkennen.
Als Zweck des Bundes nannten die Städte die Abstellung ungerechter Zölle. Dies war, mochte auch Stärkung der städtischen Macht gegenüber der fürstlichen hauptsächlicher Antrieb sein, kein Vorwand. Die Zölle waren ein Regal, und als rechtmäßig galten nur die vom König oder mit königlicher Bewilligung errichteten Zollstätten. Seit geraumer Zeit erlaubten sich Fürsten und Herren willkürliche Zollforderungen, die einer Art von Wegelagerei gleichkamen und den Verkehr unerträglich erschwerten. Während es am Rheine im 12. Jahrhundert 19 Zollstätten gab, waren es in der Mitte des 13. Jahrhunderts etwa 35. Auf der Burg Kaiserswert, die Barbarossa im Jahre 1189 als Zollstätte erbaute, stand die Inschrift: Hoc decus imperii caesar Fridericus adauxit justitiam stabiliere volens et ut ubique pax sit. Die Burgen, von denen aus neuerdings die Kaufleute auf Grund willkürlicher Zollforderungen erhoben wurden, waren keine Zierde, sondern eine Schande des Reiches, dienten nicht der Ordnung und dem Frieden, sondern dem Raub und der Gewalt. Da die Gewalttat von Fürsten und Herren ausging und sich gegen die Städte richtete, musste es von vornherein bedenklich erscheinen, dass Fürsten und Herren zum Eintritt in den Bund eingeladen wurden; die Städte glaubten wohl, ohne diese Ausdehnung auf alle Reichsglieder die kaiserliche Bewilligung nicht zu erlangen. So umfasste denn der Bund bald einen großen Teil des Reiches, allerdings in der Hauptsache nur den südwestlichen. Von norddeutschen Städten traten Münster, Osnabrück und Bremen bei, von östlichen Regensburg; die Zusage dieser mächtigen Donaustadt wurde als ein großer Gewinn betrachtet. Die rheinischen Erzbischöfe und Bischöfe wurden alle Mitglieder, ebenso die Herzöge und der Pfalzgraf von Bayern, die Grafen von Katzenelnbogen, Leiningen, Ziegenhayn, die Herren von Hohenfels und Falkenstein. Als der neugewählte junge König Wilhelm von Holland in Mainz und Worms die Huldigung annahm, erklärte er sich mit dem Bunde und seinen Zielen einverstanden, auf dem Reichstage zu Worms im Jahre 1255 wurde er anerkannt. Es war das erste Mal, dass Städte auf einem Reichstage vertreten waren.
Trotz seiner großen Mitgliederzahl hat der Bund nicht viel, fast gar nichts ausgerichtet. Dem mittelalterlichen Unabhängigkeitssinn entsprechend war er nur lose organisiert. Eine Art Zwang zum Beitritt konnte allerdings durch Handelssperre ausgeübt werden, übrigens aber fehlten Einrichtungen, die ein schnelles und energisches Handeln ermöglicht hätten, es gab weder eine Bundeskasse noch eine Bundesarmee. Der zeitgenössische Chronist Albert von Stade sagte, der Bund habe den Fürsten, Rittern und Räubern nicht gefallen, sie hätten gesagt, es sei schändlich, dass Kaufleute über adlige Männer herrschten. Über den Zweck des Bundes gingen die Interessen der adligen und der städtischen Mitglieder ganz auseinander, wenn auch die beitretenden Fürsten versprachen, alle ungerechten Zölle abzuschaffen. Dass einem Herrn von Bolanden und einem Herrn von Strahlenburg bei Schriesheim ihre Burgen wegen unrechtmäßiger Zölle gebrochen wurden, rechtfertigte den Aufwand des Bundes nicht. Über der Doppelwahl nach dem frühen Tode König Wilhelms löste er sich auf, nachdem er kaum zwei Jahre bestanden hatte.
Trotz seiner kurzen Dauer und seiner geringen Leistungen war der Rheinische Bund ein bedeutungsvolles Ereignis. Mit einem großen Wurf, richtunggebend, traten die Städte in das kämpfende Gewoge der Geschichte ein, scheinbar nur ihre wirtschaftlichen Interessen vertretend, tatsächlich als eine politische Macht, die den Fürsten eine Schranke setzte. Während die Fürsten sich auf Kosten des Reiches vergrößerten, verfochten die Städte den Reichsgedanken; um diese Zeit konnten sie mit Recht sagen, sie seien das Reich. Das mag auch am Königshofe empfunden worden sein: miraculose et potenter, wunderbar und mächtig, so heißt es in einer Urkunde Wilhelms in Bezug auf den Rheinischen Bund, sei durch die Niedrigen für Frieden und Recht gesorgt worden. Denkt man daran, dass im Kreise dieser Niedrigen um diese Zeit die Dome von Freiburg, Straßburg und Köln begonnen wurden, Riesenspuren eines Geschlechtes, das seine Kräfte Unternehmungen zum Dienste des Überirdischen widmete, wird einem klar, wie reich, wie vielseitig das Leben des deutschen Volkes in den Städten strömte. Wie weit der Blick der Gründer des Bundes reichte, beweist die Tatsache, dass die städtischen Mitglieder eine Armensteuer zu entrichten hatten, und die fast noch merkwürdigere, dass sie auch das Interesse der Allerniedrigsten, der Bauern, in ihre Pläne einbezogen. Sie forderten, dass die Herren von ihren Hörigen nicht mehr als das seit dreißig Jahren Herkömmliche verlangten, ja es scheint, dass sie an die Möglichkeit des Anschlusses von Bauernschaften an den Bund dachten. Wäre dieser Gedanke ernstlich ins Auge gefasst und weiter verfolgt worden, wie anders und wie viel harmonischer, wenn auch nicht kampfloser, hätte sich die Geschichte Deutschlands entwickeln können.
Stedinger, Friesen, Dithmarschen
Da wo das Meer und die hohen Berge sind, hatten sich freie Bauern erhalten. Es ist, als ob im Kampfe mit den Elementen, mit Flut und Sturm, mit Felszacken und Eiswüsten etwas von der Unbändigkeit und Urgewalt der Elemente auf die kämpfenden Menschen überginge. Auch bilden Gebirge sowie Meer und Sümpfe eine natürliche Schutzwehr, während die offene Ebene der Verknechtung günstig ist. Die stolze Art der meeranwohnenden Sachsen und Friesen fiel früh auf; besonders die Friesen wurden in der Zeit, wo die Hörigkeit des Bauern als das Selbstverständliche galt, vom Adel als geborene Rebellen betrachtet. Dass sie die Kunst der Entwässerung und der Bedeichung verstanden, wodurch das fette, vom Meer angeschwemmte Land erst bewohnbar wurde, gab ihnen andererseits einen hohen Wert, der von den Besitzern von Sumpfland wohl begriffen wurde. Als Graf Adolf von Schauenburg Wagrien kolonisierte, weigerten sich seine Holsten, den Zehnten zu zahlen und sagten, lieber wollten sie mit eigener Hand ihre Häuser anzünden und ihr Land verlassen, als einer solchen Sklaverei sich unterwerfen; und dabei blieb es. Um die Mitte des zwölften Jahrhunderts begannen auch die Erzbischöfe von Bremen das noch unbebaute Sumpfland an der Unterweser mit Bewohnern des westlichen Küstenlandes zu besiedeln, die damals in einer allgemeinen Bewegung nach dem Osten zu waren. Sie teilten das Land nach holländischem Recht, sogenanntem Hollerrecht aus, wonach die Siedler so gut wie frei waren, außer dass sie einen Grundzins, den Hollerzehnten, zahlten. Andere Ansiedler, wie z. B. die des Klosters Rastede und anderer Klöster, genossen geringere Vorteile; aber im Allgemeinen betrachteten die von Natur streitbaren Leute das Land, das sie selbst in mühseliger Arbeit aus Sumpf und Moor geschaffen hatten, als ihr eigen, achteten Rechte von Grund- und Landesherren nicht und suchten sich ihrer zu erwehren, wenn sie unbequeme Ansprüche erhoben. Im Jahre 1190 erscheint der Name Stedinga zum ersten Male urkundlich; er umfasste ein Gebiet an der Unterweser zwischen der Mündung von Öhre und Hunte; es gehört jetzt zum Teil zu Hannover, zum Teil zu Oldenburg. Je blühender und wohlhabender sich das Gebiet entwickelte, desto mehr reizte es die Nachbarn, berechtigte und unberechtigte Ansprüche zu erheben. Gefährlich wurden sie für die Stedinger, als in der Person Gerhards II. ein Erzbischof auf den Bremer Stuhl kam, der sich vorgesetzt hatte, sein verwahrlostes Stift neu zu befestigen. Gerhard war ein Sohn des berühmten Grafen Bernhard zur Lippe und glich seinem Vater, wenn nicht im Umfassenden der Persönlichkeit, doch in der Tatkraft. Da es ihm zunächst darauf ankam, seinen Staat finanziell zu heben, suchte er sich leistungsfähige Untertanen und fand sie in der Stadt Bremen und in den Stedingern.
Bis dahin hatten sich die Stedinger in ihrem durch Sümpfe geschützten Gebiet und durch ihre unwiderstehliche Tapferkeit unabhängig zu halten gewusst. Ihre nachbarlichen Fehden, die sich zunächst gegen die Oldenburger Grafen richteten, deren Vögte sich allerlei Übergriffe erlaubten, verliefen zu ihren Gunsten. In den Kämpfen zwischen den Staufern und Welfen nahmen sie bald auf dieser, bald auf jener Seite teil, ohne je eine andere Politik zu verfolgen als die Bewahrung ihrer Selbstständigkeit. Vielleicht hätte das Geschick der Landschaft sich anders gestaltet, wenn die bereits mächtig aufblühende Stadt Bremen sich mit den Stedinger Bauern verbündet hätte; aber daran wurde auf beiden Seiten nicht gedacht. Nur auf sich selbst gestellt waren die Stedinger, als Gerhard II. es unternahm, die Freien zu unterwerfen, einzig einige Ministeriale, deren Burgen an der Grenze der Marsch lagen, wie die von Hörspe und die von Bardenfleth, auch einige, die auf der hohen Geest wohnten, schlossen sich ihnen an. Am Weihnachtsabend 1229 fand die große Schlacht statt, in der der Führer des erzbischöflichen Heeres, Gerhards eigener Bruder, erschlagen wurde. Kurz vorher war sein anderer Bruder, Bischof Otto von Münster, auf dem Moore von Coevorden von Friesen besiegt und getötet, ein Bruder Dietrich, Propst von Deventer, gefangengenommen; so war der Erzbischof auch durch die Blutrache zum Führer im Kampfe des Adels gegen die Bauern berufen. Nachdem die Kraft der freiheitsstolzen Stedinger sich so verhängnisvoll offenbart hatte, griff der Erzbischof zu einem unedlen Mittel, dessen Wirksamkeit sich aus dem Taumel erklärt, in den die Menschen durch geschickt verwendete Schlagwörter versetzt werden können. Wer einen Feind hatte, bemühte sich, seit die Ausrottung der Häresie als eine dringende Aufgabe von Staat und Kirche erklärt worden war, den Feind zu verketzern; dann gelang es, ihn zu vereinsamen, nicht nur nachbarliche, sondern auch staatliche und kirchliche Hilfe zu seiner Vernichtung aufzubieten. Bereits wurde im Bistum Münster das Kreuz gegen friesische Bauern gepredigt; nun ließ Gerhard II. auf einer Diözesan-Synode in Bremen die Stedinger für Ketzer erklären, was er damit begründete, dass sie die Sakramente verachteten, die Lehre der Kirche für Tand erklärten, dass sie Kirchen und Klöster durch Raub und Brand verwüsteten, dass sie mit des Herren Leib abscheulicher verführen, als der Mund aussprechen dürfe, dass sie von bösen Geistern Auskunft begehrten, wächserne Bilder bereiteten und sich von wahrsagenden Frauen Rat holten. Es waren zum Teil die gleichen Anschuldigungen, die schon zu Bonifazius’ Zeit erhoben waren und noch erhoben werden könnten. Dass allerlei Aberglaube bei den Stedingern wie überall auf dem Lande im Schwange war, ließ sich so wenig leugnen, wie dass sie im Kampfe um die Unabhängigkeit Klöster zerstört hatten. Kirchen gab es in diesen, vor der Ansiedlung der Sachsen und Friesen kaum bebauten Gegenden allerdings wenige, und es ist möglich, dass die Stedinger an diesen wenigen genug hatten. Entweihung der Hostie war ein Vorwurf, der gegen alle Ketzer wie auch gegen Juden gern erhoben wurde und den man zu beweisen sich nicht verpflichtet fühlte, wie denn überhaupt die Beschuldigungen ohne Untersuchung als erwiesen galten. Worauf es eigentlich ankam, sieht man aus dem Satz, den der Erzbischof mit Beziehung auf eine Stelle aus dem Buch Samuel aufstellte: Nolle obediere scelus est idolatriae – Ungehorsam ist gleich Götzendienst. Ein abgefeimter Satz, der jeden Versuch des Freien, seine Freiheit zu erhalten, des Unterdrückten, sich zu wehren, für das ruchloseste Verbrechen erklärte, das die Zeit kannte. Papst Gregor sah wohl, wie mangelhaft begründet die Anklagen des Erzbischofs gegen die Stedinger waren und beeilte sich nicht, das Urteil der Synode zu bestätigen; aber im folgenden Jahre erließ er doch die gewünschte Verfluchungsbulle, und auf dem Reichstage zu Ravenna im Jahre 1232 wurden von Papst und Kaiser zusammen die neuen, scharfen und grausamen Ketzergesetze ausgegeben, die so viel Unruhe in Deutschland veranlassten. Kaiser Friedrich beauftragte einen Dominikaner in Bremen, der Ketzerei nachzuspüren, verhängte über die Stedinger die Acht, nachdem er sie zusammen mit den Friesen erst fünf Jahre vorher wegen ihrer Taten im Heiligen Lande belobt hatte, und mahnte die Stadt Bremen, bei der Verfolgung mitzuwirken. Als der Erzbischof seiner Stadt den dritten Teil von dem zu erobernden Hab und Gut der Stedinger als Belohnung versprach, gelang es ihm, sie auf seine Seite zu bringen. Am 19. Oktober 1232 forderte der Papst durch die Bulle Intenta fallaciis sathanae zum Kreuzzuge gegen die Stedinger auf.
Die Stedinger waren entschlossen, alle Kraft und das Leben an die Verteidigung ihrer Freiheit zu setzen und taten es ruhmvoll. Zwei Kreuzheere besiegten sie, den Grafen von Oldenburg, der eins anführte, erschlugen sie. Die Gegner vermehrten ihre Anstrengungen, der Papst versprach in einer neuen Bulle denen, die das Kreuz nehmen würden, vollen Ablass. Weit und breit wurde geworben und gehetzt, als wäre das Reich, als wäre die Christenheit in Gefahr. Vergeblich machte sich der unglückliche junge König Heinrich, Kaiser Friedrichs Sohn, zum Anwalt der Verketzerten, er beschleunigte dadurch nur seinen eigenen Sturz. Dem dritten Kreuzheer, das ins Feld zog, glückte die Vollstreckung des Urteils; es waren daran beteiligt Graf Heinrich von Oldenburg, Graf Ludwig von Ravensberg, Graf Florentin von Holland, Graf Otto von Geldern, Herzog Heinrich der Jüngere von Brabant, Wilhelm von Jülich und Dietrich von Cleve. Der Adel musste viel aufwenden, um des kleinen Bauernvolkes Herr zu werden. Von denen, die die unglückliche Schlacht bei Altenesch überlebten, verließen viele das Land; Familien mit dem Namen Stedinger erschienen in verschiedenen Städten, auch in Lübeck und Hamburg. Die Güter der Stedinger wurden verteilt, ihre Freiheiten vernichtet. So unüberwindlich war der Unabhängigkeitssinn des Stammes, dass sie sich immer wieder, wenn auch ohne Aussicht und ohne Glück, erhoben; immerhin gelang es den Nieder-Stedingern gegenüber den Grafen von Oldenburg eine gewisse Selbstständigkeit zu bewahren.
Länger, nämlich bis ins sechzehnte Jahrhundert, erhielten sich die Friesen und die Dithmarscher frei.
Die vokalreiche, wohlklingende Sprache der Friesen, die, wie es scheint, mehr Ähnlichkeit mit dem Englischen als mit deutschen Dialekten hatte, verschwand schon im sechzehnten Jahrhundert. Eala frya Fresena – Heil, freier Friese, mit diesen Worten sollen die Friesen sich begrüßt haben. Die Freiheit gehörte zu ihnen, wie das Meer und die Marschen zu ihnen gehörten, sie hatten in ihr ein Element mehr als andere Menschen. Rechtlich führten sie ihre Freiheiten auf Karl den Großen zurück, und die Kaiser haben ihre Reichsunmittelbarkeit anerkannt. Es gibt eine Überlieferung, wonach Friesen, die Barbarossa nach Italien begleiteten, ihm bei einer Verschwörung in Rom das Leben gerettet hätten. Als er sie zum Dank alle zu Rittern schlagen wollte, hätten sie das abgelehnt, indem sie sagten: »Wir halten uns höher als deine Ritter an Rang und Ruhm, denn wir haben unser Land dem Meere abgerungen und besaßen es zu eigen, ehe anderen das ihre zu Lehen gegeben wurde.« Der Kaiser habe erwidert: »So mögt ihr denn des Reiches Adler in eurem Wappen führen zum Gedächtnis, dass ihr wacker mitgekämpft habt zu des Reiches Ehre!« Gewisse Geschlechter führten nämlich den halben Adler im Wappen. Wie die Stedinger und die Dithmarscher litten sie unter sich keinen Adel und keine Hörige, was nicht hinderte, dass begüterte oder sonst ausgezeichnete Familien besonders angesehen waren. Ihre Demokratie war sehr aristokratisch.
Die Dithmarscher, die das Land nördlich der Elbmündung bewohnten, waren überwiegend Niedersachsen, sehr hochgewachsen, mit schmalen Gesichtern, während die Friesen auch groß, aber mehr plump und breitgesichtig sind. Doch sind Friesen und Sachsen an der Nordsee so ineinander übergegangen, dass eine genaue Scheidung nicht möglich ist. Noch jetzt gibt es in Dithmarschen, überhaupt an der Elbmündung junge Menschen von leuchtender Schönheit, alte Menschen voll Tiefsinn und Würde, mit festen, markanten Zügen, so wie man sich germanischen Adel vorstellt. Bei ihnen erhielten sich altgermanische Sitten und Zustände zum Teil so, wie sie Tacitus geschildert hat. Sie gehörten ursprünglich zur Grafschaft Stade und mit ihr später zum Erzbistum Bremen. Als sie 1227 in der Schlacht von Bornhövede, durch welche die Herrschaft der Dänen in Niedersachsen gebrochen wurde, den Ausschlag zum Siege gaben, bedangen sie sich vom Erzbischof aus, dass er ihre Landesfreiheit unangetastet lasse, sodass sie sagen konnten, sie seien dem Erzstift verwandt und zugetan, nicht ihm unterworfen. Es war derselbe Erzbischof Gerhard II., der die Stedinger vernichtete. Die Dithmarscher behielten ihre Selbstverwaltung. Die fünf Vögte, durch die der Erzbischof seine Interessen im Lande wahrnehmen ließ, wurden aus den begüterten Landbesitzern Dithmarschens gewählt, und die entscheidende Stimme hatte die universitas terrae Dithmarsiae, die Landesgemeinde, die sich in Meldorf, der einzigen Stadt, versammelte. Später kam Lunden, als zweite Stadt, dazu. Ihre Pfarrer bestellten die Dithmarscher selbst; es galt das germanische Eigenkirchenrecht, nicht in dem Sinne, dass die Kirche ihrem Stifter gehörte, sondern so, dass die Gemeinde die kirchlichen Angelegenheiten selbst verwaltete. Das ganze Land war in Kirchspiele eingeteilt, zugleich politische und kirchliche Bezirke; darunter waren Meldorf, Büsum, Wesselburen.