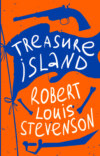Kitabı oku: «Die Schatzinsel», sayfa 12
Vierundzwanzigstes Kapitel
Die Fahrt des Fischerbootes
Es war heller Tag, als ich erwachte und sah, daß ich mich im Südwesten der Schatzinsel befand. Die Sonne war schon aufgegangen, doch war sie noch durch die hohe Wand des „Fernrohrs“ verdeckt, das auf dieser Seite in ungeheuren Klippen fast bis zum Meer herabkam. Der Haulbowlinegipfel und der Mizzenmasthügel standen seitlich von mir, der eine kahl und dunkel, der andere von vierzig bis fünfzig Fuß hohen Schluchten durchzogen, an deren Boden sich große Massen abgesplitterter Felsen türmten. Ich war kaum eine Viertelmeile vom Lande entfernt und mein erster Gedanke war daher, heranzurudern und zu landen. Diese Absicht mußte ich bald aufgeben. Zwischen den abgebröckelten Felsen brach sich die Brandung mit lautem Widerhall und hohe Springfluten stiegen und fielen, folgten einander von Sekunde zu Sekunde. Wenn ich mich in die Nähe wagte mußte ich entweder, an die felsige Küste geschleudert, den Tod finden oder vergeblich meine Kraft dabei verbrauchen, die vorstehenden Felsen zu erklimmen.
Doch das war nicht alles, denn plötzlich sah ich auf flachen Felsblöcken in Rudeln kriechend oder mit lautem Anprall in die See plumsend, riesige, schleimige Ungeheuer – weiche Schnecken von unglaublicher Größe schienen sie mir – die, vierzig oder sechzig beisammen, mit dem Lärm ihres Gekläffes die Felsen widerhallen machten.
Später erfuhr ich, daß das vollkommen harmlose Seelöwen waren, doch ihr Anblick, dazu die steilen Uferfelsen und die heftige Brandung, genügten, mich von der Landung hier abstehen zu lassen und ich war entschlossen lieber auf dem Meere zu verhungern als noch solche Gefahren zu bestehen.
Indessen lag vor mir eine bessere Landungsmöglichkeit. Nördlich vom Haulbowlinekopf erstreckt sich eine schmale Landzunge, die bei niedriger Flut einen langen Strich gelben Sandes zurückläßt. Nördlich davon liegt ein anderes Kap – das Waldkap – wie es auf der Karte bezeichnet war – unter hohen, grünen Nadelbäumen versteckt, welche bis zum Seeufer herabreichen.
Ich erinnerte mich an das, was Silver über die Strömung gesagt hatte, die der ganzen Westküste der Schatzinsel entlang nach Norden geht, und da ich aus meiner Lage ersah, daß ich bereits von ihr getragen wurde, zog ich es vor den Haulbowlinekopf hinter mir zu lassen und meine Kräfte für einen Landungsversuch an dem weniger gefährlich aussehenden Waldkap aufzusparen.
Die Wogen rollten hoch, aber gleichmäßig, der Wind blies stetig und mild vom Süden her und die Wellen stiegen und fielen ohne sich an der Strömung zu brechen.
Wäre es anders gewesen, hätte ich längst umgekommen sein müssen. So aber schwamm mein kleines Boot überraschend leicht und sicher dahin.
Oft sah ich, wie ich da auf dem Boden lag und nach dem Dollbord blickte, einen hohen, blauen Berg sich nahe vor mir erheben. Doch das Fischerboot sprang dann nur ein wenig in die Höhe, tanzte wie wenn es auf Federn ginge, und senkte sich jenseits des Wellenberges wieder leicht wie ein Vogel in die Mulde.
Nach einer Weile wuchs meine Kühnheit und ich versuchte meine Ruderkünste. Doch schon ein kleiner Wechsel im Gleichgewicht erzeugte heftige Veränderungen im Benehmen eines solchen Fischerbootes. Denn kaum hatte ich mich nur ein wenig bewegt, gab es sofort seine freundlich tänzelnde Bewegung auf und lief geradeaus einen so steilen Wasserberg hinab, daß ich ganz schwindlig wurde, dann steckte es seine Nase, während der Gischt hochaufspritzte, tief in die Seite der nächsten Welle hinein.
Ich wurde durchnäßt und erschreckt und nahm sofort meine frühere Lage ein, worauf auch das Fischerboot zur Besinnung zu kommen schien und mich so sanft wie früher durch die Wellen führte. Es schien klar, daß es keine Einmischung duldete. Doch wann konnte ich hoffen, da ich auf keine Weise seinen Lauf beeinflussen durfte, an Land zu kommen?
Ich fing an mich entsetzlich zu fürchten, doch verlor ich trotzdem nicht den Kopf. Langsam und mit äußerster Vorsicht bei meinen Bewegungen, schöpfte ich mit meiner Mütze das Wasser aus dem Boot; dann, mit den Augen ein wenig über dem Bootrand, begann ich zu studieren, wie es das Boot fertigbrachte, um so ruhig zwischen den höchsten Wellen durchzukommen.
Ich fand heraus, daß jede Welle durchaus nicht der große, weiche, glatte Berg war, als der sie vom Ufer oder von einem Schiffsdeck aus erschien, sondern in Wirklichkeit wie irgendein Gebirge auf dem trockenen Lande aus Spitzen, ebenen Flächen und Tälern bestand. Das Fischerboot schlängelte sich, wenn man es sich selbst überließ, ganz auf eigene Faust durch diese tieferen Teile und vermied die steilen Abhänge und hohen Gipfel der Wellen.
Nun gut, dachte ich, es ist also klar, daß ich ruhig liegen muß, um nicht das Gleichgewicht zu stören, doch ist es ebenso klar, daß ich das Ruder an ruhigen Stellen von Zeit zu Zeit benützen kann, um das Boot mit ein oder zwei Schlägen mehr landwärts zu lenken. Gesagt, getan. Da lag ich also auf meinen Ellbogen in der anstrengendsten Haltung und machte von Zeit zu Zeit einen oder zwei schwache Ruderschläge, um die Bootspitze landwärts zu drehen.
Es war eine sehr ermüdende und langsame Arbeit, doch gewann ich sichtlich Boden und als wir nahe an das Waldkap kamen, sah ich, daß ich zwar unfehlbar diesen Punkt verfehlen werde, doch war ich nur mehr einige hundert Meter östlich davon. Ich konnte die luftigen, grünen Baumspitzen sich im Winde bewegen sehen und war ganz sicher, daß ich am nächsten Vorgebirge unbedingt würde landen können.
Es war höchste Zeit, denn der Durst begann mich zu quälen. Die glühende Sonne über mir, ihr tausendfacher Widerschein von den Wellen her, das Seewasser, das mich bespritzte und auf mir trocknete, das sogar meine Lippen mit Salz förmlich zusammenbuk, all das brannte mir in der Kehle und quälte mein Gehirn. Als ich die Bäume so nahe sah, wurde ich vor Sehnsucht beinahe krank. Doch die Strömung führte mich bald weiter und als ich wieder die offene See vor mir sah, hatte ich einen Augenblick, der meine Gedanken in ganz andere Bahnen lenkte.
Gerade vor mir sah ich die Hispaniola unter Segel. Doch war ich vor Durst so außer mir, daß ich kaum wußte, ob ich froh oder traurig wäre, wenn sie mich überfahren würde. Ehe ich aber zu einem Schlusse gekommen war, hatte mich die Überraschung ganz überwältigt und ich konnte nur hinstarren und staunen.
Die prachtvoll weiße Leinwand der Hispaniola blinkte wie Schnee oder Silber in der Sonne. Als ich sie zuerst sichtete waren alle Segel gespannt und sie nahm den Kurs ungefähr Nordwest. Ich nahm an, daß die Leute an Bord um die Insel herum wollten, um wieder zurück zum Ankerplatz zu gelangen. Plötzlich fing sie an sich mehr und mehr nach Westen zu wenden, so daß ich schon glaubte man habe mich von dort gesichtet und jage mir nach. Schließlich aber stand sie eine ganze Zeitlang hilflos vor dem Winde mit schlaffen Segeln.
„Ungeschickte Kerle,“ dachte ich mir, „die müssen noch immer ganz betrunken sein!“ Und ich stellte mir vor, wie Kapitän Smollett sie behandelt hätte. Inzwischen wiederholte sich immer wieder dasselbe Manöver: Das Schiff segelte ein paar Minuten rasch, blieb wieder liegen und pendelte dann wieder hin und her, hinauf und hinunter, nach Norden, Süden, Osten und Westen, und jede solche Bewegung endete wie sie begonnen hatte, mit schlaff herunterhängendem Segel. Es wurde mir nun klar, daß niemand steuerte. Doch wenn es so war, wo waren die Matrosen? Entweder tödlich besoffen oder sie hatten das Schiff verlassen, dachte ich, und vielleicht könnte ich, wenn ich an Bord gelangte, das Schiff seinem Kapitän zurückgeben.
Die Strömung trug in gleichem Tempo Fischerboot und Schooner nach Süden. Der Schooner segelte so wild und unregelmäßig und lag nach jedem Anlauf so lange still, daß er gar nicht vorwärts kam. Wenn ich es nur wagen könnte mich aufzusetzen und zu rudern, war ich sicher ihn einholen zu können. Dieser Plan hatte einen abenteuerlichen Beigeschmack, der mich begeisterte, und der Gedanke an den Wasserbehälter in der Kabine erhöhte meinen Mut.
Ich setzte mich auf, wurde fast im selben Augenblick wiederum mit einem Strahl von Gischt überschüttet, doch blieb ich fest bei meiner Absicht und machte mich daran mit aller Kraft und Vorsicht der steuerlosen Hispaniola nachzurudern. Einmal geriet ich in so schwere See, daß ich mit klopfendem Herzen innehalten und Wasser ausschöpfen mußte. Doch nach und nach wußte ich, was ich zu tun hatte und führte mein Fischerboot, trotzdem ich hie und da einen Wasserstrahl ins Gesicht und das Boot einen Stoß in den Bug bekam, sicher durch die Wellen.
Ich kam dem Schooner nun rasch näher und konnte das Metall des Helms in der Sonne glitzern sehen, doch noch immer war keine Seele auf Deck zu erblicken. Es blieb keine andere Wahl als anzunehmen, daß das Schiff verlassen worden war, und wenn nicht, so lagen die Leute betrunken unter Deck, wo ich sie einsperren konnte und das Schiff zu meiner Verfügung hätte.
Eine Zeitlang tat es das für mich unangenehmste – es stand still. Es stand fast nach Süden, natürlich fortwährend gierend. So oft es zurückfiel, füllten sich die Segel ein wenig und dann drehte es sich gleich gegen den Wind. Ich sagte schon, daß dies für mich das Schlechteste war, das geschehen konnte; denn so hilflos der Schooner in solcher Lage auch aussah, er fuhr fort von mir davonzulaufen, nicht bloß so schnell ihn die Strömung stieß, sondern mit dem ganzen Gewicht seiner Abtrift. Doch schließlich hatte ich Glück. Die Brise legte sich sekundenlang und da die Strömung das Schiff allmählich herumzog, drehte es sich langsam um seine Achse und wandte mir endlich das Achterdeck zu mit dem immer noch weitgeöffneten Kabinenfenster und der Lampe über dem Tische, die in den Tag hinein weiterbrannte. Das Hauptsegel hing wie eine Fahne herab. Die Hispaniola stand still bis auf die durch die Strömung erzeugte Bewegung.
Während der letzten Minuten war ich etwas zurückgeblieben, doch jetzt verdoppelte ich meine Anstrengungen und nahm die Jagd von neuem auf.
Ich war keine hundert Meter mehr von ihr entfernt, als der Wind mit einem Schlag wieder einsetzte und schon flog sie wie eine Schwalbe wieder weit fort.
Meine erste Regung war Verzweiflung, die sich jedoch sofort in Freude verwandelte. Denn sie drehte sich bis sie mit der Breitseite zu mir stand, kam näher und hatte bald die Hälfte, dann zwei Drittel und endlich drei Viertel der Entfernung zwischen uns wieder eingebracht. Ich konnte die Wellen weiß unter ihrem Bug hervorschimmern sehen. Ungeheuer groß erschien sie mir von meiner tiefen Stellung aus dem Fischerboot heraus.
Und da begann ich plötzlich zu begreifen. Ich hatte kaum Zeit zu denken – kaum Zeit zu handeln und mich zu retten. Ich war auf der Spitze eines Wellenberges und schon beugte sich der Schooner über den nächsten. Der Bugspriet stand über meinem Kopfe. Ich sprang auf die Füße, faßte mit der einen Hand den Klüverbaum, während mein Fuß zwischen dem Stag und der Brasse stand. Und als ich dort noch keuchend hing, zeigte mir ein dumpfer Schlag an, daß der Schooner sich gesenkt und mein Fischerboot getroffen hatte und daß ich nunmehr allein auf die Hispaniola angewiesen war.
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Ich ziehe die Piratenfahne ein
Kaum hatte ich den Bugspriet erfaßt, als der Klüverbaum den anderen Bug mit einem schußähnlichen Knall traf. Der Schooner zitterte bis in den Kiel unter der Umsteuerung, doch im nächsten Augenblick flog der Klüver, während die anderen Segel weiter angespannt waren, wieder zurück.
Das hätte mich fast in die See gestoßen; darum verlor ich jetzt keine Zeit, sondern kroch den Bugspriet entlang und taumelte, mit dem Kopf nach vorne, auf Deck. Ich war auf der Leeseite des Vorderkastells, und das Hauptsegel, das noch gespannt war, verbarg mir einen Teil des Achterdecks. Keine Seele war zu sehen. Der Fußboden, welcher seit der Meuterei nicht mehr aufgewaschen worden war, zeigte viele Fußspuren und eine leere Flasche, der der Hals abgebrochen war, tummelte sich wie ein lebendiges Wesen im Speigat herum.
Plötzlich kam die Hispaniola richtig in den Wind. Die Klüver hinter mir krachten laut, das Steuerruder schlug an und das ganze Schiff hob sich und erzitterte, während sich der Hauptmast nach innen drehte, die Segel sich lüfteten und mir das Achterdeck enthüllten.
Da waren auch die beiden Wachen:
Rotmütze lag auf dem Rücken, steif wie ein Stück Holz, die Arme weit ausgestreckt und durch die geöffneten Lippen zeigte er seine Zähne; Israel Hands an die Reeling gelehnt, das Kinn auf die Brust herabgefallen, die Hände offen vor sich hingestreckt, mit einem Gesicht, das weiß war wie Wachs.
Eine Zeitlang fuhr das Schiff fort zu bocken und sich zu bäumen wie ein ungebärdiges Roß, die Segel füllten sich bald auf der einen, bald auf der anderen Seite und die Spiere schwang auf und ab, bis der Mast unter dem Druck laut ächzte. Dann und wann sprang eine Wolke leichten Schaumes über die Reeling und manchmal schlug der Schiffsbug schwer gegen die Dünung.
Das große, aufgetakelte Schiff brachte natürlich eine viel größere Bewegung hervor als mein kleines, schiefwandiges Fischerboot, das jetzt auf dem Boden der See ruhte.
Bei jedem Sprung des Schooners glitt die Rotmütze hin und her, was geisterhaft anzusehen war und auch seine Haltung und sein starres Grinsen, das die Zähne entblößte wurde durch die heftige Bewegung nicht verändert. Bei jedem Sprung schien auch Hands mehr in sich selbst hineinzusinken und sich auf das Deck niederzulassen, so daß seine Füße immer weiter hinausglitten und der ganze Körper mehr zum Achterdeck zu gebogen wurde, bis schließlich sein Gesicht von mir aus nicht mehr zu sehen war und ich außer seinem Ohr und einer zerzausten Locke seines Backenbartes nichts mehr von ihm erblicken konnte.
Gleichzeitig bemerkte ich rund um die beiden Männer Spritzer dunklen Blutes auf dem Boden und begann als sicher anzunehmen, daß sie einander in ihrer trunkenen Wut getötet hatten.
Während ich noch entgeistert hinsah, drehte sich Israel Hands in einem ruhigen Moment als das Schiff stillstand teilweise herum und arbeitete sich mit einem Stöhnen wieder in die Lage hinüber, in der ich ihn zuerst erblickt hatte. Das Stöhnen, das mir seine Schmerzen und seine tödliche Schwäche verriet und die Art, in der seine Kinnbacken aufgerissen herunterhingen, ging mir zu Herzen, doch wenn ich an das Gespräch dachte, das ich aus dem Äpfelfaß belauscht hatte, verließ mich jedes Mitleid. Ich schritt hinüber bis zum Hauptmast.
„Kommt an Bord, Herr Hands“, sagte ich ironisch. Er rollte finster die Augen, doch war er zu schwach, um Erstaunen zu zeigen, er konnte nur das eine Wort hervorbringen: „Branntwein!“
Mir schien es, daß da keine Zeit zu verlieren war und indem ich dem Klüverbaum auswich, der wieder über das Deck schlingerte schlüpfte ich die Kajütentreppe hinunter in die Kabine. Dort fand ich eine unbeschreibliche Unordnung. Alle versperrbaren Möbel waren auf der Suche nach der Karte aufgebrochen worden, auf dem Fußboden lag dicker Schmutz, dort wo die Schurken sich zum Trinken oder zur Beratung niedergelassen hatten, nachdem sie in dem Morast rund um ihr Lagerfeuer herumgewatet waren. Die Wände, alle sauber weiß ausgemalt und rings mit goldenen Kränzen geschmückt, zeigten die Abdrücke schmutziger Finger. Beim Rollen des Schiffes klirrten Dutzende von leeren Flaschen in den Winkeln aneinander. Eines von den medizinischen Büchern des Doktors lag offen auf dem Tische, mit zur Hälfte herausgerissenen Blättern, die, wie es schien, als Fidibusse verwendet worden waren – und auf alle diese Unordnung warf die blakende Lampe noch immer ihren trüben Schein.
Als ich in den Keller kam, fand ich, daß die Fässer fort waren und eine überraschend große Anzahl Flaschen geleert und weggeworfen worden waren. Zweifellos war seit Beginn der Meuterei kein Mann nüchtern geblieben.
Auf meiner Suche nach Eßwaren fand ich endlich eine Flasche, in der noch etwas Branntwein war, für Hands, und für mich ein paar Zwiebackstücke, eingemachte Früchte, eine große Malagatraube und ein Stück Käse. Damit beladen kam ich auf Deck, verstaute meine eigene Portion hinter den Rudern, so daß sie der Bootsführer nicht erreichen konnte, ging zum Wasserbehälter und trank einen guten langen Schluck Wasser, und erst dann und nicht früher gab ich Hands von dem Branntwein.
Er muß eine Viertelpinte getrunken haben, so lange dauerte es, bis er die Flasche vom Munde hob.
„Ja,“ sagte er, „beim Teufel, das habe ich gebraucht!“
Ich saß schon in meinem Winkel und begann zu essen.
„Stark verletzt?“ fragte ich ihn.
Er grunzte oder bellte vielmehr.
„Wenn dieser Doktor an Bord wäre,“ sagte er, „wäre ich bald wieder obenauf, aber ich bin ein Pechvogel, das ist die Sache bei mir. Der Waschlappen da, der ist tot,“ fügte er hinzu, auf die Rotmütze zeigend, „übrigens war er ja kein Seemann. Aber wo kommst denn du her?“
„Nun“, sagte ich, „ich bin an Bord gekommen, um dieses Schiff in Besitz zu nehmen, Herr Hands, und Ihr habt mich gefälligst bis auf weiteres als Euren Kapitän zu betrachten.“
Er sah mich ziemlich scheel an, sagte aber nichts. Ein wenig Farbe war wieder in seine Wangen zurückgekehrt, doch sah er noch immer sehr schlecht aus und rutschte noch immer bei jedem Ruck des Schiffes hilflos aus.
„Und übrigens“, fuhr ich fort, „mag ich diese Fahne nicht, Herr Hands und werde sie mit Eurer Erlaubnis einziehen. Lieber gar keine als diese.“
Und ich duckte mich wieder unter dem Klüverbaum, lief zur Flaggenstange, riß die verfluchte, schwarze Fahne herunter und warf sie über Bord.
„Gott schütze den König!“ sagte ich, meine Mütze lüftend, „und mit Kapitän Silver ist es jetzt aus.“
Er beobachtete mich scharf und schlau, während sein Kinn immer noch auf die Brust herunterhing.
„Ich glaube,“ sagte er endlich, „ich glaube, Kapitän Hawkins, Ihr werdet vielleicht an Land gehen wollen, jetzt. Darüber könnten wir reden.“
„Freilich,“ sagte ich, „natürlich, Herr Hands! Sagt was Ihr zu sagen habt.“ Und ich setzte mich mit gutem Appetit wieder zu meiner Mahlzeit.
„Dieser Mann da,“ er nickte schwach zu der Leiche hinüber – „O’Brien hieß er, ein widerlicher Irländer – , dieser Mann und ich haben das Segel aufgezogen und wollten zurücksegeln. Na, der Mann ist tot, so tot wie ein Schiffsrumpf. Wer jetzt das Schiff segeln soll, weiß ich nicht. Wenn ich Euch dabei nicht helfe, seid Ihr wohl nicht der Mann dazu, kommt mir vor. Ich sag Euch was: Ihr gebt mir zu essen und zu trinken und einen alten Schal oder ein Sacktüchel, um meine Wunde zu verbinden, und dafür sage ich Euch, wie man segeln muß. Ich glaube das ist ein ehrlicher Handel.“
„Ich will nicht zurück zu Kapitän Kidds Ankerplatz,“ sagte ich, „ich will in die Nordbucht und dort ruhig vor Anker gehen.“
„Ja natürlich wollt Ihr das,“ rief er, „ich bin doch schließlich kein so verteufelter Tölpel. Ich seh doch, was vorgeht, nicht wahr? Ich hab meinen Wurf probiert und verloren und Ihr habt mir den Wind abgefangen. Nach der Nordbucht? Aber ich hab doch keine Wahl! Ich würde Euch auch helfen die Hispaniola zum Hinrichtungsdock zu segeln, beim Teufel, das würd ich!“
Das schien mir ganz vernünftig. Wir schlossen sofort das Geschäft ab. Nach drei Minuten segelte die Hispaniola längs der Küste der Schatzinsel leicht vor dem Wind und ich hatte begründete Hoffnung die nördliche Spitze vor Mittag zu erreichen und bei der Nordbucht noch vor hohem Wasserstand zu sein, so daß wir sicher ankern und dann warten konnten, bis uns die zurückgehende Flut die Möglichkeit gab an Land zu gehen.
Dann band ich die Ruderpinne an und ging zu meinem eigenen Koffer, aus dem ich ein weiches, seidenes Tuch meiner Mutter herausnahm. Damit verband Hands mit meiner Hilfe die große, blutende Stichwunde, die er in den Schenkel bekommen hatte und nachdem er etwas gegessen und noch ein paar Schluck Branntwein genommen hatte fing er an sich sichtlich wieder aufzurichten, sprach lauter und deutlicher und war überhaupt ein anderer Mensch geworden.
Die Brise war uns sehr günstig. Wir glitten wie ein Vogel vor ihr her, die Küste flog vorüber und die Aussicht wechselte jeden Augenblick. Bald hatten wir die Hochfläche passiert und fuhren an niedrigem Sandland vorbei, das mit Zwergfichten spärlich bestanden war und dann wendeten wir uns um die Ecke des Felsenberges, der die Insel im Norden begrenzt.
Ich war in sehr gehobener Stimmung über mein neues Kommando und entzückt von dem schönen, sonnigen Wetter und den verschiedenartigen Ausblicken auf die Küste. Ich hatte nun genug Trinkwasser und gute Sachen zum Essen und mein Gewissen, das wegen meiner Flucht sehr unruhig gewesen war, war jetzt durch die große Eroberung, die ich gemacht hatte, beruhigt. Mir blieb nichts zu wünschen übrig, nur die Augen des Bootsführers, die mich spöttisch verfolgten und das sonderbare Lächeln, das fortwährend auf seinem Gesicht spielte, störten mich. Es war ein Lächeln, das einen Zug von Schmerz und Schwäche hatte – das Lächeln eines abgehärmten, alten Mannes – , aber ein Körnchen Spott, ein Schatten von Verrat lag dennoch in seinem Ausdruck, wie er mich da bei meiner Arbeit listig beobachtete, beobachtete, beobachtete.