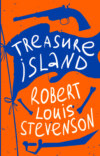Kitabı oku: «Die Schatzinsel», sayfa 13
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Israel Hands
Der Wind, der unseren Wünschen entgegenkam wandte sich jetzt nach Westen und wir konnten nun um so leichter vom nordwestlichen Winkel der Insel an die Mündung der kleinen Landzunge fahren, doch wagten wir es nicht, das Schiff an den Strand laufen zu lassen, ehe die Flut ein wenig weiter weg war, da wir keine Möglichkeit hatten Anker zu werfen. Der Bootsführer sagte mir, wie ich das Schiff beilegen sollte und als mir das nach einer Reihe von Versuchen gelungen war, setzten wir uns schweigend zum Essen.
„Kapitän!“ sagte er schließlich mit demselben unbehaglichen Lächeln, „könntet Ihr nicht meinen alten Schiffskameraden da, den O’Brien, über Bord werfen? Ich bin für gewöhnlich nicht heiklich und ich geniere mich nicht, weil ich ihn zu Brei geschlagen habe, aber ich finde, er ist nicht gerade ein Zimmerschmuck, wie er daliegt; hab ich recht?“
„Dazu bin ich nicht stark genug und ich mag auch so eine Arbeit nicht,“ sagte ich, „und von mir aus kann er hier liegen bleiben.“
„Jim, das ist ein unseliges Schiff, diese Hispaniola“, fuhr er blinzelnd fort.
„Ein Schüppel Männer tot von dieser Hispaniola – eine Menge armer Matrosen hin, seit wir zwei in Bristol zur See gegangen sind. Ich hab noch nie solch ein dreckiges Pech gesehen. Ich nicht. Da ist dieser O’Brien da – er ist doch tot, nicht wahr? Ja also, ich bin kein Gelehrter und Ihr seid ein Bursch, der lesen und rechnen kann. Na, und um es gerade herauszusagen, glaubt Ihr, daß ein Toter einfach tot ist für immer oder kann er wieder lebendig werden?“
„Man kann den Leib töten, Herr Hands, doch nicht den Geist, das müßt Ihr schon wissen,“ erwiderte ich, „O’Brien ist in einer anderen Welt und vielleicht beobachtet er uns.“
„So!“ sagte er, „nun, das ist unangenehm – scheint also, abmurksen ist schade um die Zeit. Na, hol’s der Kuckuck, vor Geistern braucht man sich nicht viel zu fürchten, das hab’ ich schon gesehen. Mit den Geistern will ich es schon noch aufnehmen. Und jetzt haben wir uns ausgesprochen, Jim, und es wär sehr nett von Euch, wenn Ihr da in die Kabine hinuntergehen würdet und mir – ja was denn? – ich kann mich an den Namen nicht erinnern – ja, also wenn Ihr mir eine Flasche Wein bringen würdet, Jim – der Branntwein da ist mir zu stark.“
Die zögernde Ausdrucksweise des Bootsführers kam mir unnatürlich vor und seine Behauptung, daß er Wein dem Branntwein vorziehe, glaubte ich schon gar nicht. Die ganze Geschichte war ein Vorwand. Er wollte, daß ich das Deck verlasse – soviel war gewiß; aber zu welchem Zweck, das konnte ich mir absolut nicht vorstellen. Ich begegnete niemals seinem Blick. Seine Augen schweiften fortwährend hin und her, hinauf und hinunter, hafteten einmal mit einem flüchtigen Blick am Himmel und dann wieder mit einem scheuen Blinzeln auf dem toten O’Brien. Dabei lächelte er ununterbrochen und steckte seine Zunge so schuldbewußt und verlegen heraus, daß ein Kind hätte erraten können, er sinne auf Betrug. Trotzdem stimmte ich ihm sofort bei, denn ich sah, daß das für mich vorteilhafter sei und daß ich einem so besonders dummen Kerl meinen Verdacht jederzeit leicht verbergen könne.
„Wein?“ sagte ich, „Herr! Wollt Ihr weißen oder roten?“
„Nun, es ist mir verflucht gleichgültig, Kamerad, wenn nur genug davon da ist und wenn er stark ist.“
„Gut,“ antwortete ich, „ich werde Euch Porter bringen, Herr Hands, aber eine Weile wird es schon dauern, bis ich welchen ausgrabe.“
Und damit rannte ich, so lärmend ich konnte, die Kajütentreppe hinunter, zog meine Schuhe aus, lief leise den Gang entlang zurück, stieg auf die Vorkastelleiter und schaute aus dem Kajütenfenster hinaus. Ich wußte, daß er nicht annehmen konnte mich dort zu sehen, doch machte ich es so vorsichtig wie möglich. Und richtig erwiesen sich meine ärgsten Vermutungen als nur zu richtig.
Er hatte sich aus seiner Lage erhoben, auf Hände und Knie gestützt und trotzdem ihn sein Bein sichtlich sehr schmerzte – ich hörte ihn unterdrückt stöhnen – , schleppte er sich doch ziemlich flink über das Deck. In einer halben Minute hatte er die Speigatluke erreicht und aus einer Tauwerkrolle ein langes Messer herausgezogen, das bis zum Griff mit Blut besudelt war. Er schaute es einen Moment an, indem er seinen Unterkiefer vorstreckte, probierte die Spitze auf der Handfläche, dann verbarg er es hastig unter seiner Jacke und wälzte sich wieder zu seinem alten Platz an der Reeling zurück.
Das war alles, was ich wissen wollte. Israel konnte sich bewegen, er war jetzt bewaffnet, und da er mich vorhin so eifrig loswerden wollte, war es klar, daß ich das Opfer sein sollte. Was er dann tun wollte, ob er versuchen wollte quer durch die Insel zum Lager bei den Sümpfen zu kriechen oder ob er den langen Tom abfeuern wollte, im Vertrauen darauf, daß seine Kameraden ihm gleich zu Hilfe kommen würden, das war natürlich mehr als ich wissen konnte.
Doch in einem Punkte konnte ich mich auf ihn verlassen, da unsere Interessen dabei zusammengingen: das war die Lenkung des Schooners. Wir beide wünschten ihn sicher an Land zu bringen, auf einen geschützten Platz, wo man ihn, wenn es dazu an der Zeit war, mit so wenig Arbeit und Gefahr wie möglich wieder fortbringen könnte. Solange das nicht vollbracht war, würde er mir sicherlich nicht den Garaus machen.
Während ich diese ganze Sache überdachte, war ich nicht müßig geblieben, sondern war leise in die Kabine zurückgeschlüpft, hatte wieder meine Schuhe angezogen, eine beliebige Flasche Wein mitgenommen und so ausgerüstet erschien ich wieder auf Deck.
Hands lag wie ich ihn verlassen hatte, wie ein Häuflein Elend mit halbgeschlossenen Augen, als sei er zu schwach das Licht zu ertragen. Immerhin blickte er auf als ich kam, brach der Flasche den Hals so geschickt wie einer, der das schon oft gemacht hat und nahm einen guten Schluck und sagte seinen Lieblingstoast „Gut Glück“. Dann lag er eine Weile still und zog schließlich eine Rolle Tabak heraus und bat mich ihm ein Priemchen zu schneiden.
„Schneidet mir ein bißchen davon, denn ich hab kein Messer und habe auch nicht die Kraft dazu, selbst wenn ich eines hätte. Ach Jim, Jim, ich glaube, mit mir ist’s aus! Schneidet mir ein Priemchen, es wird wohl das letzte sein, Junge, denn ich bin auf dem Weg in meine ewige Heimat, ganz gewiß!“
„Gut,“ sagte ich, „ich werde Euch Tabak schneiden, aber wenn ich an Eurer Stelle wäre und mich so elend fühlte, dann würde ich zu beten anfangen wie ein Christ.“
„Warum?“ sagte er, „jetzt sagt mir, warum.“
„Warum?“ rief ich, „Ihr habt mich doch gerade wegen der Toten gefragt. Nun, Ihr habt Euren Eid gebrochen; Ihr habt in Sünde, Lüge und Blut gelebt. Ein Mensch, den Ihr getötet habt, liegt in diesem Augenblick zu Euren Füßen; Gott schütze Euch. Und Ihr fragt, warum?“
Ich sprach ein wenig hitzig, denn ich dachte an den blutigen Dolch, den er in seiner Tasche versteckt hatte und der in seinen bösen Gedanken bestimmt war mir den Garaus zu machen.
Er hingegen nahm einen großen Schluck Wein und sagte mit ganz ungewöhnlicher Feierlichkeit:
„Seit dreißig Jahren segle ich jetzt auf dem Meere und habe gutes und schlechtes, besseres und schlechteres, schönes und dreckiges Wetter erlebt, habe mitgemacht, daß die Vorräte ausgingen, Messerstechen und noch mancherlei. Aber ich will Euch was sagen: ich hab’ noch niemals gesehen, daß aus Güte was Gutes entsteht. Wer zuerst schlägt, der ist mein Mann. Tote Leute beißen nicht – das ist meine Ansicht. Amen, so sei es. Und nun schaut her,“ fuhr er in plötzlich verändertem Tone fort, „genug von dem Unsinn. Die Flut steht gerade richtig. Nun nehmt gefälligst meine Befehle an, Kapitän Hawkins, dann werden wir im Nu drin sein und die Sache ist erledigt.“
Alles in allem hatten wir kaum mehr zwei Meilen zu segeln, doch war die Einfahrt in diesen nördlichen Ankerplatz nicht nur schmal und seicht, sondern drehte sich östlich und westlich und war darum schwierig zu bewerkstelligen, so daß der Schooner sehr vorsichtig hineingelotst werden mußte. Ich glaube, daß ich ein guter, flinker Untergebener war und ganz sicher war Hands ein vorzüglicher Pilot, denn er lenkte hierher und dorthin und manövrierte vorsichtig und vermied die Klippen mit einer Sicherheit und Sorgfalt, daß es eine Freude war.
Kaum hatten wir das Vorgebirge passiert, so waren wir von Land umschlossen. Die Ufer der Nordbucht waren so dicht bewaldet wie die des südlichen Ankerplatzes, doch war die Zunge länger und schmäler und es sah hier aus wie die Mündung eines Flußlaufes, was es ja tatsächlich war. Gerade vor uns am südlichen Ende lag ein fast ganz zertrümmertes Schiffswrack im letzten Stadium der Auflösung.
Es war ein großer Dreimaster, doch schien er schon sehr den Unbilden des Wetters ausgesetzt, da er ganz mit großen Büscheln Seetang bewachsen war. Auf Deck hatten ein paar Schößlinge der Ufergebüsche Wurzel gefaßt und standen jetzt in Blüte. Ein trauriger Anblick, doch gab er uns volle Gewißheit darüber, daß dieser Ankerplatz windstill war.
„Schaut her,“ sagte Hands, „das ist ein nettes Fleckchen zum Landen. Schöner flacher Sand, keine Katze zu sehen, ringsherum Bäume und Blumen wie in einem Garten auf dem alten Schiff da.“
„Und wenn wir erst gelandet sind,“ fragte ich, „wie sollen wir die Hispaniola wieder wegkriegen?“
„Sehr einfach,“ antwortete er, „wenn die Ebbe kommt nehmt Ihr ein Seil hinüber ans Ufer; dort legt Ihr es um eine der großen Fichten, kehrt um, bringt das Seil mit und legt es um den Gangspill, dann wartet Ihr auf die Flut. Wenn das Wasser hoch geht, alles an Bord zieht an dem Seil! Das Schiff schwimmt wie am Schnürchen. Und jetzt, mein Junge aufgepaßt, wir werden es gleich haben! Aber sie geht zu schnell, ein wenig nach Steuerbord – so – Vorsicht – Steuerbord – Backbord – ein wenig nur – vorsichtig – vorsichtig!“
So gab er seine Befehle, die ich atemlos befolgte. Und plötzlich schrie er: „Jetzt fest nach Luv!“ Ich wendete fest das Steuer, die Hispaniola drehte sich rasch herum und lief mit dem Steven das niedrige, bewaldete Ufer an.
Die Aufregung während dieser letzten Manöver hatte mich etwas von der scharfen Beobachtung des Bootsführers abgelenkt. Und auch jetzt noch war ich vom Interesse für unsere Landung so in Anspruch genommen, daß ich die Gefahr, die über meinem Haupte schwebte, ganz vergaß und über die Steuerbordreeling gelehnt dastand und auf das Wasser hinaussah. Er hätte mich kampflos niedermachen können, wenn mich nicht eine plötzliche Unruhe befallen hätte, so daß ich mich umdrehte. Vielleicht hatte ich ein Knarren gehört oder irgendwie seinen Schatten aus einem Winkel meines Auges bemerkt, vielleicht war es ein Instinkt wie der einer Katze – kurz, als ich mich umdrehte, war Hands schon den halben Weg zu mir mit dem Messer in der rechten Hand.
Wir müssen beide laut aufgeschrien haben als unsere Blicke sich trafen. Doch mein Schrei war ein Schreckensschrei, seiner das Wutbrüllen eines losgehenden Stieres. Im selben Augenblick warf er sich nach vorne und ich sprang seitwärts gegen den Bug. Dabei hatte ich den Helmstock losgelassen, der leewärts schnellte und mir so das Leben rettete, denn er schlug Hands so heftig vor die Brust, daß er taumelte. Ehe er sich erholen konnte, war ich aus dem Winkel, in den er mich wie in eine Falle gelockt hatte, draußen, und hatte nun das ganze Deck zu meiner Verfügung. Vor dem Hauptmast hielt ich inne, zog eine Pistole aus der Tasche, zielte ruhig, obwohl er sich inzwischen umgedreht hatte und wieder auf mich zukam und drückte ab. Der Hammer fiel, doch folgte weder Blitz noch Knall, denn das Seewasser hatte die Zündung verdorben. Ich verfluchte meine Nachlässigkeit. Warum hatte ich nicht längst meine einzigen Waffen untersucht und neu geladen? Dann hätte ich nicht, wie jetzt, ein schwaches flüchtiges Schaf, vor diesem Schlächter zittern müssen.
Es war geradezu merkwürdig, wie rasch er sich trotz seiner Verwundung bewegen konnte, während sein graues Haar über sein Gesicht fiel, das vor Haß und Wut hochrot war. Ich hatte keine Zeit meine andere Pistole zu probieren und auch gar keine Lust dazu, denn es war klar, daß es nutzlos sein mußte. Eines war sicher: Ich konnte mich nicht einfach vor ihm zurückziehen, denn er würde mich sonst bald in den Bug jagen, wie er mich vor einem Augenblick fast in den Hintersteven gelockt hatte, und war ich einmal gefangen, so waren acht bis zehn Zoll des blutgetränkten Messers meine letzte Erfahrung in dieser Welt. Ich umfaßte den Hauptmast, der ziemlich dick war mit beiden Handflächen und wartete nun mit gespannten Nerven.
Da er sah, daß ich ihn überlisten wollte, hielt auch er ein, und ein oder zwei Augenblicke vergingen mit Scheinbewegungen seinerseits, die ich entsprechend erwiderte. Dieses Spiel hatte ich oft zu Hause zwischen den Felsen der Schwarzhügelbucht gespielt, doch sicherlich nie mit so wildklopfendem Herzen wie diesmal. Immerhin, es war, wie ich sagte, ein Knabenspiel, und ich glaubte wohl mich darin gegen einen ältlichen Seemann mit verwundetem Schenkel behaupten zu können. Ja, mein Mut begann so zu wachsen, daß ich mir einige rasche Gedankensprünge erlaubte und mir das Ende dieses Spieles vorzustellen versuchte. Und während ich als sicher annahm, daß ich es ziemlich lange ausspinnen könnte, sah ich doch keine Hoffnung für ein endgültiges Entkommen.
Aber während die Dinge so standen, lief das Schiff plötzlich mit einem Ruck auf, schwankte, grub sich einen Augenblick in den Sand und kippte dann mit einem Schlag über, bis das Deck in einem Winkel von fünfundvierzig Grad stand und eine tüchtige Menge Wasser durch die Speigatlöcher hereinfloß und einen förmlichen Teich zwischen Deck und Reeling bildete. Wir beide wurden in einer Sekunde umgeworfen und rollten fast gleichzeitig in das Speigat. Die tote Rotmütze taumelte uns mit immer noch steif ausgestreckten Armen nach und so nahe waren wir einander, daß mein Kopf gegen den Fuß des Bootsführers anstieß, daß mir die Zähne krachten. Trotz der Erschütterung war ich als erster wieder auf den Beinen, denn Hands war mit dem Leichnam aneinander geraten. Die plötzliche Neigung des Schiffes machte es unmöglich auf Deck herumzulaufen und ich mußte einen anderen Weg zur Flucht suchen, und zwar sofort, denn mein Feind berührte mich schon fast. Schnell wie ein Gedanke sprang ich in die Besanwanten, kletterte rasch hinauf und tat keinen Atemzug, bis ich oben auf dem Kreuzmast saß.
Meine Schnelligkeit hatte mich gerettet, denn das Messer stak etwa einen halben Fuß unter mir und Israel Hands stand da mit offenem Munde und aufwärtsgewendetem Gesicht wie eine Statue der Überraschung und Enttäuschung.
Jetzt, da ich einen Augenblick für mich hatte, verlor ich keine Zeit, wechselte die Zündung meiner Pistole und als die eine in Ordnung war, ging ich daran, die zweite zu laden, um doppelt sicher zu gehen.
Meine neue Beschäftigung war ein schwerer Schlag für Hands; er fing an einzusehen, daß das Spiel sich gegen ihn wendete. Nach sichtlichem Zögern schleppte auch er sich zu den Wanten und fing an mit dem Messer zwischen den Zähnen langsam und unter Schmerzen hinaufzukriechen.
Es kostete ihm eine Menge Zeit und er stöhnte schmerzlich wie er da sein verwundetes Bein hinter sich herzog. Ich hatte inzwischen ruhig meine Vorbereitungen beendet, noch ehe er ein Drittel des Weges zurückgelegt hatte. Dann richtete ich mit einer Pistole in jeder Hand das Wort an ihn:
„Noch einen Schritt, Herr Hands,“ sagte ich, „und ich werde Euch das Gehirn ausblasen! Tote Leute beißen nicht, wie Ihr wißt!“ fügte ich mit einem Kichern hinzu.
Er hielt sofort ein. Ich konnte auf seinem Gesicht die Gedanken arbeiten sehen und der Vorgang war so langsam und mühevoll, daß ich in meiner neu gefundenen Sicherheit laut auflachte. Endlich begann er, nachdem er einmal oder zweimal geschluckt hatte, zu sprechen und sein Gesicht trug dabei immer noch denselben Ausdruck äußerster Bestürzung. Um sprechen zu können, mußte er das Messer aus dem Munde nehmen, doch im übrigen blieb er unbeweglich.
„Jim,“ sagte er, „ich denke wir sind beide in der Tinte und werden einen Pakt schließen müssen. Ohne diesen Ruck hätte ich Euch schon, aber ich bin ein Pechvogel und ich glaube, ich werde mich ergeben müssen und das ist nicht leicht, seht Ihr, für einen alten Seemann, so einem Schiffsjunker, wie Ihr seid, Jim.“
Lächelnd sog ich seine Worte ein, stolz wie der Hahn am Mist, als blitzschnell seine rechte Hand über die Schulter zurückgriff. Etwas schwirrte wie ein Pfeil durch die Luft, ich fühlte einen Schlag und darauf einen scharfen Schmerz und fand mich mit der Schulter an dem Mast festgenagelt. In dem entsetzlichen Schmerz und in der Überraschung des Moments – ich kann kaum sagen, daß es durch meinen eigenen Willen geschah und sicher ohne eine bewußte Absicht – gingen meine beiden Pistolen los und beide fielen mir aus der Hand. Sie fielen nicht allein; mit einem erstickten Schrei ließ der Bootsführer die Strickleitern los und stürzte mit dem Kopf voran ins Wasser.
Siebenundzwanzigstes Kapitel
„Goldstücke“
Infolge der geneigten Stellung des Schiffes hingen die Masten weit über das Wasser hinaus und von meinem Sitz auf dem Kreuzmast sah ich nichts unter mir als die Oberfläche der Bucht. Hands, der nicht so weit hinaufgekommen war, war dem Schiff entsprechend näher und fiel zwischen mich und die Reeling. Er wurde noch einmal emporgetrieben und versank dann endgültig. Ich konnte ihn, als das Wasser ruhig geworden war, auf dem reinen weißen Sand im Schatten des Schiffes zusammengekauert liegen sehen. Ein paar Fische flitzten über seinen Leib hinüber. Manchmal schien er sich zu bewegen, so als ob er versuchte aufzustehen. Aber er war wirklich tot, erschossen und ertrunken und lag jetzt da, den Fischen zum Fraße, an demselben Platz, wo er beabsichtigt hatte mich niederzumachen.
Kaum hatte ich mich dessen versichert, trat mir die Schauerlichkeit dieser letzten Minuten erst voll ins Bewußtsein und ich fühlte mich krank, schwach und elend. Das Blut rann mir über Rücken und Brust. Das Messer brannte an der Stelle, wo es meine Schulter an den Mast festnagelte wie ein heißes Eisen, und doch waren es nicht diese körperlichen Leiden, die mich quälten, denn diese glaubte ich ohne Murren ertragen zu können, sondern es war die entsetzliche Furcht vom Kreuzmast hinunter in dieses stille, grüne Wasser neben die Leiche des Bootsführers zu fallen.
Ich hielt mich mit beiden Händen fest bis mich die Nägel schmerzten und schloß die Augen als könnte ich so die Gefahr zudecken. Allmählich aber kam ich wieder zu mir, mein Puls ging ruhiger und ich konnte überlegen. Mein erster Gedanke war, das Messer herauszuziehen, doch stak es entweder zu fest oder waren meine Nerven zu schwach, mich überlief ein heftiger Schauer und ich gab es auf. Sonderbarerweise brachte gerade dieser Schauer die Arbeit fertig. Das Messer hätte mich wirklich um ein Haar verfehlt, denn es hatte mich nur an einem Hautfetzen festgehalten, der jetzt durch den Schauer weggerissen wurde. Gewiß lief das Blut um so schneller an mir herunter, doch ich war wieder mein eigener Herr und nur mit meinem Hemd und meinem Rock am Mast festgehalten.
Die riß ich mit einem raschen Ruck fort und gelangte über die Steuerbordwanten wieder auf Deck. Um nichts in der Welt hätte ich mich auf die überhängenden Backbordwanten gewagt, von denen Israel heruntergestürzt war.
Ich ging hinunter und versorgte meine Wunde so gut wie möglich. Sie schmerzte mich tüchtig und blutete noch immer heftig, doch war sie weder tief noch gefährlich und hinderte mich auch nicht sonderlich an der Benützung meines Armes. Dann schaute ich um mich, und da das Schiff nun gewissermaßen mein Eigen geworden war, wollte ich es noch von seinem letzten Passagier – dem toten O’Brien – befreien.
Er war, wie gesagt, gegen die Reeling gestürzt, wo er jetzt wie eine Art grauenhafter, plumper Marionette dalag, in Lebensgröße freilich, doch wie verschieden von der Farbe und Anmut des Lebens! In dieser Lage konnte ich ihn leicht handhaben und da meine tragischen Abenteuer in mir schon jede Furcht vor dem Toten verwischt hatten, so nahm ich ihn wie einen Sack Kleie um die Mitte und warf ihn mit einem festen Anlauf über Bord. Mit einem lauten Platschen fiel er ins Wasser, die rote Mütze wurde fortgeschleudert und schwamm an der Oberfläche weiter. Als die Wellen wieder ruhiger gingen konnte ich ihn und Israel Hands Seite an Seite liegen sehen, beide schaukelnd in der zittrigen Bewegung des Wassers. O’Brien war trotz seiner Jugend ganz kahlköpfig. Da lag er nun mit dem kahlen Kopf quer über den Knien seines Mörders und die schnellen Fische segelten über beide hinweg, hin und her.
Ich war nun allein auf dem Schiff und die Flut hatte sich eben gewendet. Die Sonne war schon so nahe am Untergehen, daß der Schatten der Nadelbäume auf dem westlichen Ufer bereits quer über den Ankerplatz fiel und Muster auf das Deck zeichnete. Der Abendwind hatte eingesetzt und trotzdem er durch den Berg im Osten mit den zwei Spitzen abgehalten war, so war doch ein leises Summen im Tauwerk zu vernehmen und die schlaffen Segel rasselten hin und her.
Ich begann für das Schiff zu fürchten. Rasch ließ ich die Stagsegel aufs Deck fallen, doch mit dem Hauptsegel war schwerer zu hantieren. Natürlich hatte sich, als der Schooner überkippte, der Mastbaum nach außen geschwungen und seine Kappe und ein oder zwei Fuß vom Segel hingen sogar unter Wasser. Dies, dachte ich, mußte die Gefahr noch vergrößern, doch war die Spannung so stark, daß ich fast fürchtete etwas zu unternehmen. Schließlich nahm ich mein Messer heraus und durchschnitt die Felle. Die Spitze neigte sich sofort und eine große Fläche losen Segeltuches schwamm breit auf dem Wasser. Und nun konnte ich ziehen wie ich wollte, es war nicht zu bewegen, und ich konnte jetzt nichts mehr machen. Von nun ab mußte ich die Hispaniola wie mich selbst dem Schicksal überlassen.
Inzwischen war der ganze Ankerplatz in den Schatten gerückt – ich erinnere mich noch wie die letzten Strahlen durch eine Waldlichtung fielen und leuchtend wie Edelsteine auf dem blühenden Mantel des Wracks leuchteten. Es begann kühl zu werden, die Flut strömte rasch seewärts und der Schooner setzte sich mehr und mehr an seinen Balkenköpfen fest.
Ich kletterte nach vorne und schaute hinüber. Das Wasser sah ziemlich seicht aus. Als letzte Sicherung das durchschnittene Ankertau mit beiden Händen festhaltend, ließ ich mich langsam über Bord gleiten. Das Wasser reichte mir kaum bis zur Hüfte, der Sand war fest und von den Wellen gefurcht und ich watete in bester Stimmung ans Ufer, die gekenterte Hispaniola, deren Hauptsegel weit über die Oberfläche der Bucht herabhing, zurücklassend. Gerade sank die Sonne hinab und der Abendwind pfiff leise durch die rauschenden Fichten.
Schließlich und endlich war ich nun wieder auf dem Lande und war auch nicht mit leeren Händen zurückgekehrt. Da lag der Schooner, von den Piraten befreit und bereit, unsere eigenen Leute aufzunehmen und wieder in See zu gehen. Nichts war selbstverständlicher, als daß ich wieder in das Blockhaus heimkehren und mich meiner Errungenschaften rühmen wollte. Möglicherweise würde man mich ein bißchen wegen meiner Pflichtversäumnis schelten, doch die Wiedereroberung der Hispaniola war eine schlagende Antwort und ich hoffte, daß selbst Kapitän Smollett zugeben würde, daß ich meine Zeit nicht verloren hatte.
Mit solchen Gedanken und in bester Laune schritt ich dem Blockhaus und meinen Gefährten zu. Ich erinnerte mich, daß der östlichste der Flüsse, welche in Kapitän Kidds Ankerplatz münden, von dem zweispitzigen Berg links herabkam und wandte mich jener Richtung zu, um den Fluß zu übersetzen solange er noch schmal war. Der Wald war ziemlich offen und so hatte ich bald den Berg erreicht und watete durch das Wasser.
Ich war nun nahe dem Punkte, wo ich den ausgesetzten Ben Gunn getroffen hatte und blickte darum aufmerksamer rings um mich. Es war inzwischen ganz dunkel geworden, und als ich in die Schlucht zwischen den beiden Spitzen kam, bemerkte ich ein schwankendes Licht ungefähr in der Richtung, wo der Inselmensch sein Mahl beim offenen Feuer kochen mochte. Dennoch wunderte ich mich über seine Sorglosigkeit. Denn wenn ich dieses Licht bemerkte, konnte es nicht ebensogut Silver von seinem Lagerplatz in den Sümpfen aus gewahren?
Die Nacht sank allmählich noch tiefer herab und ich konnte mich nur schwer orientieren, denn der Doppelberg hinter mir und das „Fernrohr“ zu meiner Rechten waren nur mehr schwächer und schwächer sichtbar. Wenige Sterne standen am Himmel und in der Mulde, in der ich wanderte, stolperte ich oft über Büsche und Sandhügel.
Plötzlich wurde es heller. Ich blickte auf und sah, wie der blasse Schimmer der Mondstrahlen den Gipfel des „Fernrohrs“ erhellte und bald darauf sah ich ein breites silbernes Etwas sich hinter den Bäumen bewegen und merkte nun, daß der Mond aufgegangen war.
Mit seiner Hilfe legte ich den Rest meiner Reise rasch zurück und bald gehend, bald laufend, näherte ich mich unruhig der Umzäunung. Doch als ich das Wäldchen durchschritt, das davor liegt, mäßigte ich meinen Schritt und ging vorsichtiger, denn es wäre wohl ein trauriges Ende meiner Abenteuer gewesen, irrtümlich von meinen eigenen Leuten niedergeschossen zu werden.
Der Mond erhob sich immer höher. Sein Licht fiel breit auf die offeneren Teile des Waldes und gerade vor mir tauchte ein ganz anderes Leuchten zwischen den Bäumen auf. Es war rot und dann und wann verdunkelte es sich ein wenig, so daß es aussah wie ein verglimmender Scheiterhaufen.
Ich konnte mir absolut nicht denken, was dies sein mochte.
Endlich kam ich gerade auf die Lichtung hinunter, deren westlicher Rand schon in Mondlicht getaucht war, während das Blockhaus selbst und seine Umgebung noch im dunklen Schatten lag, der von langen silbernen Lichtstreifen stellenweise durchbrochen wurde. An der anderen Seite des Hauses brannte ein ungeheures Feuer eben zu Asche und warf einen roten Widerschein, der in seltsamem Gegensatz zu der bleichen Milde des Mondes stand. Keine Seele bewegte sich, kein Laut war zu hören, außer den Geräuschen der Brise.
Sehr verwundert und vielleicht auch etwas erschreckt blieb ich stehen. Es war nicht unsere Art, große Feuer anzuzünden, der Kapitän hielt uns in bezug auf Brennholz eher knapp. Ich begann zu fürchten, daß während meiner Abwesenheit irgend etwas fehlgegangen sei.
Ich schlich um das östliche Ende, hielt mich vorsichtig im Schatten und überschritt an einem geeigneten Punkt, wo die Finsternis am dichtesten war, die Umzäunung.
Um noch sicherer zu gehen, kroch ich auf allen Vieren lautlos um die Ecke des Hauses. Als ich näher kam wurde ich plötzlich viel ruhiger und vergnügter. An und für sich ist es kein schönes Geräusch und ich habe mich zu anderen Zeiten oft darüber beklagt, doch in diesem Augenblick klang mir das friedliche, laute Schnarchen meiner Freunde wie Musik in den Ohren. Doch eines war sicher: Sie hielten verflucht schlecht Wache. Wenn jetzt Silver und seine Leute hereingekrochen wären, so hätte keiner mehr von ihnen den Tag erlebt. Das kommt davon, dachte ich, daß der Kapitän verwundet ist und machte mir heftige Vorwürfe, sie in dieser Gefahr mit so wenigen gesunden Leuten, die zur Bewachung taugten, zurückgelassen zu haben.
Inzwischen war ich zur Tür gekommen und hatte mich aufgerichtet. Drinnen war alles dunkel und ich konnte keine Einzelheiten ausnehmen. Man hörte nur das einförmige Schnarchen und manchmal ein kleines Geräusch wie Geflatter oder Picken, das ich mir absolut nicht erklären konnte.
Mit ausgestreckten Armen ging ich langsam hinein. Ich wollte mich auf meinen Platz legen und (dachte ich mit innerem Lachen) mich über ihre Gesichter freuen, wenn sie mich am Morgen dort fänden. Da stieß mein Fuß auf etwas – es war das Bein eines Schläfers. Er wandte sich um und seufzte, doch ohne zu erwachen. Plötzlich kreischte eine schrille Stimme aus der Dunkelheit heraus:
„Goldstücke! Goldstücke! Goldstücke! Goldstücke! Goldstücke!“ und ohne Pause immerfort weiter wie das Klappern einer kleinen Mühle.
Silvers grüner Papagei, Kapitän Flint! Ihn hatte ich an einem Stück Rinde picken gehört, er, der besser Wache hielt als irgendein menschliches Wesen, hatte so mein Kommen mit seinem eintönigen Ruf gemeldet.
Ich hatte keine Zeit mich zu fassen, denn vom scharfen, schneidenden Ruf des Papageies erwachten die Schläfer und sprangen auf. Mit einem wilden Fluch rief Silver:
„Wer da?“
Ich wendete mich zur Flucht, stieß heftig gegen einen Mann, wich zurück und rannte geradewegs in die Arme eines zweiten hinein, der mich packte und festhielt.
„Bring’ eine Fackel, Dick“, sagte Silver, als ich nun gefangen war.
Und einer der Männer verließ das Blockhaus und kehrte sofort mit einer brennenden Fackel zurück.