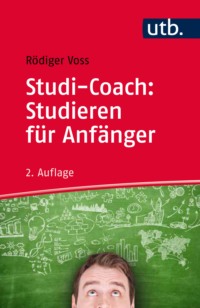Kitabı oku: «Studi-Coach: Studieren für Anfänger», sayfa 2
Noch mehr zur Selbstverantwortung
Der Grad der Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ist auch in anderen Bereichen weit höher als zu Schulzeiten. Dazu gehört etwa die sorgsame Vor- und Nachbereitungszeit von Lehrveranstaltungen, wobei Fachbücher und Artikel in Fachzeitschriften gelesen und Übungsaufgaben gelöst werden müssen. Sie scheinen auch sehr viel Ferien (vorlesungsfreie Zeit) an einer Hochschule zu haben. Diese Zeit ist jedoch reserviert für Berufspraktika bzw. Schulpraktika, Prüfungsvorbereitungen, Ferienjobs zur Finanzierung des Studiums oder für die Vorbereitung des nächsten Semesters. Für das Lesen wissenschaftlicher Bücher und Aufsätze benötigt man Zeit und Ruhe, die man während der Vorlesungszeit kaum findet. Studierende, die die vorlesungsfreie Zeit als reine Ferienzeit nutzen, werden im Studium eher schlechter abschneiden und wenige Zusatzqualifikationen (vgl. Kap. 7.4) erwerben. Sie können es schon deutlich herauslesen: Eine umfangreichere, professionellere Arbeitsorganisation ist zum Überleben in der Hochschullandschaft vonnöten.
| Hochschule | breites Fachstudium |
| große Stofffülle | |
| umfangreiches Lernen für Prüfungen | |
| hoher Grad an Selbstständigkeit | |
| großer Anteil des Eigenstudiums | |
| eingeschränkter Kontakt zu Dozenten | |
| viele Informationen müssen selbst beschafft werden |
Tab. 1: Neues Rollenprofil für Studierende an der Hochschule im Überblick
Über den Sinn eines Studiums
Ziel eines Studiums ist nicht die reine Wissensaneignung, sondern die Entwicklung von persönlichen Fähigkeiten wie analytischem und logischem Denken oder mündlicher und schriftlicher Kommunikation. Man verwendet in diesem Zusammenhang auch das Wort Kompetenz. Eine Kompetenz eignet man sich z.B. durch intensives Training an. Mit einem Studium erweitert man seine Handlungskompetenz (vgl. Abb. 1), indem man seine Fach-, Methoden-, Human- und Sozialkompetenz verbessert. Während in früheren Zeiten ein besonderes Augenmerk auf fachliche Kompetenzen gelegt wurde, ist heutzutage unumstritten, dass Wissen in vielen Studiengängen sehr kurzlebig ist. Es ist durch Training on the job oder durch Weiterbildung situationsentsprechend zu aktualisieren. Ein Studium ist keine pure Fachausbildung, sondern führt zur Bildung einer sozial kompetenten, erfahrenen und gefestigten Persönlichkeit. Die erworbene Handlungskompetenz befähigt zur Ausfüllung eines Jobs sowie zur Lebensführung.

Abb. 1: Im Studium angesprochene Kompetenzen
Kompetenzen Schritt für Schritt ausbauen
Man kommt nicht ganz ungerüstet an eine Hochschule. Sie haben bereits eine Schullaufbahn absolviert und eine Reihe von Kompetenzen erworben, die im Studium reaktiviert werden müssen. Im Erststudium und den darauf folgenden Aus- und Weiterbildungen werden die Kompetenzen Schritt für Schritt angereichert, das eigene Handlungsspektrum wird infolgedessen wesentlich erhöht (vgl. Abb. 2). Selbstverständlich geht im Studienprozess auch einiges wieder verloren, wie ein Teil des tiefen Fachwissens. Vor allem die Methoden- und Persönlichkeitskompetenz werden jedoch stetig erweitert.

Abb. 2: Ausbau der Handlungskompetenz im Studienverlauf
1.2 Nötige Fähigkeiten und Eigenschaften
1.2.1 Proaktiv sein
Was macht proaktives Denken aus?
Proaktiv sein bedeutet, selbst die Verantwortung für sein Leben zu tragen. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass unsere Gedanken über all unsere Aktionen, unsere Fähigkeiten, unsere Beziehungen zu anderen Menschen und unsere Motivation bestimmen. Wir haben glücklicherweise die Freiheit, Dinge zu tun oder zu lassen, solange wir nicht grob gegen rechtliche oder moralische Regeln verstoßen.
Study-Leader durch proaktives Verhalten
Proaktive Studierende konzentrieren sich auf Momente im Studium, die sie beeinflussen können, sowie darauf, sich an gewissen Vorgaben der Hochschule zu orientieren und diese pflichtgemäß einzuhalten und kreativ auszufüllen. Sie werden zu ihrem eigenen Study-Leader und entwickeln ihre „studentische Identität“ – sie designen ihr eigenes Studium. Das schließt eine lebendige, selbst forschende und erkundigende Lebenseinstellung ein. Sie sind kein passiver Konsument in einer Lehrveranstaltung, sondern hinterfragen die Lehrinhalte und arbeiten diese aktiv nach. Aktives Mitarbeiten in Lehrveranstaltungen steigert die Aufmerksamkeit und damit den Lernerfolg. Eine proaktive Einstellung umfasst auch die Offenheit, neue Lern- und Lesemethoden (vgl. Kap. 4 und 5) auszuprobieren und diese genau auf die Anwendbarkeit im eigenen Studienleben zu bewerten, um für kommende Aufgaben gut gerüstet zu sein.

Abb. 3: Proaktives versus reaktives Verhalten
Herausforderungen suchen, heißt proaktiv sein
Ein Studium sollte nicht als bloße Pflichtaufgabe angesehen werden. Vielmehr sollte es als Herausforderung, mit der man persönlich reift, betrachtet werden. Durch diese Sichtweise kann Ihr Selbstbewusstsein Schritt für Schritt weiter wachsen: Reaktive Formulierungen wie „hätte ich nur“, „ich kann nicht“ oder „so bin ich eben“ sind in dieser proaktiven Sichtweise hinderlich. Stattdessen werden Sie selbst tätig, um die Herausforderungen im Studium und Leben allgemein zu bewältigen und dabei für weitere, noch an-spruchsvollere Aufgaben zu lernen. Dieser Zusammenhang sollte auch in Sätzen ausgedrückt werden: „ich will…“ oder „ich kann…“. Nicht ein potenzielles Versagen sollte also Bezugspunkt des Denkens sein, sondern ein erfolgreiches Erledigen der Aufgaben. Proaktive Studierende verbessern mit Durchhaltewillen, auch in Motivationstiefs, ihre Leistung, z.B. durch umfangreiche Wiederholungen des Lernstoffs.
Studi-Tipp: Glauben Sie an sich selbst
Zeigen Sie immer wieder Ihre Hartnäckigkeit und den Glauben an sich selbst und Ihr Studium. Das bedeutet, nach einem eher erfolglosen Tag den nächsten Tag mit Elan anzugehen. Beantworten Sie die Frage, wie Sie den Tag optimal gestalten können und was Sie an diesem Tag konkret weiterbringt. Falls Sie sich dazu temporär zu schwach fühlen, suchen Sie sich Hilfe, um aus einem etwaigen Stimmungstief zu kommen.
Studi-Tipp: Aufschieberitis nicht zulassen
Sie sind mit dem linken Fuß aufgestanden und das Wetter ist ach so schön. Aus dem Grund haben Sie im Gefühl: „lernen bringt heute eh nichts“. Vorsicht: Infizieren Sie sich nicht mit der Krankheit Aufschieberitis. Gerade ab dem zweiten Studiensemester kommen solche oder vergleichbare Gedanken immer mal wieder vor, da der Einstiegselan des ersten Semesters etwas verflogen ist. Üben Sie sich dennoch in Selbstdisziplin und setzen Sie sich trotz der offensichtlichen Demotivation an Ihren Schreibtisch oder gehen Sie in die Bibliothek. Kurbeln Sie dann mit einer leichten Aufgabe den Lernprozess an, um in den Lernstoff reinzukommen. Eine weniger produktive ist besser als gar keine Lernstunde. Mit der Zeit wird Ihre Selbstdisziplin immer weiter perfektioniert und Sie finden immer besser die Motivation zum Lernen.
Studi-Tipp: Motivation steigern
Wenn Sie einmal nicht richtig in den Gang kommen, können Sie mit Freunden wetten, dass Sie die eine oder andere Aufgabe erfolgreich angehen und lösen werden. Den Wetteinsatz kann man mit einer Belohnung für sich selbst verbinden, dann ist die Motivation optimal angeregt.

Abb. 4: Proaktive und reaktive Sprachmuster
1.2.2 Selbstkritisch denken
Die Schuld nicht immer bei anderen suchen
Sie gestalten Ihre Umwelt weitest möglich mit. Statt die Verantwortung immer nur bei anderen zu suchen oder sich zu beklagen, fangen Sie bei sich selbst an. Weist man die Schuld immer einseitig einem anderen zu, z.B. einem Dozierenden wegen einer schlechten Note, vergibt man ein Stück Kontrolle über sich. Schwächere Studierende machen oft den Fehler, zu wenig kritisch mit ihrer eigenen Leistung zu sein (Halbach 2000). Bessere Studierende sehen ihre guten Leistungen kritisch und versuchen stetig, Verbesserungspotenziale abzuleiten. Das heißt nicht, dass man alles schlecht oder überkritisch sehen sollte. Vielmehr ist eine normal kritische Selbstanalyse angesprochen. Auch offensichtliche Fehler bei der Notengebung (z.B. fehlerhafte Addition von Punkten) eines Dozierenden sollen selbstverständlich reklamiert werden.
Fehler als Reflexionsanreiz
Fehler sollten als Ansporn zur Verbesserung gesehen werden, denn Irren ist menschlich. Das perfekte Studium und der perfekte, fehlerlose Studienweg, bei dem nichts schief geht, existiert schließlich nicht. Sich einer solchen Illusion hinzugeben, bindet nur unnötig Energie und Kraft. Studieren trägt, wie das reale Leben, immer ein Stück Unvollkommenheit und Probleme in sich. Wo wäre sonst der Reiz? Ecken und Kanten gilt es zu akzeptieren und bestmöglich damit umzugehen, indem man daraus lernt und vermeidet, den gleichen Fehler mehrfach zu wiederholen. Wichtig ist es also, die Schwachstellen zu identifizieren und anzugehen.
1.2.3 Positiv sehen
Negative Sichtweisen schränken ein
Es bringt wenig, negativ über das Studium und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu denken. Gerade das Positive zu finden und dadurch Motivation zu gewinnen, unterscheidet die erfolgreichen von den erfolglosen Studierenden (Çetingöza & Özkal 2009). Emotionen wie Ärger und Frust sind Hauptgründe für Versagen und Unzufriedenheit und rauben die Studienfreude. Aversionen gegen bestimmte Fächer („Statistik habe ich schon immer gehasst“) oder Dozierende („Der Idiot kritisiert immer nur“) sind kontraproduktiv. Auch im Beruf und übrigen Leben muss man mit Dingen umgehen, die einem auf den ersten Blick weniger sympathisch erscheinen. Von Bedeutung ist also, eine positive Grundstimmung zu gewinnen.
Nutzen identifizieren
Es ist sinnvoll, selbst in den „unbeliebten“ Fächern einen Nutzen zu identifizieren und sich ihnen emotional zu öffnen. Stellen Sie sich z.B. die Frage: „Was kann dieses Fach für meinen aktuellen oder potenziellen Beruf bringen?“ oder „Welche neue Kompetenzen kann ich durch das Fach erlangen?“ Anregungen eines Dozierenden können Sie gut als Chance für Ihre persönliche Entwicklung interpretieren. Schreiben Sie seine Kritik nieder und leiten Sie sofort Verbesserungsmaßnahmen daraus ab. Das positive Element kann auch indirekt gesucht werden: „Freunden imponieren“, „Dozierende für sich begeistern“ oder „ein Fach und seine Prüfung für seinen späteren Traumjob bestehen“. Wenn Sie nicht sofort für jedes Fach einen Nutzen herausfinden, schalten Sie Ihre Gefühle am besten in eine Art Standby-Modus, bevor eine Abneigung aufkommt. Ein Nutzen kristallisiert sich in vielen Fällen erst heraus, wenn Sie das Fach näher kennengelernt und verstanden haben.
Studi-Tipp: Positiven Nutzen suchen
Sie sind kein Fan des Fachs „Wissenschaftliches Arbeiten“, weil Zitierregeln und Literaturangaben einfach nur langweilen. Auch für ein kleines Forschungsprojekt in einer Arbeitsgruppe finden Sie kein großes Interesse. Suchen Sie einen positiven Nutzen. Denken Sie z.B. daran, dass in vielen Jobs das Arbeiten in Projektgruppen ein wichtiger Bestandteil ist. Denken Sie auch daran, dass eben diese Genauigkeit bei vielen Tätigkeiten strikt gefordert ist und man durch wissenschaftliches Arbeiten (z.B. exakte Zitierweise oder Literaturangaben) darin trainiert wird.
Studi-Tipp: Einen motivierenden Ansatz suchen
Sie hassen die Mathematik, die Sie für Ihr Studium brauchen. Alle Formeln sind für Sie böhmische Dörfer. Leider ist das Bestehen der Prüfung für den weiteren Studienweg entscheidend. Suchen Sie einen motivierenden Ansatz: Im Studium ist es wichtig, die Konzentration zu schulen und dies können Sie durch das Lernen und Analysieren der Formeln sicher. Zugleich trainieren Sie logisches und abstraktes Denken – auch eine elementare Voraussetzung für einen erfolgreichen Studien- und Berufsweg.
Wie finde ich das Positive sonst noch?
Suchen Sie bei anderen: Beobachten und befragen Sie z.B. Ihre Kommilitonen und Dozierenden, um das positive Element in den Fächern zu identifizieren und lassen Sie sich gegebenenfalls von deren Begeisterung anstecken. Durch deren positive Sichtweise schwört man auch keine bösen Geister herauf. Man umgeht, negative, sich selbst erfüllende Prophezeiungen hervorzurufen. Bei Letzteren handelt es sich um Annahmen oder Vorurteile, die rein aus der Gegebenheit heraus, dass sie gesetzt wurden, das vorhergesagte Ereignis zur Wirklichkeit werden lassen. Die Richtigkeit der negativen Grundannahme wird somit bestätigt (Merton 1948).
Studienbeispiel
Sie sind fest davon überzeugt, dass ein Dozierender Sie nicht besonders schätzt. Aus dem Grund werden Sie ihm gegenüber misstrauisch und respektlos, was sich in einem schlech-ten Verhalten (z.B. ins Wort fallen) zeigt. Durch Ihre Taten rufen Sie beim Dozierenden eventuell jene Geringschätzung hervor, die Ihrer im Vorhinein getroffenen Annahme entspricht. Er denkt über Sie „Mensch, hat der eine schlechte Kinderstube“.
1.2.4 Achtung zeigen
Fehlende Achtung kostet Kontakte
Mangelnde Achtung vor anderen Meinungen und Personen schränkt die eigene mentale Freiheit ein. Urteilen Sie im Studium z.B. nicht immer kritisch über Kommilitonen („Der hat die gute Note nicht verdient, weil der dumm ist“) oder Dozierende („Der sollte einmal richtig sprechen lernen“). Die Urteile rufen bei Ihnen negative Gefühle hervor und verursachen Stress. Zudem beeinträchtigen Sie Ihre Fähigkeit zum sozialen Kontakt, weil man mit jemandem, den man gedanklich herabwürdigt, wenig oder nichts zu tun haben will. Man mindert also seine eigene Kontaktfähigkeit durch sein negatives Denken.
Urteilsfreie Individuen sind glücklicher
Sinnvoller ist es, mit anderen auch in seinen eigenen Werturteilen achtsam umzugehen. Ein solcher Ansatz entspricht nicht nur dem Kontext buddhistischer Lehre von Befreiung und Erleuchtung, sondern wird auch von einer Reihe westlicher Psychologen verfolgt. Kabat-Zinn (2003) spricht in diesem Zusammenhang von einer „nicht-urteilenden Qualität“ beim Umgang mit ablehnenden Gedanken: Nicht-urteilende Individuen treffen Entscheidungen mit größerer Klarheit, sind effektiver im Handeln und fühlen sich glücklicher als urteilende. Negative Gefühle werden durch die Würdigung von anderen Leistungen vermieden. Wer Achtsamkeit praktiziert, lernt auch, Erlebnisse mit anderen zu erleben, ohne sie unmittelbar in existierende negative Eindrücke einzufügen und mit früheren Erfahrungen zu verknüpfen. Dies eröffnet eine größere Offenheit gegenüber neuen Situationen und positiven Erlebnissen.
1.2.5 Angstfrei agieren
Angst macht im Kopf unfrei
Angst wirkt negativ auf das Leistungsverhalten, z.B. wenn Sie sich vor Prüfungssituationen zu viele Gedanken hinsichtlich der späteren Leistungsbewertung oder eines möglichen Versagens machen. Die Angst wird schnell zu Ihrem stetigen Begleiter – auf dem Weg zum Hörsaal, mittags in der Mensa oder abends im Bett. Infolge dieser Besorgtheit wird ein beträchtlicher Anteil Ihrer Aufmerksamkeit gebunden. Ihre Denkprozesse konzentrieren sich darauf, Alternativen zu suchen, um der Angst zu entkommen. Diese Aufmerksamkeit kann dann nicht für die Aufnahme von neuem Lernstoff verwendet werden. Daher kommt es zu einer Einschränkung der Leistungsaufnahme und einer schlechteren Speicherung der Eindrücke im Gedächtnis.
Angst führt zum Aufschieben
Angst ist ebenfalls ein Auslöser der bereits genannten Aufschieberitis (vgl. Kap. 1.2.1), also dem Verschieben von Abgabeterminen. Durch Versagens- und Bewertungsangst traut man sich nicht, eine Prüfung abzugeben. Hinter den negativen Gefühlen steckt in vielen Fällen die Angst vor den Folgen des Versagens, wie z.B. Gesichtsverlust oder Spott. Das Wichtigste ist, dass Sie sich klarmachen, dass es immer wieder Optionen im Studien- und im ganzen Leben gibt und nichts endgültig ist.
Studi-Tipp: Ohne Angst in Prüfungen gehen
Nehmen Sie sich selbst Ängste vor dem Durchfallen bei Prüfungen. Sagen Sie sich, dass Sie es schaffen und wenn Sie es nicht schaffen, dann wiederholen Sie die Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt mit besseren Kenntnissen. Lernen Sie noch etwas intensiver, vielleicht haben Sie sich einfach nur überschätzt.
Studi-Tipp: Sag nein zu Kaffee und Co
Schränken Sie den Konsum von „Aufputschmitteln“ wie Kaffee, Energydrinks usw. am Tag der Prüfung und den Tagen davor etwas ein. Diese Mittel können die Nervosität und damit auch die Angst steigern, weil sie den Kreislauf in Schwung bringen. Trinken Sie an den Tagen lieber Mineralwasser, ungezuckerten Kräutertee oder einen Fruchtsaftmix.
Studi-Tipp: Inneres Schnattermaul zum Schweigen bringen
Auch bei der Angstüberwindung heißt es wieder „proaktiv sein“. Sobald Sie spüren, dass das innere Schnattermaul im Kopf sich bemerkbar macht und versucht, negative Stimmung und daraus folgend Prüfungsangst zu verbreiten, schreien Sie in Ihren Gedanken: „Halt Ruhe! Du nervst!“. Ein solches Vorgehen ist ein erster Schritt in Richtung einer „Gedankenumkehr“ von dekonstruktiven in konstruktive Gedanken.
Negative Verbindung bleibt
Ein weiteres Problem ist, dass beim Lernen unter Angst das negative Gefühl automatisch von unserem Gehirn mitgespeichert wird (Spitzer 2006) und bei späterem Erinnern wieder hervortritt. Den gleichen Effekt wie Angst hat übrigens Ärger und speziell aufgestauter Ärger. Erneut wird die Aufmerksamkeit durch den direkt verspürten Ärger und das hartnäckige Erinnern daran gebunden. Es ist also sinnvoll, seine negativen Gefühle zu erfassen und Maßnahmen einzuleiten, um sie zu eliminieren. Um z.B. Ärger und auch Angst zu verarbeiten, empfiehlt sich Ablenkung, die in Sport oder Relaxen liegen kann (vgl. Kap. 6.5). In besonders extremen Fällen von Angst und Ärger, die die ganze Studienleistung negativ beeinflussen, reicht dies aber nicht mehr aus. Bei diesen Gegebenheiten können ein Arzt oder Psychologe sowie psychologische Beratungsstellen der Hochschule helfen und durch empfohlene Maßnahmen den Umgang mit den negativen und sehr belastenden Emotionen verbessern.
1.2.6 Geplant vorgehen
Ziele als Erfolgsfaktoren
Zielformulierungen und Planung des Studiums sind wichtige Erfolgsgaranten für ein Studium, denn sie bringen den inneren Antrieb in Schwung. Voraussetzung für das Ableiten von Zielen und Zeitplänen ist die Erfassung seiner Fähigkeiten sowie die Abschätzung der Umweltfaktoren (Meltzer, Katzir-Cohen & Miller 2001). Mit wenigen Minuten täglicher Planung sind schnell viele Stunden Zeit zu sparen. Vergessen Sie nicht, dass erneut Hartnäckigkeit und Selbstdisziplin Wegbegleiter sein müssen, denn die Ziele müssen im positiven Sinn abgearbeitet werden. Aufgrund der besonderen Relevanz des Zeitmanagements (vgl. Kap. 3) und der Persönlichkeitseinschätzung und Zielplanung (vgl. Kap. 2) ist den beiden Themenbereichen jeweils ein eigenes Kapitel in diesem Buch gewidmet.