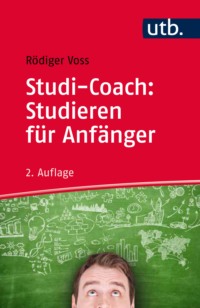Kitabı oku: «Studi-Coach: Studieren für Anfänger», sayfa 3
Ordnung ist unverzichtbar im Studienleben
Ein effizientes Studium ist alles andere als ungeordnet. Zur Ordnung gehören aber nicht nur Ziele oder Zeitmanagement, sondern auch Maßnahmen wie richtiges Abheften und eine sinnvolle Struktur auf dem PC. Lesen Sie das Kapitel 4.6, um dazu einen umfassenderen Einblick zu erlangen.
2 Sich selbst als Mensch und Studierender erkennen

Zentrale Ziele dieses Kapitels
 Sich seiner selbst als Studierender bewusst werden
Sich seiner selbst als Studierender bewusst werden
 Eine Vision und Mission schriftlich fixieren
Eine Vision und Mission schriftlich fixieren
 Faktoren des Glücks vergegenwärtigen
Faktoren des Glücks vergegenwärtigen
 Stärken und Schwächen formulieren und reflektieren
Stärken und Schwächen formulieren und reflektieren
 Studienziele ausarbeiten
Studienziele ausarbeiten
2.1 Ebenen der Selbstfindung
Das Glück steht im Zentrum
Ziel eines jeden Menschen ist es letztendlich, sein persönliches Lebensglück und seine innere Zufriedenheit zu finden. Diese Gründe bewegen dazu, ein Studium zu beginnen: Man hält sich für qualifiziert und möchte seine Qualifikationsbasis weiter ausbauen, um das zu erreichen, was man für sich erwartet und für sich angemessen hält. Man versucht, Stück für Stück sein Glück zu finden und zu erhalten. In dem Fall kann man richtig genießen, was man bekommt. Die Amerikaner hielten das Streben nach Glück sogar für so unverzichtbar, dass sie es am 4. Juli 1776 als Menschenrecht in ihrer Unabhängigkeitserklärung verankerten. Nun aber zurück zum Studium: Glücksempfinden ist auch im Studium etwas sehr persönliches; jedes Individuum versteht darunter etwas anderes. Der eine empfindet ein starkes Glücksgefühl, wenn er an einem schönen Morgen durch den Park zur Hochschule fährt und dabei die frische Luft einatmet. Andere mögen bei solchen Fahrten eher indifferent sein und das A und O für ihr Glück im Studienerfolg – sprich guten Noten – spüren. Vergessen Sie bei all dem Erfolgsstreben und den materiellen Zielen nicht, dass diese lediglich ein Teil des großen „Glückskuchen“ sind. Werfen wir einen Blick auf die Forschung.
Beispiel aus der Forschung
Die Glücksforschung (Layard 2005) hat sechs zentrale Glücksfaktoren identifiziert:
 familiäres und soziales Umfeld (teils auch als einzelne Faktoren aufgeführt)
familiäres und soziales Umfeld (teils auch als einzelne Faktoren aufgeführt)
 befriedigende Arbeit (auch Studium)
befriedigende Arbeit (auch Studium)
 Gesundheit
Gesundheit
 persönliche Freiheit
persönliche Freiheit
 Lebensphilosophie (Religion) und
Lebensphilosophie (Religion) und
 finanzielle Lage (Einkommen).
finanzielle Lage (Einkommen).
Die materielle Lage und ein befriedigendes Studium wurden ja bereits oben angesprochen. Vor allem zwischenmenschliche Beziehungen zu Familienmitgliedern oder zu Studienkollegen sind sehr wertvoll für unser Glücksempfinden. Die Kontakte geben uns Austausch, Abwechslung und Lebensfreude. Dem Entwurf einer Lebensaussage, die sich neben persönlichen Wünschen auch am Gemeinwohl orientiert, wird ebenfalls eine starke Wirkung auf das Glücksempfinden attestiert. Es bringt uns einfach Sinn in das Leben. Aus dem Grund können Sie sich gleich anschließend in Kapitel 2.2 an diese Aufgabe machen. Die Gesundheit (vgl. Kap. 6) rückt besonders in älteren Jahren oder bei eigenen nachhaltig erlebten Krankheitsfällen ins Zentrum. Die persönliche Freiheit ist wesentlich für unser Selbstwertgefühl. Jeder Mensch erfährt zwar immer einen Grad der Fremdbestimmung, die Einengung darf jedoch nicht als zu groß wahrgenommen werden.

Abb. 5: Glücksfaktoren während der Studienzeit
Die eigene Lebensperspektive finden
In einer Lebensphilosophie steht das Glück in der Regel an oberster Stelle. Es ist aber ein grobes, wenig exakt umschriebenes Element. Auch sagt es wenig über die Lebensaussage allgemein aus. Es sind also Vorstellungen und Wünsche zu benennen, die man erreichen will. Um diese zu identifizieren, muss man sein Leben, seine Wünsche und das, was dahinter steckt, genau analysieren. Nur, wer ein Verständnis für seine eigene Persönlichkeit gewinnt, d.h. sich selbst und seine Werte erkennt, kann ein Persönlichkeitsmanagement entwickeln, indem er Ziele definiert, die ihn wirklich motivieren. Aus der Analyse seiner Werte erfolgt eine Vergabe von Lebensprioritäten.
2.2 Lebensaussage ableiten
Die Bezugspunkte finden
Jeder Mensch hat im Leben seine eigene spezifische Lebensaufgabe oder Berufung, auch wenn er sich dieser nicht zu jedem Zeitpunkt 100-prozentig bewusst ist. Die Grundidee wäre, schon am Anfang des Handelns das Ende im Sinn zu haben, indem Sie eine Aussage über das persönliche Leben oder eine eigene Philosophie schaffen. Diese Aussage legt fest, was Sie sein wollen und auf welchen Prinzipien Ihr Handeln beruht. Entwerfen Sie Ihre Lebensaussage spätestens anfangs Ihres Studiums, wenn Sie bis dahin noch nicht existiert. Am besten können Sie die Aussage formulieren, wenn Sie aus einer imaginären späteren Lebensposition einen Blick zurück werfen würden. Im Extremen wäre das Ende Ihres Lebens der Ausgangspunkt für den Entwurf der Aussage. Wem dies zu weit geht und Sie keinen Bezug zu dieser Situation finden oder sich unwohl fühlen, dann wählen Sie z.B. Ihre Studienabschlussfeier als Bezugspunkt oder schreiben Sie einen Lebenslauf zu einem fiktiven Zeitpunkt, der in der Ferne liegt. Wenn Sie eine dieser Situationen durchgehen, schaffen Sie eine gute Grundlage, um einen Schritt weiterzugehen und eine fixierte Vision und Mission abzuleiten. Wählen Sie einen der drei folgenden Bezugspunkte aus:
Bezugspunkt 1: Die Beerdigung
Es ist ganz einfach, klingt aber gleichzeitig etwas makaber: Stellen Sie sich Ihre eigene Beerdigung vor, die Sie beobachten können. Dabei sollen ein Studien-, ein Arbeitskollege, ein Vorgesetzter und Ihr Partner etwas über Ihr Leben aussagen. Welche Persönlichkeit und Eigenschaften sollen die Redner charakterisieren? An welche zentralen Leistungen soll in den Reden erinnert werden? Arbeiten Sie Ihre Lebensaussage aus den gewünschten Formulierungen heraus. Was soll Sie am Ende Ihres Lebens im Kern ausgemacht haben?
Bezugspunkt 2: Die Abschlussfeier
Denken Sie an Ihre potenzielle Studienabschlussfeier. An diesem Abend soll ein Dozierender, ein Studienkollege, Ihre Eltern und Ihr Lebenspartner das Wort kurz ergreifen. Die Fragen werden ganz ähnlich wie im obigen Fall der Beerdigung sein: Über welche Erlebnisse werden Sie berichten? Was werden die Anwesenden über Ihre Fähigkeiten und Ihren potenziellen Arbeitgeber sagen? Worauf werden Ihre Eltern besonders stolz sein? Über welche lustigen Ereignisse soll berichtet werden? Wie schätzen Sie sich an diesem Tag ein, worauf wollen Sie gerne zurückblicken? Was wollen Sie bis dahin unbedingt im Studium erlebt haben?
Bezugspunkt 3: Lebenslauf im Jahr 20XX
Sie wählen ein Jahr, das weit in der Zukunft liegt, und schreiben auf, was Sie in dieser Zeit erreicht haben wollen. Problematisch ist bei dieser Betrachtung, dass Sie sich etwas zu sehr auf die Karriere orientieren und das Soziale etwas aus dem Auge verlieren könnten. Beachten Sie, dass Sie nicht den ganzen Lebenslauf füllen müssen, sondern auch einzelne Fragen ausschließen können. Füllen Sie Tabelle 2 nach Ihren Wünschen aus.
Lebenslauf im Jahr 20XX
Wohnort, Familienstand, Kinder
 Wo wollen Sie einmal leben?
Wo wollen Sie einmal leben?
 Wollen Sie dort in einer Partnerschaft leben?
Wollen Sie dort in einer Partnerschaft leben?
 Wie viele Kinder wünschen Sie sich?
Wie viele Kinder wünschen Sie sich?
Studium
 Was wollen Sie studiert haben?
Was wollen Sie studiert haben?
 Ist ein Auslandsstudium vorhanden? Wo?
Ist ein Auslandsstudium vorhanden? Wo?
 Welche Studienschwerpunkte waren vorhanden?
Welche Studienschwerpunkte waren vorhanden?
 In welchem Zeitraum lag das Studium?
In welchem Zeitraum lag das Studium?
Berufliche Daten
 Welche Arbeitgeber stehen dort?
Welche Arbeitgeber stehen dort?
 Wie lange war man bei einzelnen Arbeitgebern beschäftigt?
Wie lange war man bei einzelnen Arbeitgebern beschäftigt?
Zusatzqualifikationen
 Welche Sprachen sprechen Sie? Und wie gut?
Welche Sprachen sprechen Sie? Und wie gut?
 Welche Ausbildungen haben Sie gemacht?
Welche Ausbildungen haben Sie gemacht?
 Welche Weiterbildungen haben Sie neben dem Studium erlangt?
Welche Weiterbildungen haben Sie neben dem Studium erlangt?
Engagement und Hobbys
 Welche Vereinsmitgliedschaften bestehen?
Welche Vereinsmitgliedschaften bestehen?
 Was sind Ihre zentralen Freizeitaktivitäten?
Was sind Ihre zentralen Freizeitaktivitäten?
 Führen Sie ein Ehrenamt aus?
Führen Sie ein Ehrenamt aus?
Tab. 2: Fiktiver Lebenslauf im Jahr 20XX
2.3 Persönliche Vision formulieren
Die Visionen weisen den Weg
Eine Vision bildet die stabile Basis für Ihr Studienleben und steht in enger Verbindung zu Ihrer Lebensaussage (vgl. Kap. 2.2). Sie ist eine schriftlich fixierte intensive Vorstellung davon, wie es am Ziel sein soll – zur Zeit der Formulierung also ein Traum. Damit liefert die Vision Orientierung, Kraft, Energie, Freude im Studium und ist ein roter Faden, an dem man sich orientieren kann. Sie wird zum Wegweiser in bewegten Studienzeiten und bei der Ausarbeitung von Studienzielen. Die persönliche Vision ist absolut individuell und begleitet Sie Ihr ganzes Studium und überdauert auch die Zeit danach. Sie ist der große Überbau und damit auch von Bedeutung für unser Gehirn, das nach Vernetzung und Struktur sucht (vgl. Kap. 4.1). Um die Vision kann gut ein Strukturnetz gesponnen werden. Im Gegensatz zur Lebensaussage ist die Vision weniger weitreichend und umfasst meist einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren. Aus diesem Grund ist eine Lebensaussage eine gute Basis für die weniger weitgehende Formulierung einer Vision.

Abb. 6: Formulierung einer Vision
Studienbeispiel
Ich möchte als Berufsschullehrer Jugendliche auf ihrem weiteren beruflichen und privaten Lebensweg unterstützen, in-dem ich ihnen Wissen und gesellschaftliche Werte vermittle.
Durch diese Tätigkeit leiste ich einen Beitrag für das Fortkommen der Gesellschaft.
Was hält von der Formulierung einer Vision ab?
Gerne wird das Zeitargument als beliebter Entschuldigungsgrund vorgeschoben: „So viel Nachdenken kostet doch Unmengen meiner wichtigen Zeit.“ Oder man hält den Ansatz von vornherein für Unfug, der so oder so nicht oder nur sehr schwer erreichbar ist. Durch solch eine Verhaltensweise ist man primär reaktiv und verkennt die Kraft, die eine Vision vermittelt. Ein gerne aufkommendes Problem ist auch, dass man nach einiger Zeit erkennt, dass die Vision sehr „weit weg ist“ und nicht erreichbar erscheint. In diesem Fall ist die Lösung einfach: Wenn Sie eine sehr ambitionierte Vision formuliert haben, betrachten Sie diese einfach als Stern. Man kann diesen wohl nicht erreichen, aber man kann sich an ihm gut orientieren. Notfalls können Sie selbstverständlich auch Ihre Vision umformulieren. Machen Sie sich immer deutlich: Eine Vision ist als Vorgabe für Ihre Studienmission und Ihre Studienziele wichtig.

Abb. 7: Die Vision steht im Zentrum
2.4 Persönliche Mission fixieren
2.4.1 Inhalt der Mission
Eine Mission dient der Veranschaulichung
Eine Mission beleuchtet den Studien- und Lebenszweck, d.h. die aktuelle und zukünftige Fokussierung, das Selbstverständnis, Stärken und Schwächen. Darüber haben Sie sich teils bereits bei der Formulierung Ihrer Lebensaussage Gedanken gemacht. Beantworten Sie nun in der schriftlich fixierten Mission folgende Fragen:
 Was könnte ich tun? (Umwelt)
Was könnte ich tun? (Umwelt)
 Was kann ich tun? (Know-how)
Was kann ich tun? (Know-how)
 Was will ich tun? (Motivation)
Was will ich tun? (Motivation)
 Welche Anspruchsgruppe erwartet, dass ich es tue?
Welche Anspruchsgruppe erwartet, dass ich es tue?
Das tiefere Ich erkennen
Aus der Verbindung von Vision und Mission ergibt sich eine Handlungsrichtung für die weitere Studienplanung und eine Leitlinie für die Studienorganisation. Die Vorgaben konkretisieren sich in den Zielen (vgl. Kap. 2.5). Um Klarheit für eine Formulierung einer Mission zu gewinnen, ist es ratsam, sich seiner Selbst bewusst zu werden. Es sollte noch ein Blick über Ihre eher allgemein gehaltene Lebensaussage hinaus sein. Um diese Erkenntnis zu erlangen, kann man eine SWOT-Analyse (vgl. Abb. 8) oder ein Fotoalbum der persönlichen Stärken und Schwächen als Instrument einsetzen. Wenn Sie nach dieser Analyse einen Kontrast zwischen Ihrer Vision und Ihrer Mission erkennen, sollten Sie Ihre Vision u.U. nochmals durchdenken.

Abb. 8: Mit der SWOT-Analyse zur Mission
2.4.2 SWOT-Analyse
Was genau ist eine SWOT-Analyse?
Die SWOT-Analyse ist ursprünglich ein Management-Werkzeug, wird aber auch für formative Evaluationen und zur Qualitätsentwicklung von Programmen (z.B. im Bildungsbereich) und eben für die Selbstanalyse eingesetzt. Ausgangspunkt für eine persönliche SWOT-Analyse ist eine (selbst-)kritische Interpretation Ihrer jetzigen Situation unter Berücksichtigung der eigenen Fähigkeiten und der Umwelt. Mit dieser einfachen und flexiblen Methode werden die eigenen Stärken (engl. Strength) und Schwächen (engl. Weakness) analysiert. Es wird die Frage beantwortet: „Welche Stärken und Schwächen bringe ich für die erfolgreiche Bewältigung meines Studiums ein?“ Zudem werden externe Chancen (engl. Opportunities) und Gefahren (engl. Threats) betrachtet, welche den Studienerfolg fördern bzw. einschränken könnten. Die SWOT-Analyse ist damit eine Standortanalyse.
Leite Deine Stärken und Schwächen ab
Bei dem Notieren der Stärken sind Fertigkeiten im Sinne von Fachund Methodenkenntnissen sowie Fähigkeiten und Eigenschaften im Sinne von persönlichen Charaktermerkmalen zu erfassen. Gleiches gilt für das Formulieren konkreter Schwächen. Bei den Chancen gilt es, sowohl auf fiktive berufliche als auch persönliche Entwicklungsmöglichkeiten einzugehen. Häufig leiten sich Chancen aus den Stärken und Risiken aus den Schwächen ab. Mit Hilfe dieser Methode kann die Selbstkenntnis wesentlich gesteigert werden. Selbstkenntnis wiederum ist eine essentielle Voraussetzung für den Studienerfolg. Wer genau weiß, was er mag und was er gut kann, kann dieses Wissen auch glaubwürdig und authentisch anderen gegenüber kommunizieren. Nur wenn Sie ihre Defizite erkennen, können Sie an diesen arbeiten und sie minimieren. Sie können Ihre Individualität entdecken und zeigen, was in Ihnen steckt. Gleichzeitig ist anzuraten, durch die Kenntnis der eigenen Schwächen mit sich selbst respektvoll umzugehen. Es nutzt nichts, sich selbst abzuwerten und als unqualifiziert zu empfinden. Stärken sollte man hingegen entsprechend würdigen und stolz darauf sein, denn diese kann man gut für das Studium nutzen.
Erfasse Umweltfaktoren
Eine SWOT-Analyse umfasst eine intensive Recherche, damit möglichst viele Daten über Chancen und Risiken in Erfahrung gebracht werden und so die spätere Entscheidungsfähigkeit positiv beeinflussen. Es kann sich etwa um Informationen über Ihre Traumhochschule oder Ihren Traumberuf handeln:
 Hochschule: Image, Studien- und Beratungsangebote
Hochschule: Image, Studien- und Beratungsangebote
 Studiengang: Studien- und Prüfungsordnungen
Studiengang: Studien- und Prüfungsordnungen
 Erfahrungen von Absolventen Ihres gewünschten Studienganges
Erfahrungen von Absolventen Ihres gewünschten Studienganges
 Entwicklungen der Branche Ihres Traumberufes
Entwicklungen der Branche Ihres Traumberufes
 Studien mit Vorhersagen über Jobs der Zukunft
Studien mit Vorhersagen über Jobs der Zukunft
 Nachfragen bei einem Berufsberater
Nachfragen bei einem Berufsberater
 Beratung eines qualifizierten Wissenschafts-Coachs
Beratung eines qualifizierten Wissenschafts-Coachs
Stelle Fragen
Tabelle 3 illustriert einige Fragen, die Studierende sich bei der Konzeption einer SWOT-Analyse stellen können. Aus der Kombination der Stärken/Schwächen-Analyse und der Chancen/Gefahren-Analyse wird die Situation in ihrer Gesamtheit gut erfasst.
| S | Strengths Stärken |  Welche fachlichen Kenntnisse habe ich bisher aus Schule, Studium und Beruf erworben? Welche fachlichen Kenntnisse habe ich bisher aus Schule, Studium und Beruf erworben? Was kann ich besonders gut? Was kann ich besonders gut? Warum sind andere gerne mit mir zusammen? Warum sind andere gerne mit mir zusammen? Wofür wurde ich bisher gelobt? Wofür wurde ich bisher gelobt? Was hat mich erfolgreich gemacht? Was hat mich erfolgreich gemacht? Was macht mich stolz auf meine Person? Was macht mich stolz auf meine Person? Was gehe ich besonders gerne an? Was gehe ich besonders gerne an? Was macht mir wirklich Spaß? Was macht mir wirklich Spaß? Welche Werte können mich treiben? Welche Werte können mich treiben? |
| W | Weaknesses Schwächen |  Wo fühle ich mich beim Erledigen von Aufgaben unsicher? Wo fühle ich mich beim Erledigen von Aufgaben unsicher? Was kann ich nicht so gut? Was kann ich nicht so gut? Welche Rückschläge habe ich gehabt? Warum? Welche Rückschläge habe ich gehabt? Warum? Was mögen andere weniger an mir? Was mögen andere weniger an mir? Was macht mir keinen Spaß? Was macht mir keinen Spaß? Was stimmt mich unzufrieden? Was stimmt mich unzufrieden? |
| O | Opportunities Chancen |  Wer kann mich am besten bei meinem Studienweg unterstützen? Wer kann mich am besten bei meinem Studienweg unterstützen? Wie sieht es mit den Arbeitsmöglichkeiten in meinem Berufsfeld aus? Welche Berufsfelder werden wachsen? Wie sieht es mit den Arbeitsmöglichkeiten in meinem Berufsfeld aus? Welche Berufsfelder werden wachsen? Welcher Studiengang respektive welche Fächerkombinationen werden gefragt sein? Welcher Studiengang respektive welche Fächerkombinationen werden gefragt sein? Gibt es positive Trends, denen man sich anschließen könnte? Gibt es positive Trends, denen man sich anschließen könnte? |
| T | Threats Risiken |  Welche gesellschaftlichen Entwicklungen könnten meinen Studienerfolg einschränken? Welche gesellschaftlichen Entwicklungen könnten meinen Studienerfolg einschränken? Welche negativen Veränderungen könnten sich in meinem Studium oder auf meinem angestrebten Berufsfeld ergeben? Welche negativen Veränderungen könnten sich in meinem Studium oder auf meinem angestrebten Berufsfeld ergeben? Gibt es jemanden oder etwas, der/das meinem Studienerfolg besonders gefährlich werden könnte? Gibt es jemanden oder etwas, der/das meinem Studienerfolg besonders gefährlich werden könnte? |
Tab. 3: SWOT-Analyse zum Studium
Dritte helfen bei der Einschätzung
Um das Analyseergebnis zu objektivieren, ist ein Selbstbild/Fremdbild-Abgleich ein gutes Hilfsmittel. Dabei setzen Sie sich mit einer weiteren, Ihnen vertrauten, aber auch kritischen Person zur gemeinsamen SWOT-Analyse zusammen. Der oder die Auserwählte führt eine ähnliche Analyse für Sie durch. Danach liegen zwei SWOT-Analysen vor – eine als Selbstbild, die andere als Fremdbild. Im Gegenzug könnten Sie Ihrem Ratgeber bei einer SWOT-Analyse zur Seite stehen. Anschließend können die ausformulierten SWOT-Ergebnisse abgeglichen, diskutiert oder zusammengefasst werden. Vergleichen Sie nun Ihre Ergebnisse mit den im vergangenen Kapitel vorgestellten Fähigkeiten und Eigenschaften eines Studierenden sowie mit dem Anforderungsprofil Ihres Wunschstudienganges (die Informationen finden sich meist leicht auf einer Hochschul-Homepage).
Die Handlungsschritte ableiten
Im letzten Schritt werden konkrete Handlungsansätze formuliert:
 Wie kann ich meine wesentlichsten Stärken für mein Studium noch verstärken?
Wie kann ich meine wesentlichsten Stärken für mein Studium noch verstärken?
 Wie kann ich meine wesentlichsten Schwächen für mein Studium vermeiden?
Wie kann ich meine wesentlichsten Schwächen für mein Studium vermeiden?
 Wie kann ich meine größten Chancen für mein Studium nutzen?
Wie kann ich meine größten Chancen für mein Studium nutzen?
 Wie kann ich meinen bedrohlichsten Risiken für mein Studium begegnen?
Wie kann ich meinen bedrohlichsten Risiken für mein Studium begegnen?
Die Verbesserungsanalyse zu den Stärken und Schwächen lässt sich gut tabellarisch erfassen:


Tab. 4: Verbesserungsanalyse
Und damit ist auch schon der nächste wichtige Planungspunkt erreicht. Die angedachten Maßnahmen und Ergebnisse aus der SWOT-Analyse und Ihrer Mission müssen nun noch in eine klare Form gebracht werden: die Zielformulierung (vgl. Kap. 2.5).

Abb. 9: Schritte einer persönlichen SWOT-Analyse
2.4.3 Fotoalbum der persönlichen Stärken und Schwächen
Mit Bildern arbeiten
Falls Ihnen die SWOT-Analyse zu abstrakt erscheint, kann ein imaginäres Fotoalbum der Stärken und Schwächen vielleicht Ihre Kreativität steigern. Diese Methode wird ursprünglich in der psychotherapeutischen Praxis eingesetzt (Kämmerer 2009) und lässt sich perfekt zur Selbstanalyse verwenden. Durch die Kreation von Bildern erhalten Sie eine gewisse Selbstdistanz, die Ihnen eine Außensicht auf sich selbst ermöglicht.
So sieht die Anwendung konkret aus
In der Hochschulpraxis wende ich das Instrument gerne im Coachingprozess mit Studierenden in folgender Form an: Ihre Aufgabe ist es, in Ihrer Vergangenheit nach besonderen Beispielen oder Situationen zu suchen, die Sie als positive Ressource (Stärke) oder Schwäche erleben. Diese Momente sollen in einer konkreten Situation bildlich vorgestellt werden. Im Anschluss sollten Sie analysieren, wie das Bild im Nachhinein auf Sie und andere wirkt. Wenn Sie zeichnerisch begabt sind, können Sie sich auch gerne an die Zeichnung der Situationen machen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.