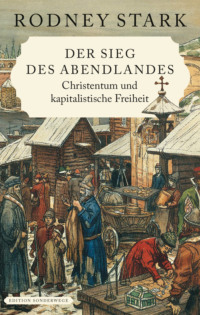Kitabı oku: «Der Sieg des Abendlandes. Christentum und kapitalistische Freiheit», sayfa 6
Innovationen in der Kriegsführung
Vor dem Mittelalter gab es keine schwere Kavallerie. Berittene Truppen preschten nicht vornüber gebeugt im Galopp voran oder legten das ganze Gewicht von Pferd und Reiter hinter einen Lanzenstoß.38 Denn es gab keine Steigbügel und angemessene Sättel. Ohne den Widerstand der Steigbügel, gegen die er mit den Füßen drücken konnte, wäre der Reiter beim Lanzenstoß einfach vom Pferd gefallen. Gleichermaßen kann die Stabilität des Reiters bei plötzlichen Erschütterungen durch einen hohen Vorder- und Hinterzwiesel deutlich verbessert werden – letzterer ist am besten gewölbt, damit er einen Teil der Hüften des Reiters abdeckt.39 Es war weder Rom noch ein anderes kriegerisches Imperium, das die schwere Kavallerie erfand; deren berittene Truppen saßen allesamt auf leichten und fast flachen Satteldecken oder ritten gar ungesattelt und kannten sicher noch keine Steigbügel. Erst die »barbarischen« Franken schickten im Jahr 732 die erste schwere Kavallerie ins Feld: Ritter in ihrem Harnisch saßen fest auf normannischen, mit Steigbügeln und hohen Zwieseln versehenen Sätteln und streckten ihre Lanzen nach vorn.
Noch lange nach dem Aufkommen der Artillerie waren berittene und mit Rüstungen versehene Kämpfer in Kriegen eine gängige Erscheinung. Die Chinesen waren die ersten, die Schwarzpulver benutzten, allerdings kam es bei ihnen nur für Feuerwerke und als Brandbeschleuniger zum Einsatz. Dennoch entwickelten sie eine Frühform der Kanone,40 womöglich zur gleichen Zeit, als die Kunde des chinesischen Schwarzpulvers Europa erreichte, nämlich zwischen 1300 und 1310. Während aber die Chinesen ihre Kanonen nur sehr langsam entwickelten, sie selten benutzten und deren Technik auch nicht auf Schusswaffen zu übertragen vermochten, wurde in Europa schon innerhalb kürzester Zeit scharf geschossen. Womöglich kamen Kanonen zum ersten Mal 1324 bei einer Schlacht im Krieg von Metz zum Einsatz.41 Sicher aber ist, dass ab 1325 Kanonen in ganz Westeuropa benutzt wurden und das Feldgeschütz in den Händen der Europäer das gesamte Kriegswesen revolutionierte.42 So konnten nun die Adeligen sich nicht länger auf ihre Burgen zurückziehen, um vor Angreifern sicher zu sein, die keine tagelange Belagerung riskieren wollten, und selbst hochwertigste Rüstungen boten auf dem Schlachtfeld keinen Schutz mehr. Das neue Kriegsgerät hatte eine zu große Durchschlagskraft. Die Kanone konnte sich außerdem so schnell ausbreiten, weil die Grundlage ihrer Fertigung durch den Glockenbau – in beiden Fällen kamen ähnliche Herstellungstechniken zum Einsatz – in ganz Europa bereits etabliert war.
Daneben bildeten sich im Europa des Mittelalters die großen Seemächte heraus. Deren größter Nutznießer dürfte auf lange Sicht das Handelswesen gewesen sein, weniger das Militär. Und doch legte dieses den Grundstein für jenes – nur weil Kriegsschiffe die Seestraßen der Welt kontrollierten, war es den Europäern möglich, ein Monopol im Fernhandel zu erringen und überseeische Imperien aufzubauen.43
Eine der ersten Erfindungen auf diesem Gebiet war das Heckruder. Die Griechen und Römer manövrierten ihre Seefahrzeuge mit Steuerrudern, zumeist mit zweien gleichzeitig, einem auf je einer Seite des Hecks. Im frühen 11. Jahrhundert brachten die Europäer ein weiteres Ruder an den Achtersteven an, wodurch ein Schiff sehr viel besser zu steuern war. Um den Gebrauch dieses Ruders auf größeren Seefahrzeugen zu erleichtern, wurden mechanische Verbindungsstücke entwickelt, die es einem einzelnen Steuermann ermöglichten, ein Schiff selbst bei schwerem Seegang zu manövrieren.44 Eine weitere Innovation betraf den Schiffbau. Die römischen und griechischen Konstrukteure hatten die Schiffsrümpfe noch so gebaut, dass sie die einzelnen Planken durch Zapfen miteinander verbanden und erst in einem späteren Arbeitsgang ein stützendes Skelett bzw. einen Rahmen hinzufügten. Die Europäer des Mittelalters dagegen bauten zuerst den Rahmen und brachten dann die Planken für den Rumpf übereinander lagernd an, verbanden sie mit Hilfe von Dübeln und kalfatertern die Fugen (dichteten sie mit Werg und Teer ab), anstatt aufwendige Verbindungsstücke dazwischen zu setzen. Die mit dieser Technik gebauten Rümpfe waren zwar weniger strapazierfähig, doch konnte durch sie viel kunstfertige Feinarbeit eingespart werden, so dass sehr viel mehr Boote für die gleichen Herstellungskosten gebaut werden konnten.45 Eine dritte Innovation bestand darin, dass man die Überlegenheit der Feuerkraft bei Seegefechten erkannte. Im frühen maritimen Kriegswesen wurde noch von Schiff zu Schiff gekämpft. Kriegsschiffe waren daher bis zum Bersten vollgestopft mit Soldaten. Sobald sie aber aus der Kanone ein Präzisionswerk entwickelt hatten, begriffen die Europäer, dass es vernünftiger war, feindliche Schiffe aus einer gehörigen Distanz zum Sinken zu bringen. Auf diese Weise gelang der Heiligen Liga der erstaunliche Endsieg über die Türken bei der Seeschlacht von Lepanto im Jahr 1571, durch welche die Seemacht des Osmanischen Reiches in sich zusammenbrach. Die europäischen Schiffe hatten nicht nur viel mehr und viel bessere Kanonen als die Türken, sondern sie blockierten nicht länger ihr Schussfeld durch den im Weg stehenden Rammsporn bzw. Schiffsschnabel. Da man nicht länger Schiff an Schiff kämpfte, musste man den Feind auch nicht mehr rammen. Die Europäer feuerten mächtige Salven auf die osmanischen Schiffe ab, während sie gleichzeitig auf sie zusteuerten; die Türken dagegen mussten zunächst anhalten und seitwärts drehen, damit sie feuern konnten, wodurch sie eine viel größere Angriffsfläche boten.46
Und doch war die wichtigste maritime Innovation des Mittelalters die Galeasse, eine Kombination aus Segel- und Ruderschiff, bestehend aus Kastellen vorn und achtern, mehreren Masten und einem komplexen Gefüge von Segeln (sowohl des viereckigen Typs Rahsegel wie des dreieckigen Typs Lateinersegel). Die ersten Galeassen wurden »Koggen« genannt und traten zuerst im 13. Jahrhundert in Erscheinung.47 Koggen hatten keine Ruder und waren echte Segelschiffe, die dennoch weite Reisen mit schweren Frachten bestreiten konnten. Aufgetakelt als Kampfschiffe, konnten Galeeren und ihre späteren Abkömmlinge viele schwere Geschütze mit sich führen – etwa auf dreifachen, übereinanderliegenden Kanonendecks. Auf diese Weise verschaffte sich das Mittelalter Zugang zum offenen Meer. Die Schiffe brauchten sich nicht länger dicht an die Küsten zu halten oder in sicheren Gewässern wie dem Mittelmeer zu segeln. Sie wagten sich nun sogar während der Wintermonate hinaus, was Kapitäne in früheren Zeiten nur äußerst ungern getan hatten, wodurch sich die durch jedes einzelne Schiff erzielten Profite im Winter deutlich erhöhten.
Doch auch wenn die Schiffe nicht länger die nahe Küste als sicheren Hafen benötigten, blieben sie doch auf Grenzmarkierungen angewiesen. Das änderte sich erst durch den Kompass. Die Behauptung, dass der magnetische Kompass Europa von China aus über die islamische Welt erreichte, ist jedoch falsch. Er wurde unabhängig sowohl in China wie in Europa erfunden, vermutlich um das 11. Jahrhundert herum. Die Chinesen waren zufrieden mit einem sehr primitiven Kompass, bei dem eine magnetisierte Nadel in einer Flüssigkeit herumschwamm, die zumindest die Nord-Süd-Achse bestimmen ließ. Die Chinesen benutzten ihn vor allem für magische Riten – an Bord von Schiffen dürften sie den Kompass dagegen erst lange nach den Europäern eingesetzt haben. Diese wiederum fügten dem Kompass bald nach der Erfindung der schwimmenden Nadel ein komplettes Diagramm der Himmelsrichtungen hinzu sowie den Diopter, mit dessen Hilfe die Seemänner nicht nur erkannten, wo Norden lag, sondern auch ihren genauen Steuerkurs bestimmen konnten. Von nun an wussten sie genauen Kurs in jedwede Richtung zu nehmen. Die zeitweilige Häufung schriftlicher Berichte von dieser neuen Erfindung belegt, wie schnell sie sich in nur wenigen Jahren von Norwegen bis Italien ausbreitete.48 Als sie den Kompass einmal besaßen, begannen europäische Seefahrer damit, ihren Aufzeichnungen eigens Grafiken beizufügen, die die genauen Kompass-Positionen angaben. Dadurch vermochten sie sicher zu reisen, auch wenn der Himmel allzu bedeckt war, um anhand der Sterne ihre genaue Position zu bestimmen.49 Ohne Kompass hätte selbst Kolumbus nicht in See stechen können, geschweige denn andere, die seiner Route später folgten.
All diese erstaunlichen Entwicklungen können auf die singuläre christliche Überzeugung zurückgeführt werden, dass der Fortschritt eine gottgewollte Pflicht darstelle, die in der Gabe der Vernunft enthalten sei. Die Überzeugung, dass es stets zu neuen Technologien und Techniken kommen werde, stellte einen wesentlichen Leitsatz des christlichen Glaubens dar. Aus diesem Grund verurteilten Bischöfe auch keine Uhren oder Segelschiffe, selbst wenn diese aus religiösen Gründen in diversen nicht-westlichen Gesellschaften verboten waren. Manch wichtige technische Erfindung stammte sogar von Mönchen oder kam zuerst in ihren Klöstern zum Einsatz. Innovationen breiteten sich rasch von einem Ort zum nächsten aus, da – gänzlich anders als in der falschen Legende eines abgeschotteten und engstirnigen Europas – die Transportmittel des Mittelalters schon bald die der römischen Zeiten bei weitem übertrafen.
Innovationen im Landverkehr
Eine der irreführendsten Behauptungen über den angeblichen Verfall Europas im Mittelalter bezieht sich auf die Vernachlässigung der römischen Straßen – so wurden damals mancherorts Pflastersteine entnommen und im lokalen Bauwesen wiederverwendet. Als die Straßen auf den Hund kamen, so lautet die Mär, verkam auch der Fernhandel. Europa sei zu einem Archipel von isolierten und weltabgewandten Gemeinden geworden. Allerdings übersieht man dabei, dass der römische Handel vor allem Luxusgüter betraf und ansonsten höchst unproduktiv war. Überhaupt spielte der Handel im Wirtschaftsleben der römischen Städte bloß eine kleine Rolle, da der Reichtum der urbanen Eliten viel eher in ländlichen Regionen erzielt wurde50 und ansonsten politischer Korruption zuzuschreiben oder Beute aus Eroberungsfeldzügen war. Zum Teil erlahmte der Fernhandel wegen der mangelnden Nachfrage nach Luxusgütern, die wiederum mit dem Schwund an privatem Reichtum zu tun hatte. Maßgeblicher war allerdings, dass der Großteil dessen, was römischer Fernhandel genannt wurde, eigentlich gar kein Handel, sondern eher einseitige Entwendung war. Es war ein »Verschieben von Pachten und Tributen«, was im Unterschied zum regelrechten Handel keine Erlöse hervorbrachte, sondern nur jene verarmen ließ, denen Güter abgenötigt wurden.51 Ebenso oft wird der Umstand übersehen, dass alle Handelsaktivitäten, die die Zeit überstanden, von gleich großem Nutzen waren für Ex- wie für Importeure.52 Die römischen Straßen wurden jedoch deshalb vernachlässigt, weil sie zum Gutteil unbrauchbar waren.
Die Behauptung, dass es den Europäern des Mittelalters sowohl an Urteilskraft wie Mitteln fehlte, um die »prachtvollen« römischen Straßen weiter zu unterhalten, stammt von Altphilologen, die entweder nie eine der noch existierenden Straßen besichtigt haben oder die so derart keine praktische Erfahrung besaßen, dass sie selbst offensichtliche Mängel gar nicht erkannten – etwa den Umstand, dass die römischen Straßen für große Wagen viel zu eng waren53 oder vielerorts zu steil, um etwas anderes als Fußgänger durchzulassen. Zudem hatten die Römer oft keine Brücken gebaut und sich auf Furten verlassen, die man zwar zu Fuß durchqueren konnte, die aber für Karren und Wagen zu tief waren.54 Diese Unzulänglichkeiten waren darauf zurückzuführen, dass die römischen Straßen an sich nur dazu da waren, Soldaten einen schnellen Übergang von einem Imperium zum nächsten zu ermöglichen. Natürlich haben zivile Fußgänger sie ebenfalls genutzt, nicht anders als Tragtierkolonnen und auch menschliche Träger. Doch selbst die Soldaten gingen lieber nur an den äußersten Rändern der Straßen, wo ebenso fast alle zivilen Reisenden wanderten oder ihre Tiere entlangführten. Und warum? Weil die römischen Straßen zumeist mit Steinen gepflastert waren, so dass das Gehen darauf bei Trockenheit eine große Belastung für Beine und Füße war, und man bei Nässe gern auf ihnen ausrutschte. Solche Straßen waren bereits mühevoll für unbeschlagene Pferdehufe, jedoch eine echte Zumutung für Pferde mit Eisenhufen.
Man erinnere sich, dass vor dem Mittelalter gar nicht bekannt war, wie Pferde angeschirrt werden müssen, damit sie schwere Lasten ziehen können. Nicht nur sollte die Einführung des Kummets (oder Geschirrs) die Landwirtschaft revolutionieren, sondern in Kombination mit den essentiellen Innovationen im Wagenbau leistete das Kummet das Gleiche auch für das Transportwesen. Die Römer hatten nur langsame Ochsen, die sie zum Ziehen schwerer Lasten verwendeten. Was aber noch schlimmer war: ihre Karren und Wagen waren so primitiv, dass nur selten gewichtige Güter über weite Strecken über Land transportiert werden konnten. Man bedenke zudem, dass römische Karren und Wagen keine Bremsen hatten und daher auf Untergründen, die nicht völlig flach waren, sehr unsichere Vehikel darstellten! Ein weiteres Problem war, dass die vordere Radachse sich nicht drehen konnte, so dass das Gefährt umständlich um jede Ecke gezerrt werden musste.55 Auch an dieser Stelle haben uns die Altphilologen lange in die Irre geführt, und niemand mehr als Johann Christian Ginzrot, ein deutscher Gelehrter des 19. Jahrhunderts, dessen »Illustrationen« in unzähligen Büchern, Lexika und Wörterbüchern erschienen sind.56 In seinem berühmten Werk Die Wagen und Fahrwerke (1817), veröffentlichte Ginzrot detaillierte Zeichnungen von griechischen und römischen Wagen und Fahrgestellen, die allesamt über ein erstaunlich modernes System an Drehlagern verfügen, welche der vorderen Radachse das Wenden ermöglichen und die darüber hinaus hervorragende Bremsen besitzen. Leider haben Ginzrots akademische Leser jedoch offenbar seine Beichte im Vorwort überlesen, in dem er eingesteht, dass diese Zeichnungen »auf meinen Vorstellungen beruhen, da ich auf keinem alten Bauwerk entsprechende bildliche Darstellungen gefunden habe«.57 Tatsächlich fehlte es den allermeisten alten Künstlern an jeglichem Gespür für Mechanik, ihre Bilder zeigen häufig Räder ohne Achsen oder ohne Verbindung mit den Vehikeln selbst, unterschiedlich große Räder oder Pferde, die einen Wagen ohne jedes Geschirr ziehen und noch andere offensichtliche Fehler. Von praktischem Nutzen sind diese Illustrationen nicht. Es bedurfte erst sorgfältiger Textanalysen und archäologischer Funde, um die Wahrheit über die römischen Wagen und Karren herauszufinden.
Offenkundig ist allerdings, dass es bis zum Mittelalter gedauert hat, bis in Europa die Mittel für den Transport von schweren und klobigen Lasten auf langen Landstrecken entwickelt wurden. Nicht nur Fürsten und Gemeinderäte ließen Straßen und Brücken bauen, sondern auch Kirchen, Kaufmannsgilden und buchstäblich Hunderte privater Wohltäter.58 So waren es anonyme mittelalterliche Innovatoren, die Wagen mit Bremsen entwarfen, mit Radachsen, die sich drehten, und die Harnische entwickelten, mit denen umfängliche Gruppen von Pferden große Wagen ziehen konnten. Außerdem war es den Europäern mit ihren großen Galeeren nun auch möglich, den Atlantik zu erkunden, was ihnen neue und günstigere Handelsrouten von den italienischen Stadtstaaten nach England und in die heutigen Benelux-Staaten eröffnete.
Zu guter Letzt erfanden die Europäer des Mittelalters auch ein Geschirr mit Zügeln, mit welchem große Gespanne von Pferden oder Ochsen in lauter Zweier-Gruppen angeordnet werden konnten. Vorher hatten alle Pferde oder Ochsen Seite an Seite gehen müssen, was die Anzahl der eingesetzten Tiere stark einschränkte. So wäre es früheren Kulturen zum Beispiel unmöglich gewesen, 52 Ochsen nebeneinander einzusetzen, wohingegen die ach so »ignoranten« Europäer des 11. Jahrhunderts ein Gespann von 52 Ochsen in 26 Paaren anordneten, damit sie große Marmorblöcke beim Bau der hoch in den Himmel ragenden Kathedrale des französischen Dorfes Conques bewegen konnten.59
Fortschritt in der Hochkultur
Auch wenn man es Voltaire, Gibbon und anderen Verfechtern der Aufklärung nachsehen mag, dass sie die ingenieurtechnischen Errungenschaften und Innovationen in der Landwirtschaft und im Handel nicht wahrgenommen haben, so muss man sie doch ernstlich dafür kritisieren, dass sie die erstaunlichen Großleistungen des mittelalterlichen Europas auf den Gebieten der Hochkultur ignoriert oder gar negiert haben.
Musik. Die Musik der Griechen und Römer war monophon: eine einzelne musikalische Linie wurde von allen Stimmen und Instrumenten gleichzeitig gesungen und gespielt. Erst die Musiker des Mittelalters erfanden die Polyphonie, also das simultane Erklingen von zwei oder noch mehreren musikalischen Linien und folglich Harmonien. Wann genau das geschah, weiß man nicht, doch waren Harmonien offenbar schon vor 900 bekannt, da sie nämlich in einem Handbuch aus dieser Zeit erwähnt werden.60 Auch wurden im Mittelalter die Instrumente erfunden und perfektioniert, mit denen Harmonien erst wirklich ausgeschöpft werden konnten: die Orgelpfeife, das Clavichord, das Clavicembalo, die Geige, der Kontrabass und noch andere mehr. Das 10. Jahrhundert brachte schließlich ein geeignetes System zur musikalischen Notation hervor, das rasch bekannt wurde, so dass Musik in der Folge auch von Leuten akkurat gespielt werden konnte, die sie zuvor gar nicht gehört hatten.
Kunst. Unglücklicherweise wird die markante künstlerische Epoche, die im 11. Jahrhundert entstand, Romanik genannt, obwohl sie doch gar nichts mit dem zu tun hat, was die Römer geschaffen hatten. Der Name war eine bloße Ausgeburt von Professoren des 19. Jahrhunderts, die glaubten, dass Europa sich aus dem Mittelalter nur retten konnte, indem es auf die römische Kultur zurückgriff. So gesehen hätten in dieser Epoche eigentlich nur ärmliche Imitationen von römischen Errungenschaften entstehen können. Doch bestätigen heutige Kunsthistoriker durchgehend, dass die romanische Architektur, Plastik und Malerei auf ihre Weise originell und kraftvoll war, obwohl sie gar nichts mit der römischen Kunst zu tun hatte.61 Im 12. Jahrhundert folgte auf die Romanik dann die noch viel unvergleichlichere und erstaunlichere Epoche der Gotik. Es mag verwundern, doch wurden Architektur und Malerei der Gotik während der Aufklärung von den Kritikern heruntergemacht, da sie nicht »den Normen der Griechen und Römer entsprechen: ›Möge der, der sie erfunden hat, verflucht sein.‘«62 Die gleichen Kritiker glaubten, die Stilrichtung gehe auf die »barbarischen« Goten zurück und trage deshalb diesen Namen. Doch wie jeder, der auch nur einmal eine der großartigen gotischen Kathedralen besichtigt hat, weiß, ist das künstlerische Beurteilungsvermögen solcher Schreiber nicht besser als ihr Ruf. Das betrifft überhaupt ihre Missachtung für die architektonischen Errungenschaften jener Zeit, einschließlich des so wichtigen Strebebogens, der zum ersten Mal die Voraussetzung dafür bot, sehr hohe Gebäude mit eher dünnen Mauern und großen Fenstern zu bauen, was in der Folge wiederum zu Hochleistungen in der Produktion farbiger Kirchenfenster führte. Zu guter Letzt waren die nordeuropäischen Künstler des 13. Jahrhunderts die ersten, die Ölfarben benutzten und ihre Werke auf aufgespannte Leinwände malten, anstatt auf Holz oder Gipsputz. Das erlaubte dem Maler, »sich mehr Zeit zu nehmen, mit umso feineren Pinselstrichen zu arbeiten und malerische Wirkungen zu erreichen … die Wundern gleichkamen«.63 Jeder, der glaubt, dass die großen Leistungen der Malerei erst in der italienischen Renaissance begannen, sollte sich einmal aufmerksam die Werke von Jan und Hubert van Eyck anschauen. Soviel zu dem Vorurteil, dass das Jahrtausend, das auf den Untergang Roms folgte, eine künstlerische Wüste oder Schlimmeres gewesen sei.
Literatur. Gibbon verfasste seinen Verfall und Untergang des Römischen Imperiums auf Englisch, nicht auf Latein. Voltaire schrieb einzig und allein auf Französisch, Cervantes auf Spanisch und da Vinci auf Italienisch. Das war ihnen nur deshalb möglich, weil diese Sprachen eine literarische Form erhalten hatten durch mittelalterliche Großmeister wie Dante, Chaucer, die namenlosen Autoren der Chansons de Geste und all die Mönche, die seit dem 9. Jahrhundert die Lebensgeschichten von Heiligen auf Französisch niederlegten.64 Auf diese Weise wurde volkssprachliche Prosa in Schriftform abgefasst und populär gemacht. Dies zum Analphabetismus und zur Unwissenheit des finsteren Mittelalters.
Bildung. Als sie von der Kirche im 12. Jahrhundert gegründet wurden, waren die Universitäten etwas gänzlich Neues unter der Sonne – eine Institution, die sich ausschließlich der höheren Bildung verschrieb. Diese christliche Erfindung war etwas völlig anderes als die chinesischen Akademien, auf denen Mandarine ihr Training erhielten, oder auch die Zen-Schulen. Den neuen Universitäten ging es nicht primär darum, überlieferte Weisheiten weiterzugeben. Stattdessen erlangten sie ihren Ruhm – nicht anders als es noch heute geschieht – stets durch Innovation. So versuchten die Professoren vor allem, ihren Studenten Mittel zur Aneignung von Wissen an die Hand zu geben. Sie gaben sich nicht damit zufrieden, von den Griechen übernommene Weisheiten wiederzukäuen, sondern waren bereits darauf eingestellt, die Altvorderen zu kritisieren und zu korrigieren.65
Die beiden ersten Universitäten entstanden Mitte des 12. Jahrhunderts in Paris und Bologna. Um 1200 gründete man Oxford und Cambridge, gefolgt von einer ganzen Flut neuer Institutionen während des ganzen 13. Jahrhunderts: es entstanden Universitäten in Toulouse, Orléans, Neapel, Sevilla, Lissabon, Grenoble, Padua, Rom, Perugia, Pisa, Modena, Florenz, Prag, Krakau, Wien, Heidelberg, Köln, Budapest, Erfurt, Leipzig und Rostock. Ein verbreiteter Irrtum besagt, dass diese Häuser gar keine echten Universitäten gewesen seien, sondern nur aus drei oder vier Lehrern und einigen wenigen Dutzend Studenten bestanden. Aber auch das ist nicht wahr. Bereits im frühen 13. Jahrhundert schrieben sich zwischen 1000 und 1500 Studenten jeweils in Paris, Bologna, Oxford und Toulouse ein – in Paris waren es jedes Jahr sogar ca. 500 neue Studenten. Was die Qualität des Unterrichts angeht, darf man daran erinnern, dass in genau diesen Universitäten die Wissenschaft geboren wurde. Man beachte, dass diese Institutionen zutiefst christlich waren: alle Fakultäten unterstanden Ordensgemeinschaften und demzufolge auch alle frühen Wissenschaftler.
Wissenschaft. Über Generationen hinweg haben Historiker behauptet, dass die wissenschaftliche Revolution im 16. Jahrhundert einsetzte, als das heliozentrische Modell des Sonnensystems durch Nikolaus Kopernikus in Umlauf gebracht wurde. Was hier stattfand war jedoch eine Evolution und keine Revolution.66 So wie Kopernikus einfach den nächsten logischen Schritt in der Kosmologie seiner Zeit ging, so war auch die Blüte der Wissenschaft in dieser Epoche bloß die Kulmination eines allmählichen Fortschritts, der schon in den vorangegangenen Jahrhunderten begonnen hatte. Um die Vorwärtsbewegung bis zum heliozentrischen Sonnensystem kurz zu rekapitulieren, setzt man am besten bei den Griechen an. Diese gingen davon aus, dass es keine Vakuen geben könne und der Raum dementsprechend mit durchsichtiger Materie angestaut sein müsse. Himmelskörper seien folglich darauf angewiesen, ständig Reibung zu vermeiden, um sich selbst fortzubewegen, was im Umkehrschluss die unablässige Einwirkung von Kraft nötig mache. Manche lokalisierten diese Kraft, indem sie in den Himmelskörpern Götter erkannten, die mit hoher Geschwindigkeit durch den Äther flitzen. Andere postulierten die Existenz von übernatürlichen Wesen, die den Auftrag haben, die verschiedenen Sphären kontinuierlich anzuschubsen.
Der Bedarf nach Schubsern ließ erst dann nach, als Jean Buridan (1300–1358), Rektor der Universität zu Paris, Newtons erstem Bewegungsgesetz vorausgriff und erklärte, dass der Raum an sich ein Vakuum sei und dass, nachdem Gott die Himmelskörper einmal in Bewegung versetzt hatte (»einem jeden einen Impetus aufdrückte«), diese Bewegung nicht »danach nachließ oder zum Erliegen kam, da die Gestirne mit genau dieser einen zufrieden waren. Noch gab es einen Widerstand, der den Impetus hätte hemmen oder verderben können.«67 Buridan schlug einen nächsten logischen Schritt vor, der zu Kopernikus und seinem Modell hinleitete: dass nämlich die Erde sich um ihre eigene Achse dreht. Jedoch war es erst einem späteren Rektor der Pariser Universität vergönnt, diese These unter Dach und Fach zu bringen, nämlich Nicolas d’Oresme (1325 – 82), dem brillantesten der scholastischen Wissenschaftler. Sein Werk war ausgesprochen mathematisch und setzte somit einen hohen Maßstab für spätere Arbeiten in der Funktionslehre und der Astronomie. Die Idee, dass sich die Erde drehe und nicht die Sonne die Erde umkreise, hatten über die Jahrhunderte schon manche gehabt. Doch standen ihr stets zwei Einwände im Weg. Erstens, warum gibt es keinen ständigen, böigen Ostwind, der von der Rotation der Erde verursacht wird? Zweitens, warum fällt ein Pfeil, der in direkter Richtung in den Himmel geschossen wird, nicht ein gutes Stück hinter (oder auch vor) dem Schützen wieder zu Boden? Da genau das nicht passiert und der Pfeil genau geradlinig wieder zurückkommt, könne sich die Erde nicht drehen. Oresme entkräftete diese beiden Einwände. Einen Ostwind gebe es nicht, weil die Bewegung der Erde allen Objekten, einschließlich der Atmosphäre gleichermaßen zuteilwerde. Und dies beantworte auch den zweiten Punkt: in die Luft geschossene Pfeile besäßen nicht nur den vertikalen Impetus, der ihnen durch den Bogen mitgegeben werde, sondern gleichfalls einen horizontalen, der von der Erdbewegung herrühre.
Dann erschien Bischof Nikolaus von Kues (1401–64) und erklärte, dass »egal, ob ein Mensch sich auf der Erde, der Sonne oder einem anderen Stern aufhalte – es wird ihm immer so erscheinen, als befinde er sich im regungslosen Zentrum, wohingegen alle anderen Dinge in Bewegung seien«. Daraus folgerte er, dass Menschen ihrer Wahrnehmung, dass die Erde standortgebunden sei, nicht glauben sollten – womöglich war die Erde gar nicht fix. Von hier aus bedurfte es keinen Sprung ins Ungewisse mehr, um auf den Gedanken zu kommen, dass die Erde gar um die Sonne kreise.
All diese mittelalterliche Theoriebildung war Kopernikus wohlbekannt, schon weil er nicht der isolierte Domherr in einem abgelegenen polnischen Städtchen war, als der er oft dargestellt wird, sondern einer der hochgebildetsten Männer seiner Generation, nachdem er an den Universitäten von Krakau, Bologna (womöglich die beste Universität des damaligen Europas), Padua und Ferrara erzogen worden war.
Es gab so viel Fortschritt im sogenannten Finsteren Mittelalter, dass Europa schon im 13. Jahrhundert einen riesigen Vorsprung vor dem antiken Rom, den alten Griechen und auch vor dem Rest der damaligen Welt hatte.68 Warum? Vor allem, weil das Christentum die Lehre vertrat, dass Fortschritt »normal« war und es sowieso stets zu neuen Erfindungen kommen würde.69 Genau darin lag der revolutionäre Gedanke. Auch war der Glaube an den Fortschritt keineswegs auf Technologie oder Hochkultur beschränkt. Die Europäer des Mittelalters hatten sich überdies das Ziel gesetzt, immer neue und bessere Wege zu entwickeln, wie man Dinge tun konnte.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.