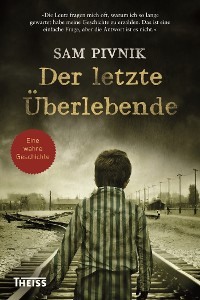Kitabı oku: «Der letzte Überlebende», sayfa 2
Meine Mutter hieß Fajgla. Sie war eine freundliche Frau und immer für mich da, wie man heute so sagt. Sie war eine gute Mutter, wie die meisten jüdischen Mütter. Damals war mir das nicht klar, aber ich war wohl ihr Lieblingskind. Oder vielleicht musste sie einfach nur mehr Zeit und Energie dafür aufbringen, mich zu verteidigen, so wie ich war. Kann sein. Sie trug manchmal den sheitel, aber sie war nicht so religiös wie mein Vater. Nathan war ihr ältester Sohn, zwei Jahre älter als ich. Uns verband eine Art Hassliebe, wie es bei fast gleich alten Brüdern oft der Fall ist. Wir hatten ein sehr unterschiedliches Temperament und haben uns gestritten, solange wir beide lebten. Ob ich ihn trotzdem irgendwie geliebt habe? Natürlich, er war ja mein Bruder. Und Blut ist dicker als Wasser, gerade auch in jüdischen Gemeinschaften.
Wenn ich nur wenig über meine anderen Geschwister erzähle, dann weil ich sie eigentlich nie richtig kennengelernt habe. Hendla war reizend, freundlich und intelligent. Sie war nie die große Schwester, die alles bestimmen wollte, weil sie wusste, dass das nicht funktionieren würde. Chana war ebenfalls sehr hübsch – ich war sechs Jahre alt, als sie geboren wurde. Dann gab es noch meine Brüder Majer, der drei Jahre jünger war, Wolf, der 1935 geboren wurde, und Josek, Jahrgang 1938. So sah unsere Familie aus: Großmutter Ruchla-Lea, Vater Lejbus, Mutter Fajgla und wir Kinder.
Man könnte vielleicht sagen, dass die Pivniks in den Dreißigerjahren die soziale Leiter hinaufstiegen. Wir hatten ein Radio und abonnierten eine Zeitung. Vaters Zeitung war jiddisch, Mutter und Hendla lasen auch noch eine polnische. Meine Großväter auf beiden Seiten waren Hausierer gewesen, Männer, die stundenlang durch die Straßen zogen, immer hinter ihren Pferdekarren her, und häufig ohne jeden Erfolg. Einer starb an der Cholera, der andere ertrank in einer dunklen Nacht auf dem Heimweg von einem Bauernhof. Er nahm eine Abkürzung, verirrte sich und fiel in den Fluss. Er wurde dreiundfünfzig Jahre alt. Mein Vater war dann schon Schneider, hatte also einen respektablen Beruf, der uns einen Handwerkerstatus verlieh. Seine Werkstatt mit den Stoffballen, Garnspulen und riesigen schweren Scheren ist heute kaum noch zu erkennen. Sie befand sich auf der anderen Seite des gepflasterten Hofs in der Nummer 77. Er arbeitete sechs Tage die Woche, fertigte Anzüge, Jagdjacken und Röcke. Mein Onkel Moyshe in Szopienice mit seinen buschigen Augenbrauen und den funkelnden Augen hatte sich auf Uniformen für Beamte spezialisiert. Damals trug jeder in Polen eine Uniform – Postbeamte, Bahnbeamte, Polizeibeamte, Feuerwehrleute. Selbst Armeeangehörige und Offiziere kamen mit Bestellungen: Paradeuniformen oder ganze Ausstattungen für den Dienst in der stolzesten Armee Europas. Ihre Geschichte reichte schließlich bis zu Marschall Poniatowski und die Lanzenreiter an der Weichsel zurück.
Ich höre immer noch das Summen aus der Werkstatt meines Vaters. Mutter, Hendla und Nathan arbeiteten dort mit, und auch ich, wenn die Nachfrage groß war oder mein Vater zu einem Gespräch mit dem Rabbi gegangen war. Wir besaßen nur eine Nähmaschine, die andere mussten wir verkaufen, um die Kosten für das Sanatorium aufzubringen, in dem ich wegen meiner Lunge eine Weile gelegen hatte. Nathan hatte auch noch eine andere Arbeitsstelle, aber wann immer er konnte, ratterte er mit seinem schicken Fahrrad durch die Stadt und lieferte die Waren meines Vaters aus. Ich erinnere mich auch noch an die Wohnungen, in denen wir lebten, und an den Hof, in dem sich schon vor meiner Geburt eine kleine Gemeinschaft entwickelt hatte. Die Häuser hatten sogenannte französische Dächer, und unsere Wohnung verfügte über zwei geräumige Zimmer und eine Küche. Ich schlief mit Nathan zusammen in einem Bett, und unsere Eltern teilten ihr Bett mit den kleineren Jungen. In dem anderen Zimmer, genauer gesagt, der Küche, schliefen Hendla und Chana sowie meine Großmutter Ruchla-Lea. Nach heutigen Standards war es ziemlich eng, aber irgendwie bereitete es uns auch auf das vor, was später kam.
Wir hatten eine gewisse „Aufwärtsmobilität“, wie man es heute nennen würde, aber wir hätten uns nie leisten können, die Wohnung zu kaufen. Vater hatte sie von Herrn Rojecki gemietet, einem nicht jüdischen Polen, der im ersten Stock über dem Torbogen wohnte, der sich zum Hof öffnete. Dort lebte er mit seiner Frau und einem unverheirateten Bruder. Er hatte keine Kinder, aber zwei kleine Hunde. Ich weiß nicht, welche Rasse das war, aber sie schienen immer zu frieren, denn sie zitterten mit ihrem kurzen Fell in den harten polnischen Wintern.
Herr Rojecki war ein sehr großer, dicker Mann, jedenfalls in meinen Kinderaugen. Er war katholisch und Mitglied einer rechten politischen Gruppe in der Stadt, wie ich heute weiß. Trotzdem war er freundlich zu allen Juden und beschützte seine Mieter rund um den Hof energisch. Und er entfachte in Nathan und mir eine neue Leidenschaft: Auf dem Dachboden über seiner Wohnung befand sich ein Taubennest, und Rojecki gestattete uns, dort einen Taubenschlag zu bauen. Es war etwas Besonderes mit den Tauben – ihre Federn sind so weich, wenn man sie streichelt, und ihr sanftes Gurren klingt irgendwie tröstlich.
Im Erdgeschoss war ein Lebensmittelladen, erinnere ich mich, und Vater stellte in einem der Schaufenster seine Waren aus. Ein anderer Laden im Hof verkaufte Sackleinen, und gegenüber lagen die Räume des Pferdehändlers Piekowski. Manchmal verkaufte er Pferde an die Artillerieeinheit, die in der Stadt stationiert war. Er stellte auch Stahlseile für die Industrie her.
Heute würde man in Bezug auf unseren Hof wohl von einer blühenden Heimarbeit sprechen. Es ging dort sehr geschäftig zu, überall gab es Kohlenkeller und jede Menge Kinder. Alle außer Rojecki hatten Kinder, und ich spielte mit ihnen Murmeln und Fußball, wir sprangen in die Pfützen und schlitterten auf dem Eis. Drei oder vier Häuser weiter gab es eine Gastwirtschaft, in der Essen, Erbsen und Bohnen und auch Bier verkauft wurden. In dieser Gemeinschaft kannte jeder jeden. Wir hatten denselben Glauben und alle gleichermaßen zu kämpfen, um die schwierigen ökonomischen Bedingungen der Dreißigerjahre zu meistern. Armut lauerte überall. In der Gastwirtschaft wurde angeschrieben, und die Stammgäste bezahlten, wenn sie konnten. An Samstagen gingen sie allerdings nie dorthin.
Im Rückblick kann ich sagen, dass drei Faktoren meine Kindheit in Będzin bestimmten: Zum einen die Familie, die ich, wie alle anderen, für selbstverständlich hielt, bis es zu spät war, um ihre Bedeutung zu genießen. Dann die Religion, und der dritte war die Bildung.
Früher, vor meiner Zeit, gingen Religion und Bildung Hand in Hand. Neben der großen Synagoge stand die Akademie, das Lehrhaus, das 1859 gebaut worden war, damit die Frommen jeden Tag kommen konnten, um zu lernen und zu beten. Im jüdischen Glauben gibt es Gebete für jede Minute des Tages auf der Grundlage der Davidpsalmen. Wenn ich von der Schule kam, sagte mein Vater immer: „Setz dich, wir wollen zusammen beten.“ Zur Zeit meines Großvaters war Reb Abram Litwik der Vorsteher der Schneider gewesen. Er hatte für sie in der Akademie Psalmen rezitiert: „Selig, wer in deinem Hause leben darf …“ Er ging immer als Letzter.
Damals lernten alle Jungen ab einem Alter von vier Jahren in der heder, einer Art religiöser Grundschule, wo sie mit „dem Buch“ vertraut gemacht wurden, den Lehren des Talmud und der Thora. Alle Texte mussten auswendig gelernt werden, und wehe dem Jungen, der nicht gut lernte. Als ich so weit war, hatte sich das alles etwas entspannt, zum Teil, weil in den Dreißigerjahren weniger Juden in Będzin lebten, zum anderen wegen eines charismatischen Lehrers namens Yoshua Rapaport. Er kam aus Warschau und war einer der inspirierendsten Lehrer seiner Generation. Wir stellten damals unsere Lehrer nicht infrage. Das galt für alle Kinder, ob sie jüdisch waren oder nicht. Herrn Rapaport konnte ich eigentlich nicht leiden. Er war der Direktor meiner Schule und wirkte immer sehr hochmütig – ich fürchtete mich ein wenig vor ihm. Dummköpfe waren sicher nicht sein Fall, aber er eröffnete uns allen Möglichkeiten der Bildung. Da er selbst ein eifriger Sportler war, setzte er Ballspiele auf den Lehrplan. Und er gründete das erste Orchester unserer Stadt.
Meine Schule war in etwa das, was man heute eine staatliche Grundschule nennen würde. Morgens sangen wir, dann gab es stundenlang Unterricht in Fächern wie Geografie und Mathematik, Metallarbeit und Holzarbeit. Die Unterrichtssprache war Polnisch, unsere Lehrer waren Christen. Meine Lehrerin in der dritten Klasse, der letzten Klasse, die ich besuchte, hieß Katschinska. Wir trugen eine Schuluniform, dunkelblau mit einem grünen Streifen an den Hosenbeinen, und dazu kleine runde Mützen mit grünem Besatz. Die Lehrer inspizierten uns, da sie wie viele Generationen vor ihnen der Meinung waren, dass Reinlichkeit gleich nach der Göttlichkeit kam. Sie schauten nach unseren Ohren und Hälsen und sorgten dafür, dass unsere weißen Hemdkragen steif gestärkt waren. In der Schule trugen wir Hausschuhe, denn das Gebäude war neu und hatte eine Zentralheizung und blitzblank gebohnerte Böden. Auf solchen Böden konnte man nicht mit Straßenstiefeln herumlaufen. Mir gefiel am besten das Gärtnern. Das Fach hatte einen anderen, hochtrabenderen Namen, aber letzten Endes war es eben Gärtnern. Jede Klasse hatte ein eigenes Beet, und wir bauten um die Wette Blumen, Tomaten und Rettiche an. Ich mochte die Erde, die frische Luft, die Sonne. Tafeln und Kreide und Fragen und Antworten waren weniger mein Fall. Natürlich sollte die Schule echte Männer aus uns machen. Aber am Ende kam es dann doch so, dass eine ganz andere Institution das erledigte. Eine Institution, die sich Herr Rapaport und Fräulein Katschinska niemals hätten vorstellen können.
Mittags gingen wir alle nach Hause, ich also in den Hof Nummer 77. Manchmal nutzten wir die Gelegenheit für ein bisschen verbotenen Fußball in einer Gasse. Heute denke ich, das waren meine wichtigsten „Sozialkontakte“. Mein Vater achtete sehr auf meine Bildung und fragte mich ab, was ich gelernt hatte. Aber sei wahres Interesse galt dem Nachmittagsunterricht. Der wurde auf Hebräisch gehalten und umfasste religiöse Unterweisung, und er fand nicht in der Schule oder der Synagoge statt, sondern in Privathäusern. In jeder Klasse waren fünfundzwanzig Jungen, und der Lehrer und sein Gehilfe unterrichteten uns in den Geheimnissen unseres Glaubens. Vater fragte mich jeden Samstag ab, und wenn ich zögerte oder etwas nicht wusste, dann bekam ich seine Hand oder gar seinen Gürtel zu spüren.
Ich sehe meinen Vater noch vor mir – einen achtsamen, sehr genauen kleinen Mann mit ordentlich gestutztem Bart. Er spielte mit uns weder Fußball noch Murmeln, aber das heißt nicht, dass er kein guter Vater war. Denn er war ein guter Vater. Die Zeiten haben sich geändert. „Wer die Rute schont, verdirbt das Kind“, lautete eine Maxime seiner Generation überall in Europa. Und ich erinnere mich, dass ich staunend auf dem Boden saß, wenn er uns die Geschichten von Noah und der großen Flut erzählte, von Joshua und der Eroberung Jerichos und von der Geschichte eines stolzen Volkes, das Gott auserwählt hatte. Meine Mutter und Hendla halfen mir bei den Hausaufgaben, und die einzigen Bücher, an die ich mich bei uns zu Hause erinnere, hatten religiöse Inhalte.
Manchmal denke ich traurig, dass ich wohl einfach nur ein unartiger Junge war. Ich ging ins Kino – es gab drei Kinos in Będzin – und liebte Cowboyfilme und Tarzan mit Johnny Weissmüller, wie er sich mit lautem Schrei durch den Dschungel schwang. Das war so weit ganz in Ordnung und allgemein akzeptiert, aber es gingen auch Fensterscheiben zu Bruch, wenn wir Fußball spielten, oder wir klauten Obst aus dem Garten von Herrn Rojecki. Ich erinnere mich an eine Dame mit einem großen, ulkigen Hut. Wenn man ein kleiner Junge ist und es schneit, und da kommt eine Dame mit einem ulkigen Hut … na ja, sie wurde zur Zielscheibe für unsere Schneebälle. Heute tut es mir leid.
Ich hatte Schlittschuhe mit Stahlkufen, und manchmal jagten wir den Wagen (keine große Herausforderung) oder Straßenbahnen (das war lebensgefährlich, einer von uns büßte dabei einen Arm ein) nach. Mehr als einmal war die Polizei hinter uns her. Wer weiß, heutzutage würde man mir vielleicht eine offizielle Verwarnung aufbrummen.
Wenn ich erwischt wurde, bekam ich den Gürtel meines Vaters zu spüren. So war das eben. Meine Mutter griff manchmal ein, wie Mütter es nun mal tun, um die Schläge abzumildern. Sie hätte sie wohl auf sich genommen, wenn das möglich gewesen wäre. Wann immer es ein Problem – mit meinem Benehmen oder sonst – gab, zog mein Vater die Bibel zurate. Er hatte einen guten Ruf in unserer Gemeinde, Menschen in Schwierigkeiten wandten sich an ihn, und er redete stundenlang mit ihnen. Dabei saß er im Schneidersitz in seiner Werkstatt und nähte eifrig weiter. Wenn er selbst keine Antwort parat hatte, ging er zum Rabbi oder verbrachte einige Zeit im stibl, dem Gebetsraum.
Ich muss etwa elf Jahre alt gewesen sein, als Hendla uns eröffnete, dass sie nach Palästina auswandern wollte. Jahrhundertelang hatten sich die Juden in der Diaspora nach dem gelobten Land gesehnt, nach Kanaan, dem Land, in dem Milch und Honig flossen, wie uns die Bibel lehrt. Dieses Heimatland der Juden war Palästina, von Arabern bewohnt und von den Briten verwaltet, dem immer noch mächtigsten Empire der Welt. Junge Juden und Jüdinnen wollten dorthin auswandern und einen jüdischen Staat gründen, und wie in allen jüdischen Gemeinden gab es auch in Będzin Jugendklubs und Organisationen jeder politischen Couleur. Hendla hatte sich einer solchen Gruppe angeschlossen, die Gordonia hieß. Auch Nathan war dort Mitglied. Sie trugen blaue Schals mit einem besonderen Ring, sprachen über Palästina und lernten Hebräisch. Es hieß, man brauche ein Jahr Vorbereitung, bevor es losgehen konnte, und diese Zeit der Vorbereitung wurde Hachschara genannt. Die eigentliche Emigration, die Tausende Juden inzwischen nach Palästina geführt hatte, wurde Alijah genannt. Aber Landwirtschaft? In der Wüste? Meine Eltern waren nicht sehr begeistert, außerdem fürchteten sie wohl, Hendla würde zu viel Kontakt mit Nicht-Juden haben, nicht koscheres Essen zu sich nehmen und womöglich schwanger werden. Ich verstand ihre Bedenken nicht, schließlich hatte ich Hendla noch nie mit einem Jungen gesehen, vielleicht weil ich zu jung für den Jugendklub war. Und im Übrigen spielte Hendla nicht Fußball – oh Wunder! Wir waren einfach nicht auf derselben Wellenlänge. Hendla bekam nie die Chance, nach Palästina zu gehen, obwohl mein Vater immer wieder mit dem Rabbi darüber sprach.
So sah also meine Kindheit aus. Będzin hatte natürlich seine eigenen Probleme. Wenn man die Lokalzeitungen aus den Dreißigerjahren liest, spürt man die Spannungen: Streitigkeiten bei der Generalversammlung der Talmud Thora; Menschen, die sich gegenseitig als Schurken bezeichnen und mit Fäusten drohen. Sogar auf dem Gelände der Synagoge gab es Schlägereien. Ein Kommentar in der Zeitung lautet: „Wir brauchen Frieden in unserer Stadt.“
Aber ich war erst zwölf Jahre alt und wusste von alldem nichts. Für mich standen Fußball und der Schulgarten und der Geruch nach Pferdedung in Nummer 77 im Vordergrund, Herr Rojeckis zitternde kleine Hunde und das Gurren der Tauben. Und ich genoss die Zeit auf heiligem Boden, in Wodzisław Śląski, wo die Familie meiner Mutter lebte. Die Kiefern, den Fluss, das Brot, den Käse. Den Garten Eden.
Aber da gab es noch einen anderen, der eine Idee vom Garten Eden hatte. Ein bayerischer Ex-Gefreiter, der sich kurz nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland einer rechten Organisation angeschlossen hatte. Das einzige Problem bestand darin, dass er seinen Garten Eden in einem anderen Land errichten wollte.
In meinem Land.
2
Eine Welt wird auf den Kopf gestellt
Ich feiere meinen Geburtstag nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Genauer gesagt, seit dem 1. September 1939, denn an diesem Tag marschierten die Deutschen in Polen ein. Ich weiß nicht, ob ich an diesem Geburtstag noch Geschenke bekam, vermutlich schon. Es waren schwierige Zeiten, aber meine Mutter war daran gewöhnt, mit der Familienkasse zu jonglieren, und meine Eltern hätten mich nie enttäuscht. Es war ein Freitag, ein warmer Spätsommertag, und der Himmel über Będzin war wolkenlos. Die Schule hatte nach den Sommerferien noch nicht wieder begonnen, erst am Montag würde es so weit sein. Und so spielte ich mit meinen Freunden auf der Straße. Wer dabei war, weiß ich nicht mehr genau, aber vermutlich Yitzhak Wesleman, Jurel und die drei Gutsek-Jungen. Einer von uns hatte sicher einen Fußball dabei. Irgendeiner hatte immer einen Fußball dabei. Aber an diesem Tag war alles anders.
Es lag nicht daran, dass ich dreizehn Jahre alt geworden war, wir hatten noch keine Vorstellung davon, Teenager zu sein. Es hatte nichts mit uns zu tun, und doch waren wir darin gefangen. Etwas ging unten in den großen Kasernen vor sich, gleich beim Bahnhof. Leute eilten dorthin, rannten zu zweit oder zu dritt die Straße entlang, murmelten vor sich hin und machten ernste, erregte Gesichter. Wir folgten ihnen.
Ich habe immer gern Soldaten beobachtet, bevor Soldaten für mich auf einmal etwas ganz anderes bedeuteten. Unser Ortsregiment war die 23. Leichte Artillerie, die wie der größte Teil der polnischen Armee noch beritten war. Wir Jungen sahen bei den Paraden auf dem Hauptplatz zu, wenn die glänzenden Stiefel aufs Pflaster schlugen, betrachteten die kakifarbenen Uniformen mit den grünen Schulterklappen und den glänzenden Knöpfen und Abzeichen. Von Zeit zu Zeit verließen sie die Stadt, um Manöver durchzuführen. Dann zogen die Pferde die lackierten Kanonen, und die Räder ratterten über die Steine.
An diesem Tag jedoch war es anders. Nichts war auf Hochglanz poliert, und selbst ein Dreizehnjähriger erkannte die Verzweiflung und Panik. Allerdings sahen wir nicht viel, weil so viele Zuschauer gekommen waren. Wir fragten ein paar Erwachsene, was eigentlich los war, warum dieser Aufruhr? Wir hatten doch schon so oft zugesehen, wenn die Soldaten ins Manöver gezogen waren. Kriegsspiele. Das machten Soldaten eben. Ich erinnere mich bis heute an die Antworten. Ein Mann drehte sich zu uns um und schaute uns mit all der schrecklichen Erfahrung eines langen Lebens an. Er sagte uns, die Deutschen seien einmarschiert. Wir sahen uns verständnislos an. Er versuchte es noch einmal, sagte, jetzt sei Krieg. Keine Reaktion. Er zuckte mit den Schultern und gab es auf. Vermutlich murmelte er eine böse Bemerkung über die Jugend von heute, wie es so viele Generationen schon getan hatten.
Ich blieb wohl bis zum Vormittag dort und beobachtete das Kommen und Gehen, hörte dem Knarzen der ledernen Stiefel zu, dem Schnauben und Wiehern der Pferde, dem Rasseln von Stahl und den gebrüllten Kommandos. Kurz vor Mittag öffneten sich die riesigen Kasernentore, und das Regiment marschierte hinaus. Keine Kapelle, keine Fahnen. Ein paar Leute in der Zuschauermenge jubelten den Soldaten zu, klatschten und winkten. Die Soldaten jedoch sahen ernst und konzentriert aus und starrten nur geradeaus.
Wir beobachteten, wie die Letzten von ihnen um die Ecke am Hauptplatz gingen, dann kehrten wir zu unserem Fußballspiel zurück. Erst nach einer Weile nahmen wir das Geräusch wahr: ein dumpfes Grollen wie Donner in den fernen Karpaten. Aber es wurde lauter. Manchmal hörte man über unsere Rufe und das Geräusch unserer Stiefel, die den Lumpenball trafen, in der Ferne ein Knallen und Krachen. So etwas hatten wir noch nie gehört, keiner von uns. Aber jetzt wussten wir, dass der Krieg nach Będzin kam. Und nichts würde jemals wieder so sein wie früher.
Damals und noch lange danach wussten wir nicht, dass die Deutschen die polnische Grenze um fünf Uhr fünfundvierzig überschritten hatten, während das Morgengrauen wieder einen schönen Tag ankündigte. Eigentlich war der Einmarsch schon für den 25. August geplant gewesen, aber dann hatten sie ihn noch einmal aufgeschoben, um ganz sicher bereit zu sein. Außerdem mussten sie warten, bis „wir“ sie angriffen. Das war natürlich alles nur vorgeschoben. Am Vortag morgens um acht hatten polnische Truppen angeblich einen deutschen Radiosender in Gleiwitz angegriffen, gar nicht weit von Będzin entfernt. Jeder Pole wusste, dass das Unsinn war, aber die meisten Deutschen glaubten die Geschichte. Tatsächlich handelte es sich bei den angeblichen polnischen Angreifern um SS-Leute in gestohlenen Uniformen. Das ganze Fiasko war inszeniert worden, um den Polen die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Es gab keine Kriegserklärung. Nur zivilisierte Länder gaben Kriegserklärungen ab. Die Deutschen gaben dem Angriff den Codenamen „Fall Weiß“ und setzten dreiundfünfzig Divisionen gegen uns ein. Zu dieser Zeit hatten wir dreißig Infanteriedivisionen plus neun in Reserve, elf Kavalleriebrigaden und zwei motorisierte Brigaden, dazu ein paar kleinere Unterstützungseinheiten wie zum Beispiel die Pioniere. Die Armee von Krakau war am 23. März als Stützpfeiler der polnischen Verteidigung gegründet worden. Sie war unsere nächste übergeordnete Einheit und bestand aus fünf Divisionen, einer berittenen Brigade, einer Brigade Gebirgsjäger und einer Brigade Kavallerie. Kommandeur war Oberst Władysław Powierza, sein Vorgesetzter war General Antoni Szylling, der Divisionskommandeur.
An diesem Freitag, als alles begann, wusste ich nichts von alledem, aber bald redeten die Erwachsenen von nichts anderem mehr, und wir schnappten vieles auf. Armeen, Divisionen, Bataillone, Regimenter, Kavallerie, Artillerie – alles nur Wörter, die mir vollkommen unverständlich waren. Als der Nachmittag kam, traten wir immer noch gegen den Ball, aber jetzt hörten wir das Dröhnen von Propellerflugzeugen, die sich von Westen her näherten. Wir wussten, dass die polnische Luftwaffe einen guten Ruf genoss, aber wir hatten sie noch nie in Formation fliegen sehen. Es dauerte eine Weile, bis man seine Augen darauf eingestellt hatte und alles wahrnahm. Dann sahen wir die Welle tarnfarbener Bomber, deren Geschütze in der Sonne blitzten. Als sie die Burg erreichten, teilte sich die Formation, und einige Flugzeuge drehten ab, um verschiedene Teile der Stadt anzugreifen. Jetzt sahen wir die schwarzen Kreuze auf den hellblauen Unterseiten der Tragflächen. Viel später erfuhren wir, dass dies ein erstes Beispiel für die tödliche neue Taktik der Deutschen gewesen war: der „Blitzkrieg“ hatte begonnen. Zuerst kam der Luftschlag, dann das Gemetzel am Boden. Während die Maschinen über uns dröhnten, ahnten wir nicht, dass die Stadt Wieluń (Welun), etwa hundert Kilometer Luftlinie von uns entfernt, bereits bombardiert worden war. Drei Viertel der Häuser waren in Schutt und Asche gelegt, zwölfhundert Menschen waren tot, die meisten von ihnen Zivilisten.
Ich erinnere mich noch an das dumpfe Geräusch, als die ersten Bomben fielen. Sie trafen den Bahnhof mit dem Flachdach und der Jugendstilfassade, schlugen auf Zink und Kupfer und zerstörten die Kommunikationsmittel und die Lebensadern von Będzin. Es ist seltsam: Man hört nicht nur, wenn eine Bombe einschlägt, man spürt es. Die Druckwelle fühlte sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Wir spielten weiter, aber weniger selbstsicher als zuvor. Schwarzer Rauch hing über den Türmen der Burg. Die Flugzeuge verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Allmählich begriffen wir alle, dass etwas Schreckliches passiert war, und dachten an unsere Familien. Wir mussten jetzt wirklich nach Hause!
Ich rannte die Modrzejowska hinunter und durch Herrn Rojeckis Torbogen. Meine Mutter und Hendla bereiteten bereits das Sabbat-Essen für den Abend vor, aber von meinem Vater war keine Spur zu sehen. Ich wusste, er war in der Synagoge oder im stibl, gemeinsam mit den anderen Ältesten und dem Rabbi. Irgendwer musste doch wissen, was da vor sich ging, warum uns der totale Krieg überschwemmte. Ich plapperte auf die beiden Frauen ein, erzählte, was ich gesehen hatte, und übertrieb dabei vermutlich schamlos, wie es Dreizehnjährige so tun. Meine Mutter sagte nichts dazu, sie plauderte nur übers Essen und den Sabbat. Instinktiv wusste ich, dass mein Vater an diesem Freitagabend keinen Obdachlosen mitbringen würde, wie sonst so häufig. Vermutlich hatte er meiner Mutter verboten, mit uns über die Ereignisse des Tages zu sprechen. Jahre später erfuhr ich, dass Großbritannien und Frankreich bereits kurz davorstanden, Deutschland den Krieg zu erklären. Der britische Premierminister Neville Chamberlain hatte es im Radio bereits angekündigt. Die Briten evakuierten ihre Kinder vor dem „Blitzkrieg“ aus den Städten, wir erlebten ihn unmittelbar. Für uns war er nicht länger eine abstrakte Bedrohung.
Von unseren Fenstern, die auf den Hof hinausgingen und von denen aus wir Vaters Werkstatt sehen konnten, nahmen wir die Rauchsäulen wahr, die an diesem Abend den Sonnenuntergang verdunkelten. Wir rochen den Brandgeruch in der warmen Luft – nicht den süßen Duft von brennendem Holz, den wir aus dem Garten Eden kannten, sondern einen scharfen, stechenden Geruch, den wir nicht kannten. Wir versammelten uns wie immer um den Tisch, als meine Mutter die Kerzen anzündete, aber es lag keine Freude in unseren Augen. Die Gespräche wirkten gestelzt und angespannt. Nach dem Essen saßen wir da und hörten Vater zu, der aus der Bibel vorlas, diese vertrauten Worte, die ich mein ganzes Leben lang kannte. Aber an diesem Abend war es anders. Es gab keine Verheißung eines neuen Morgens, das weiß ich heute.
Samstag, der 2. September, war Sabbat. Ein warmer, sonniger Tag. Normalerweise hätten wir uns auf den Weg zur Synagoge gemacht, gemeinsam mit Freunden und Nachbarn, um Gott zu danken. Aber an diesem Tag gingen wir nicht. Und es würde noch zwölf Jahre dauern, bis ich wieder einen Fuß in eine Synagoge setzen sollte. Es gab auch keine Feste mehr. Alle Rituale des jüdischen Jahreskreises wurden abgeschafft oder unmöglich gemacht. Nathans Bar-Mizwa zwei Jahre zuvor war eine große Zeremonie gewesen. Meine wurde ein paar Wochen nach dem Einmarsch der Deutschen bei uns in der Küche begangen, ohne die Thora aus der Synagoge, ohne Rabbi oder Kaffee und Kuchen. An diesem Tag im September wurde ich sozusagen zum Mann. Am Tag zuvor hatte ich noch Fußball gespielt und Soldaten zugewinkt. Jetzt sah ich die Flüchtlinge, die vorbeizogen, traurige, obdachlose, gesichtslose Menschen, wie sie die nächsten sechs Jahre die Straßen Europas verstopfen würden. Es war wie der Exodus, von dem der Rabbi und mein Vater erzählt hatten, aber unter den Flüchtlingen waren auch Nicht-Juden, die gemeinsam mit den Juden ostwärts hasteten und versuchten, dem Vormarsch der Wehrmacht zu entkommen. Jede nur vorstellbare Art von Transportmitteln wurde benutzt. Die Wohlhabenden hatten Autos, die Geschäftsleute ihre Lastwagen. Andere schlugen auf ihre Pferde vor den Karren ein, Karren, auf denen sich ein ganzes Leben befand. Koffer, Taschen, Bettzeug und Matratzen, hier und da ein Vogelkäfig, ein Waschzuber. Noch herrschte keine Panik. Die Menschheit neigt ja zum Optimismus. Irgendetwas würde geschehen. Gott würde Hilfe senden. Aber sie blieben nicht lange in Będzin, die Stadt befand sich zu nahe an der Front, und es konnte gut sein, dass sie morgen schon mitten im Kampfgebiet lag.
Und dann die Gerüchte. Die nächsten sechs Jahre drehte sich mein Leben nur um Gerüchte. Die Deutschen bombardierten jede Stadt auf ihrem Weg und mähten die noch lebenden Zivilisten mit Maschinengewehren nieder. Ihre Stukas bombardierten die Flüchtlingsströme, die sich nach Osten bewegten. Aber keine Sorge, die polnische Armee drängte sie über die Grenze zurück. Alles würde gut.
Die Wahrheit, die an jenem 2. September niemand in Będzin kannte, sah so aus: General Reichenaus 10. Armee und General Lists 14. Armee bewegten sich auf Krakau zu und schlugen jeden Widerstand nieder. General von Rundstedts Truppen hatten bereits die Warthe überquert. Mit erheblichen Verlusten – vielleicht kam deshalb das Gerücht auf, die polnische Armee würde die Deutschen zurückdrängen –, aber unaufhörlich. Immer weiter Richtung Osten. Der Angriff vollzog sich so schnell, dass unsere Armee sich gar nicht versammeln konnte, und die Reservisten um Tarnów (Tarnow) konnten nicht schnell genug zum Einsatz gebracht werden.
Ich erinnere mich nicht, was ich an jenem Samstag oder am darauffolgenden Sonntag tat. Vermutlich spielte ich mit meinen Freunden und wir tauschten die Gerüchte aus, die wir an den Straßenecken und zu Hause gehört hatten. Nur bei uns zu Hause wurde kein Wort über den Krieg gesprochen. Einige Erwachsene klammerten sich an den Strohhalm der Unterstützung durch die Alliierten. Die Briten und Franzosen, so erklärte das polnische Radio, hatten Deutschland ein Ultimatum gestellt, sich entweder sofort aus Polen zurückzuziehen oder auf einen Zwei-Fronten-Krieg einzulassen. Das klang doch gut, sagten die Erwachsenen, nicht einmal ein Verrückter wie Adolf Hitler würde einen solchen Krieg riskieren.
Ich erinnere mich nicht, dass detaillierter über Politik gesprochen wurde, jedenfalls sprach mein Vater vor uns Kindern nicht darüber. Vielleicht wusste Hendla mehr, aber sie war ein Mädchen und verstand wohl auch nicht wirklich, was vor sich ging. So dachte ich zumindest.
Bis heute können Historiker nicht sagen, wie verrückt Adolf Hitler eigentlich war. Einige sprechen von seinem Narzissmus, seiner Arroganz, seinem obsessiven Rassismus und seinem zunehmenden Größenwahn. Der Zweite Weltkrieg, so sagen sie, war Hitlers Krieg, man muss sich nur diesen komischen kleinen bayerischen Gefreiten ansehen (der eigentlich aus Österreich kam), um die entsetzlichen Ereignisse der Vierzigerjahre zu erklären. Andere, zumeist aus einer anderen Generation, betrachten die äußeren Einflüsse genauer, sprechen von den Auswirkungen des verlorenen Ersten Weltkriegs, von der Weltwirtschaftskrise, die Deutschland besonders hart traf. Und sie sprechen von der Ungerechtigkeit des Versailler Friedensvertrags, der eine einst stolze Nation demütigte und ausplünderte.