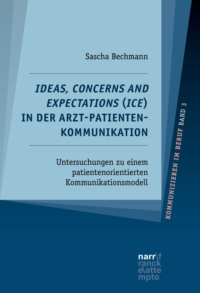Kitabı oku: «Ideas, Concerns and Expectations (ICE) in der Arzt-Patienten-Kommunikation», sayfa 2
1.1 Rahmenbedingungen – Paradigmenwechsel in der Arzt-Patient-Kommunikation
Mit der aktuellen Forderung nach einer aktiveren Patientenbeteiligung im Zusammenspiel zahlreicher Akteure bei der medizinischen Entscheidungsfindung werden hohe Ansprüche an die kommunikative Kompetenz von Ärztinnen und Ärzten erkennbar. Analysen ärztlichen Gesprächshandelns sind entsprechend darauf ausgerichtet, Defizite sichtbar und Kompetenzziele valide darstellbar zu machen. Ein wichtiges Ziel gesprächsanalytischer Untersuchungen zur Arzt-Patient-Kommunikation und ihrer Aufarbeitung durch Praktiker ist seit einigen Jahren bereits die Identifizierung spezifischer Kommunikationsmuster für z. T. divergierende oder sich ergänzende Beziehungsmodelle (Paternalismus, Dienstleistung, Kooperation). Aus den Befunden lassen sich sowohl Unterschiede zwischen der Förderung und Verhinderung von kommunikativen Aushandlungsprozessen erkennen als auch Lösungen entwickeln, mit denen Konzepte partnerschaftlicher Aushandlung praxisnah ausgestaltet werden können. Auch wenn im Prinzip der Anspruch besteht, durch valide Studienergebnisse kommunikative Kompetenzen nachvollziehbar und damit lehr- und sogar prüfbar zu machen, ist zunächst von einer Asymmetrie zwischen professionellem Wissen und Laienwissen auszugehen, die nicht leicht überwunden werden kann. Jedoch helfen die Ergebnisse aus der Forschung zur Arzt-Patient-Kommunikation dabei, diese Asymmetrie im Sinne einer gemeinsamen, qualifizierten Verantwortungsübernahme bei der Entscheidungsfindung zu überbrücken und damit bei aller Verschiedenheit (in den kommunikativen Voraussetzungen, Interessen und Zielen) so etwas wie partielle Gleichheit herzustellen.
Dazu ist es zwingend erforderlich, die in der Forschungstradition etablierte einseitige Betrachtung zugunsten einer, auch den Patienten und dessen Kommunikationsziele und -voraussetzungen berücksichtigenden, ganzheitlichen Auseinandersetzung um die Patientenperspektive zu erweitern. Auch wenn sich in der Realität das Beziehungsgefüge in der Interaktion zwischen Arzt und Patient auf äußerst vielfältige Weise und in der ganzen Breite weit über die Kommunikation im engeren Sinne hinaus entfaltet, lässt sich der unmittelbarste und methodisch erprobteste Zugriff auf das Phänomen „Arzt-Patient-Interaktion“ über das Gespräch als basales Element im gesamten Kommunikations- und Interaktionsprozess herstellen.
Im Gespräch kumulieren nicht nur medizinische, sondern auch über biomedizinische Faktoren hinausreichende Einflüsse, die ein gegenseitiges Verständnis und Verstehen erleichtern oder erschweren können. Nur auf Basis der Kenntnis und der Berücksichtigung solcher Einflüsse, die sich als sprachliche und außersprachliche Wissensbestände, Emotionen und individualstrategische Ziele beschreiben lassen, so die Annahme hinter der hier vorliegenden Untersuchung, ist eine effektive medizinische Behandlung im Sinne der Ganzheitlichkeit und darüber hinaus ihr nachhaltiger Erfolg möglich. Der Paradigmenwechsel, der mit dieser Betrachtungsweise verbunden ist, ist folgenreich: Standen und stehen traditionell und bisweilen gegenwärtig arztseitige Interessen und Vorstellungen im Zentrum kommunikativer Strategien und Bemühungen, so findet eine Abkehr von dieser arztzentrierten und auf Objektivierbarkeit hin ausgerichteten Kommunikationspraxis statt, indem patientenseitige Vorstellungen (ideas), Ängste (concerns) und Erwartungen (expectations) in den Prozess als zentrale (und zugleich gesprächsstrukturierende) Elemente integriert werden.1 Dieser Wechsel von der auf somatische Fakten begründeten und auf Krankheit ausgerichteten unidirektionalen Arzt-Patient-Kommunikation hin zu einer, die Gesamtheit des Patienten würdigenden, wechselseitigen Interaktion zwischen Arzt und Patient im Sinne eines (auch gesprächsinteraktional) partnerschaftlichen Austauschs, ist nachgerade als Ent-Ritualisierung in der ärztlichen Beziehungsgestaltung zu bezeichnen. Diese Veränderung, die nur durch einen Perspektivwechsel auf Seiten der professionell agierenden Akteure im Interaktionsprozess gelingen kann, entspricht zum einen den Forderungen der Patienten nach einer stärkeren Teilhabe an Ihrer Gesundheit (und zugleich dem gesellschaftlichen Trend nach stärkerer Individualisierung). Zum anderen ist sie – wie zahlreiche Studien, die den Grundstein für die nachfolgenden Überlegungen legen, zeigen – zwingen notwendig zur Sicherung wechselseitigen Verständnisses.
Verständnis ist der passende Schlüssel zum Erfolg im therapeutischen Gesamtprozess. Nur derjenige Patient ist wirklich in der Lage, sich aktiv in diesen Prozess einbringen zu können, der über die notwendigen handlungsleitenden Informationen verfügt.
Dabei steht außer Frage, dass es ein institutionell und situativ bedingtes Wissens- und Kompetenzgefälle zwischen Ärzten auf der einen und Patienten auf der anderen Seite gibt. Ziel gelingender Kommunikation ist beileibe nicht, dieses Gefälle umzukehren oder auszugleichen. Vielmehr muss es darum gehen, Patienten in der Zukunft mit dem nötigen Wissen auszustatten, welches sie dazu befähigt, die Anweisungen der Ärzte nachvollziehen zu können. Verständnis ist die Voraussetzung für Verhalten. Die Transparenz ärztlicher Entscheidungen versetzt Patienten in die Lage, ein Gefühl eigener Kompetenz im Gesamtprozess entwickeln zu können. Es geht nicht darum, den ärztlichen Wissensvorsprung zu verkleinern oder den Patienten durch eine Flut an Informationen an den Wissenshorizont der Ärzte anzugleichen. Nicht die Aufwertung der tatsächlichen (medizinischen) Kompetenz der Patienten führt zum Ziel, sondern der Prozess der Vermittlung eines Kompetenzgefühls. Nur dann, wenn Patienten das (subjektive) Gefühl entwickeln, im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv im Behandlungsprozess integriert zu sein, werden sie diese aktive Rolle mit gewünschten Handlungsweisen ausfüllen. In der bisherigen Betrachtung von Partizipations- und Beteiligungsstrukturen in der Arzt-Patient-Interaktion spielt weniger der Aspekt der gewünschten Verhaltensweisen auf der Grundlage eines starken Kompetenzgefühls eine Rolle, als vielmehr patientisches Fehlverhalten und die Gründe dafür. So sind paternalistische Beziehungsmodelle, die in den letzten Jahrzehnten handlungsleitend waren und zugleich die etablierten Kommunikationstechniken bestimmt haben (z.B. klassische Frage-Antwort-Sequenzen mit starker arztseitiger Themensetzung), darauf ausgerichtet, mangelnde Therapieeinsichten, die quasi per se den Patienten aufgrund ihrer Laienrolle unterstellt wurden, durch eine straffe Führung in die gewünschte Therapietreue umzuwandeln. Eine solche Bevormundung des Patienten, die wohlmeinend oder fürsorglich gemeint sein kann, führt jedoch – wie wir heute wissen – nicht dazu, dass Patienten sich ihren Fähigkeiten und ihren Bedürfnissen entsprechend in den Prozess einbringen. Wir müssen ganz im Gegenteil davon ausgehen, dass das, was man früher als Therapietreue (engl. Compliance) bezeichnet hat und was heute unter dem Label Adhärenz2 verstanden wird, eher erreicht werden kann, wenn man den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen misslungener Kommunikation und patientenseitigem Fehlverhalten betrachtet und dabei Kommunikation als dem Verhalten nicht nur temporal, sondern auch konditional vorgeschaltet erkennt. Auf diesen wichtigen Zusammenhang, der bislang kaum ausreichend diskutiert worden ist, weisen auch Koerfer und Albus hin:
So sehr das Ausmaß der Nicht-Adhärenz und ihre Folgelasten inzwischen gut untersucht sind, so wenig sind die Ursachen dieses ,Fehlverhaltens‘ bisher ausreichend geklärt. Dabei ist dieses Fehlverhalten nicht einseitig der bloßen „Unvernunft“ von Patienten zuzuschreiben, die es sicher auch geben mag, sondern vielmehr der Art der Beziehung zwischen Arzt und Patient selbst anzulasten, in der offenbar die Kommunikation vor, während oder nach einer medizinischen Entscheidung ,fehlerhaft’, ,missverständlich‘ oder ,dysfunktional’ verlaufen oder auch nur einfach ,zu kurz‘ gekommen ist.3
Die beiden Autoren setzen einen wertvollen Impuls für weitere Forschung zur Nicht-Adhärenz: Anstatt sich mit den Folgen von sogenannter Non-Adhärenz nach der ärztlichen Konsultation zu beschäftigen, ist es notwendig, sich den Gelingensbedingungen zuzuwenden, die im ärztlichen Gespräch ihre Wirkung entfalten.4 Störungen und Defizite in der dem Handeln der Patienten stets vorgeschalteten Kommunikation mit Ärzten führen in der Folge zu Defiziten im Handeln der Patienten. Insofern ist Kommunikation (und dabei das kommunikative Meta-Ziel Verständnis) als Forschungsgegenstand der Erforschung von (Non-)Adhärenz vorgelagert. So ist es wenig sinnvoll und nicht hinreichernd, sich mit den gravierenden individuellen Gesundheitsfolgen (Mortalitätsrisiken und Morbidität) oder den ebenfalls enormen ökonomischen Folgen von fehlender Adhärenz zu beschäftigen. Vielmehr muss die Erforschung der grundlegenden und ursächlichen Kommunikation in den Vordergrund rücken. Die zentrale Fragestellung eines solchen Forschungsbemühens muss lauten: Wie kann es gelingen, durch kommunikative Handlungen auf Seiten der Ärzte die gewünschten Handlungsweisen auf Seiten der Patienten zu bewirken und zugleich die patientenseitigen Perspektiven in diesen Kommunikationsprozess so zu integrieren, dass der Erfolg der beiderseitigen Bemühungen nachhaltig gesichert ist? Wie kann kommunikativ das notwendige Kompetenzgefühl vermittelt werden? Und was ist dazu notwendig, wechselseitig Verständnis herzustellen und zu sichern?
Dabei ist Verständnis deutlich mehr als Verstehen. Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten sind folgenreich für den gesamten Prozess medizinischer Intervention. Längst ist bekannt, dass Verstehen (im Sinne reiner Sprachverarbeitung als kognitive Leistung) außersprachlich eine enorme Wirkung entfaltet. Verstehen dient nicht allein der (sprachlichen) Verständigung, Verstehen ist als Eckpfeiler des Verständnisses handlungsauslösend und verhaltensändernd. Zudem ist Verstehen als Basis des Verständnisses auch sozial bedeutsam, denn Verständnis ist die Voraussetzung für das in der medizinischen Interaktion zwingend notwendige Vertrauen. Gerade in einem Prozess, der in entscheidender Weise von der Mitwirkung des Patienten abhängt, ist wechselseitiges Vertrauen wichtig: Vertrauen des Patienten in die Fähigkeiten des Arztes sowie umgekehrt das Vertrauen des Arztes in den Willen des Patienten, die professionellen Empfehlungen in konkrete Handlungsweisen zu überführen. Nur dann, wenn Patienten den Ratschlägen ihrer Behandler folgen, wird der Behandlungsprozess erfolgreich verlaufen. Gegen- und wechselseitiges Vertrauen ist aufgrund der Diskrepanz zwischen Laien- und Expertenwissen einerseits und des Umstandes, dass Schnittstellen zwischen diesen beiden Wissenssphären vorhanden sind, andererseits nicht nur wichtig, sondern kann als geradezu konstituierend für den medizinischen Gesamtprozess betrachtet werden.
Auf welche Weise im Kommunikationsprozess wechselseitig Verstehen und Verständnis gewährleistet werden können, wann und auf welche Weise die Patientenperspektive Eingang in das Gespräch finden soll, und was geschieht, wenn dies ausbleibt, das ist ein wichtiges Forschungsfeld der angewandten Linguistik und der Kommunikationswissenschaft und entsprechend auch Gegenstand dieser Untersuchung.
Ziel ist es, anhand des ICE-Modells (als Akronym für ideas, concerns & expectations) die Bedeutung des Gesprächs insgesamt aus einem neuen und bislang kaum gewählten Blickwinkel hervorzuheben und die Kommunikationsschwierigkeiten und -gefahren zwischen Arzt und Patient im Spannungsfeld von subjektiven und wissenschaftlichen Konzepten von Gesundheit und Krankheit aufzuzeigen.5
Dass es sich beim (auch und vor allem gesundheitspolitisch) postulierten „Jahrhundert des Patienten“ insgesamt um ein soziales Phänomen handelt, das sich in besonderer Weise in einer sich (zumindest in den sogenannten Informationsgesellschaften) verändernden kommunikativen Praxis zeigt, wird evident, wenn man einen Blick auf neuere Konzepte und sich daraus ergebende Strategien der Patient-Arzt-Kommunikation wirft. Der Forderung nach einer stärkeren Einbeziehung patientenseitiger Vorstellungen und Kompetenzen in alle Prozesse der gesundheitlichen Versorgung (nicht allein die Behandlung, sondern beispielsweise auch die Prophylaxe) entspricht eine, mit diesen Forderungen korrelierende, Veränderung in den kommunikativen Prozessen. Die (kommunikative) Berücksichtigung patientenseitiger Vorstellungen (ideas), Ängste (concerns) und Erwartungen (expectations) entspricht eben dieser Forderung nach Patientenautonomie in besonderer Weise.
Diese Erkenntnis, die alles andere als neu ist, gewinnt in Deutschland erst sehr langsam an praktischer Relevanz. Das liegt vor allem daran, dass Ärztinnen und Ärzte ihre Kommunikation an (gelernten) Techniken ausrichten, die eher gesprächssystematisch ausgerichtet sind und damit als im Kern (rein) prozessorientiert zu beschreiben sind. Daraus ergeben sich kommunikative Schwierigkeiten, denn in der ärztlichen Gesprächsführung gibt es im Idealfall keine Trennung zwischen Prozess und Inhalt, sondern eine Prozess-Inhalt-Korrelation. Es ist also kaum zielführend und wenig erfolgversprechend, durch Frage-Antwort-Abfolgen oder durch strukturelle Techniken, wie beispielsweise die WWSZ-Technik6, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient allein gestalten zu wollen. Ohne die Betrachtung und ohne die kommunikative Einbeziehung der zentralen Gesprächsinhalte, die sich arzt- und patientenseitig aus unterschiedlichen Bedürfnissen und Wissensbeständen speisen, kann Kommunikation kaum gelingen.
Das Wissen über die arztseitigen Bedürfnisse und Wissensbestände ist hinreichend untersucht und soll nicht im Zentrum der nachfolgenden Überlegungen stehen. Dass Ärzte vorrangig somatische Fakten benötigen, ist evident. Welche Bedürfnisse auf Seiten der Patienten bestehen und auf welche Weise diese Bedürfnisse mit Wissensbeständen verwoben sind, dazu ist in der deutschsprachigen Literatur zur Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten wenig zu finden. Die Forschung zur Patient-Arzt-Kommunikation lenkt seit den frühen 1980er Jahren den Fokus stark auf das kommunikative Verhalten von Ärztinnen und Ärzten. Diese eher einseitige Betrachtung, die sich auch terminologisch darin spiegelt, dass vorwiegend von einer Arzt-Patient-Kommunikation gesprochen wird, vernachlässigt die in zahlreichen Studien als bedeutsam erkannte Patientenperspektive. Indem man sich vorwiegend mit dem ärztlichen Frageverhalten beschäftigt (gesprächslinguistische Untersuchungen lenken häufig genau darauf den Blick), geraten die kommunikativen Bedürfnisse von Patienten ebenso aus dem Blickfeld, wie die kommunikativen Strategien, mit denen Patienten ihre Bedürfnisse kenntlich machen und versuchen, ihnen Raum im Gespräch zu verschaffen.
Dies ist umso erstaunlicher, als dass im angelsächsischen Raum bereits seit den 1960er Jahren Studien zu den patientenseitigen Bedürfnissen vorliegen. Während in Deutschland erst seit 2012 durch die Änderung der ärztlichen Approbationsordnung ein Bewusstsein für die Bedeutung kommunikativer Kompetenzen erkennbar wird, das sich in mehr oder weniger elaborierten curricularen Vorgaben ausdrückt, konnte bereits 1985 von Leventhal et al. gezeigt werden, dass die kommunikative Berücksichtigung patientenseitiger Vorstellungen, Ängste und Erwartungen ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg ist. Die Überführung des ICE-Modells in konkrete Handlungsempfehlungen für eine patientenorientierte Kommunikation ist in Deutschland noch nicht gelungen. Bislang lassen sich auch noch keine Versuche erkennen. Im Wesentlichen dürfte dies an der Unkenntnis dieses Modells liegen. Untersuchungen zu diesem Modell sind nachgerade als ein Desiderat zu betrachten. Insbesondere kann das Modell dadurch an Akzeptanz gewinnen, dass es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Im Zentrum der hier vorliegenden Untersuchungen stehen (neben einer kommunikationstheoretischen Hinführung) auch gesprächs- und kognitionslinguistische Dimensionen, die das Modell greifbar machen sollen. Dass eine linguistische Betrachtung fachfremder Kommunikationsmodelle überhaupt sinnvoll (und gewissermaßen erlaubt) ist, ergibt sich aus dem spezifischen Gegenstandsbereich: Die Wirkung von Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten entfaltet sich zwar im Kontext medizinischer Entscheidungen und sie ist im Kern medizinisch (wie jedes andere ärztliche Handeln auch), sie entfaltet sich aber eben ausschließlich im Gespräch. Daher steht es Linguisten nicht nur zu, sondern es gehört auch ihrem Selbstverständnis nach zu ihren Kernkompetenzen, die im Gespräch kumulierenden kommunikativen Rollen, Konzepte und Wirkungen nicht nur zu beschreiben (= Deskription), sondern auch unter normativen Gesichtspunkten zu betrachten. Ausgehend von allgemeinen Überlegungen zum Gespräch im medizinisch-institutionellen Rahmen soll im Folgenden ein Kommunikationsmodell auf breiter Forschungsbasis und im Kontext v.a. kognitionslinguistischer Erkenntnisse zu subjektiven Krankheitstheorien skizziert werden, das in der praktischen Anwendung seine Stärken zeigen kann.
In der vorliegenden Untersuchung wird das ICE-Modell auf der Folie kommunikationstheoretischer Überlegungen näher beleuchtet. Ziel ist es, dieses in Deutschland recht unbekannte Modell vorzustellen und einzuordnen, die wesentlichen kommunikativ-interaktionalen Vorzüge anhand von Studienergebnissen herauszuarbeiten und das Modell einzubinden in ein kommunikatives Gesamtkonzept.
Dazu wird das ICE-Modell w. u. in ein Phasenmodell ärztlicher Gesprächsführung (Calgary-Cambridge-Guides) integriert und mit konkreten kommunikativen Techniken verknüpft. Die Basis für diese Überlegungen bildet eine Betrachtung interaktionaler Besonderheiten der Arzt-Patient-Kommunikation, die im nächsten Kapitel folgen wird. Wesentlich für die Bewertung des ICE-Modells wird anschließend die Verknüpfung mit dem Modell der Krankheitsrepräsentation (Common-Sense Model of Illness-Representation) nach Leventhal7 sein, das gewissermaßen die (kognitionswissenschaftliche) Basis für das ICE-Modell bildet. Verwoben wird dieses mentale Repräsentationsmodell mit Überlegungen zu subjektiven Theorien. Auf dieser Folie werden linguistische Überlegungen zu sogenannten Frames den Blick auf das ICE-Modell weiten. Diese Überlegungen können dabei helfen, Missverständnisse zu erklären, die über die Aktualisierung falscher Frames (ich nenne das Phänomen weiter unten Falscher-Frame-Fehler (FFF)) entstehen können. Ein Exkurs in die Frame-Theorie mit weiterführenden Gedanken zur strukturellen Bestimmung von sprachlichem Wissen in Frames speziell im medizinischen Kontext wird auch unkundigen und fachfremden Lesern das nötige Verständnis ermöglichen.
In der Gesamtbetrachtung wird sich zeigen, dass die Exploration der Elemente des ICE-Modells mithilfe eines geeigneten Kommunikationsmodells maßgeblich zu einer Verbesserung der Patientenversorgung – v.a. über die Faktoren Patientenzufriedenheit und Adhärenz – beitragen kann.
1.2 Das ICE-Modell – Definition, Evidenz und Rahmenbedingungen
Während im deutschsprachigen Raum sowohl in der Lehre als auch in der Forschung in erster Linie konkrete Techniken der ärztlichen Gesprächsführung im Fokus stehen (beispielsweise die WWSZ-Technik oder das NURSE-Schema)1, werden seit den 1970er-Jahren vor allem in Nordamerika Modelle der Arzt-Patient-Interaktion diskutiert, die für das Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten von besonderer Bedeutung sind und die in gegenwärtigen gesundheitspolitischen Forderungen auch hierzulande berücksichtigt werden. Kern dieser Überlegungen bildet die Überzeugung, dass es einen Paradigmenwechsel in der Arzt-Patient-Beziehung gegeben hat, der das Ideal der Patientenorientierung und -zentrierung hervorhebt und eine Abkehr von traditionellen paternalistischen Rollenvorstellungen darstellt.2 In der Konsequenz bedeutet dieser Paradigmenwechsel die Einbeziehung der Patientensicht unter der Berücksichtigung der Patienteninteressen.3 Kommunikation gilt dann als gelungen, wenn diese Einbeziehung gelingt. Gelungene Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten kann nachweislich positive Auswirkungen auf den Behandlungserfolg und somit auf die Gesundheit des Patienten haben: „When the advice is ‚congruent‘ with their beliefs, people are more likely to adhere to medical treatment.“4 Fühlen sich Patienten wertgeschätzt und ernstgenommen, stärkt dies die Vertrauensbasis und führt zu einer Verbesserung der Adhärenz.
Das Modell des shared decision making (SDM) oder collaborative decision making5 (CDM) wird in Deutschland mit der Bezeichnung partizipative Entscheidungsfindung6 (PEF) übersetzt und sagt aus, dass ein tragfähiges Beziehungsmodell zwischen Ärzten und Patienten auf einem „wechselseitigen Prozess der Berücksichtigung medizinischer und zugleich psychologischer Erfordernisse basiert“7. Dieser Prozess ist untrennbar verwoben mit der Einsicht, dass einzig durch den wechselseitigen Austausch relevanter Informationen a) Verständnis hergestellt und b) Einverständnis erzielt werden kann:
Damit der Patient unmittelbar an der Verantwortung beteiligt ist (und nicht nur an der Entscheidung wie im Konsumentenmodell), bedarf es hier der Bereitschaft des Patienten, wichtige Informationen zu teilen, Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen mitzutragen.8
Das Teilen von Informationen, das Tragen von Konsequenzen und die Möglichkeit, Entscheidungen treffen zu können, korreliert m.E. mit den kognitiven Dimensionen Ideen (ideas), Befürchtungen (concerns) und Erwartungen (expectations), die als Grundlage für die Entwicklung des ICE-Modells zu werten sind.9