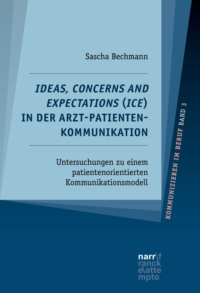Kitabı oku: «Ideas, Concerns and Expectations (ICE) in der Arzt-Patienten-Kommunikation», sayfa 3
1.2.1 Ideas
So ist die Informationsebene stets verbunden mit Vorstellungen und Ideen (ideas) über z.B. Krankheitsschwere, Krankheitsdauer oder Krankheitsursachen.1 Solche Laienvorstellungen, insbesondere über die Ätiologie von Krankheiten (verstanden als Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge), sind traditionell Gegenstand der medizinischen Psychologie sowie der Ethnomedizin.2 Der Ansatz dieser Forschungsrichtung ist stark geprägt von der Einsicht, dass das Wissen des Arztes über Laienvorstellungen entscheidend dazu beitragen kann, das Beziehungsgefüge zwischen Arzt und Patient positiv zu beeinflussen. Die Vorstellungen und Ideen der Patienten zu kennen ist notwendig, „um sie für eine positive Veränderung von Krankheitsverläufen im Sinne einer verbesserten ,compliance‘ durch den Patienten selbst fruchtbar zu machen“3. Somit stellen die Laienvorstellungen das Fundament dar, auf dem erfolgreiche Aufklärung und die weiteren Schritte auf dem Weg hin zu einer partizipativen Entscheidungsfindung überhaupt erst einen sicheren Stand finden. Verbunden damit ist die Tatsache, dass es sich bei den meisten Krankheiten
1 um sehr komplexe und abstrakte – und für Laien oft schwer zu fassende – medizinisch-pathologische Zusammenhänge handelt und
2 Ideen von der Pathogenese sowie von den Möglichkeiten der Heilung oft eingebunden sind in ein festes Werte- und Normengefüge, in welchem der Arzt aufgrund seiner Profession eine zentrale Rolle spielt.
Insbesondere Erwartungen (expectations) sind eng verwoben mit dieser Vorstellung von der Rolle des Arztes als Heiler (s.u.). Als Problem für die Arzt-Patient-Beziehung erweist sich mit Blick auf das (disparate) Wissen der Patienten über Krankheiten die Diskrepanz zwischen den Wissensbeständen der Patienten als Laien und dem Wissen der Ärzte als Experten. Hier gilt es, durch gezieltes Erfragen der ideas, eine Vorstellung davon zu bekommen, was Patienten wissen (bzw. glauben) und was nicht. In Zeiten von „Dr. Google“ ist dieses Wissen sehr unterschiedlich ausgeprägt und oft bruchstückhaft.
Die Erfragung von Vorstellungen und Ideen ist funktional bedeutsam: Die patientenseitigen Vorstellungen werden sehr häufig von ihnen selbst für Erklärungsversuche eingesetzt, was zu erheblich greifbareren und nachvollziehbareren Zusammenhängen beiträgt.
Dieser Aspekt könnte für die Arzt-Patient-Interaktion insgesamt förderlich sein:
Diese Art des Erklärens, die auf bruchstückhaftem Wissen und heterogenen Vorstellungen sowie auf Ableitungsregeln mit hinreichendem Allgemeingültigkeitsanspruch basiert, könnte man als ,Laientheoretisieren’ ansehen. Der Umgang der [Patienten] mit ihren eigenen Wissensbeständen innerhalb eines Institutionenkontextes hat einen prozeßhaften Charakter. Gerade der Einblick in diese Prozeßhaftigkeit […] könnte für die Beratungspraxis (insbesondere für die Informationsvermittlung und -bewertung) fruchtbar gemacht werden.4
Neben die medizinisch-psychologische Betrachtung treten gegenwärtig die kognitionswissenschaftlichen Disziplinen, die in neuerer Zeit Krankheitsmodelle auf der Basis von kollektiven und individuellen Wissensbeständen entwerfen. So ist etwa aus der Kognitionslinguistik bekannt, dass bereits Krankheitslabels (Krankheitsnamen) Vorstellungen über solche Parameter (verstanden als konkrete Vorstellungen oder Ideen) evozieren. Die sogenannte Frame-Theorie geht davon aus, dass in Begriffen Sprach- und Weltwissen gemeinsam angelegt sind und dass solche Begriffe abstrakte Vorstellungswelten auslösen.5 Die Idee von einer Krankheit wird auf diese Weise durch Welt- und Erfahrungswissen maßgeblich beeinflusst. Im Modell des CDM (dt. PEF) sind die Informationen über die eigenen Vorstellungen und das Wissen über die eigene Erkrankung tragende Säulen des wechselseitigen Aushandlungsprozesses, da dieser wesentlich auf dem Teilen und der Bereitstellung gemeinsam nutzbaren Wissens basiert. Es handelt sich nämlich um einen „Interaktionsprozess mit dem Ziel […], unter gleichberechtigter und aktiver Beteiligung von Patient und Arzt auf Basis geteilter Informationen zu einer gemeinsam verantworteten Übereinkunft zu gelangen“6. Ideas werden im ICE-Modell verstanden als „every opinion of the patient about a possible diagnosis, treatment, or prognosis“7.
1.2.2 Concerns
Auf der Ebene der Konsequenzen sind u.a. Befürchtungen (concerns) verortet. Hier wird die emotive Dimension der Arzt-Patient-Kommunikation erkennbar, die ebenfalls von Bedeutung für den w. o. genannten Aushandlungsprozess ist (an dessen Ende im Idealfall gegenseitiges Verständnis und Vertrauen steht). Levenstein et al. erkennen bereits 1986 insbesondere diese emotive Dimension des Patienten-Frameworks als zentral für den Prozess der Patientenzentrierung über den Weg der Zusammenführung von Arztperspektive und Patientenperspektive:
When a patient consults a physician, he has a certain agenda in mind. We have chosen to define this in terms of his expectations, feelings and fears. The doctor also has his agenda, which in general may be stated as the correct diagnosis of the patient’s complaints and the implementation of preventive procedures that are appropriate for the patient’s age, sex and risk factors. For individual patients he may have a more specific agenda based on previous knowledge of the patient and his family. In the patient-centred method, the physician’s aim is to ascertain the patient’s agenda and to reconcile this with his own.1
Matthys et al. beschreiben diese emotive Dimension sehr treffend als „the expressed fear/worry of the patient about a possible diagnosis or treatment“2.
Die gesprächsinteraktionale Berücksichtigung von Ängsten und Befürchtungen stellt eine Abkehr von der traditionellen schulmedizinischen Konzeption dar, in der allein die somatischen Komponenten von Bedeutung sind.3 Dabei bilden somatische Phänomene und psychische Prozesse eine untrennbare Einheit, die auch im Gespräch nicht aufgelöst werden darf: „Gegenstand des Arzt-Patienten-Gesprächs sind […] mehr oder weniger gravierende Beschwerden, Krankheiten und somatische Ausnahmezustände, und diese sind unweigerlich mit einem bestimmten, mehr oder weniger starken Erleben und entsprechenden Emotionen verbunden“4. Diese Festlegung gilt nicht nur für Erkrankungen, sondern auch für lebensverändernde Situationen, in denen Ärzte die Rolle des Aufklärers übernehmen. So kann auch die Mitteilung einer Schwangerschaft ohne medizinische Risiken bereits zahlreiche Ängste auslösen. An diesem Beispiel lässt sich die Komplexität psychischer Prozesse infolge eines somatischen Befunds gut zeigen, denn eine Schwangerschaft ist
die Einheit aus einer Gravidität und den Sorgen um die Entwicklung des Fetus, Unsicherheiten darüber, welche Veränderungen dies für das eigene zukünftige Leben bedeutet, Überlegungen, ob die Partnerschaft der neuen Situation gewachsen sein wird, und letztlich auch der Freude auf das Kind.5
Eine Asymmetrie der Informationsinteressen von Arzt und Patient lässt sich in diesem Beispiel, in dem krankheitsbezogene Parameter eigentlich keine Rolle spielen, sehr gut ablesen. Sie zeigt sich in prinzipiell allen Ereignissen, in denen somatische und psychische Komponenten verschmelzen. Für die Medizin kann angenommen werden, dass dies immer dann der Fall ist, wenn Ärzte Diagnosen stellen – seien es schwerwiegende Erkrankungen oder leichtere Verletzungen. Selbst ein gebrochenes Bein „ist so die Einheit aus der Fraktur von Tibia und Fibula und Befürchtungen, Sorgen etc. […]“6 über vielerlei Folgen (berufliche Einschränkung, Heilungsdauer und -qualität, Folgeschäden etc.). Insofern spielen Ängste und Befürchtungen, also die Erlebnissituation, in der modernen patientenzentrierten Kommunikation eine wesentliche Rolle: „Im Hinblick auf seine Beschwerden sind beim Patienten Angst, Sorge, Befürchtungen, Unsicherheit und eine Minderung des Selbstwertgefühls […] die wesentlichen Emotionen und Formen des Erlebens“7. In sachorientierten Gesprächen kommen diese psychischen Komponenten der Patientenperspektive kaum zur Sprache, sodass die Abkopplung von Erleben und Emotionen u.U. zu einer Verdrängung dieser Emotionen führt, die sich negativ auf das Befinden des Patienten auswirkt. Dies gilt gleichermaßen auch für die Beziehungsebene zwischen Arzt und Patient selbst: Jegliche Interaktion zwischen Ärzten und Patienten löst aufseiten des Patienten ein „spezifisches Erleben“8 aus, das im Idealfall Zufriedenheit und Beruhigung darstellt, in denjenigen Fällen aber, in denen concerns unausgesprochen bleiben, als Enttäuschung, Unzufriedenheit und Verärgerung manifest wird. Gesprächssituationen, in denen Patienten nicht zugleich mit ihren Beschwerden auch ihre Gefühle thematisieren können oder (in der traditionell sachorientierten Anamnese) dürfen, können „als [defizitär, S.B.] empfunden werden und dazu führen, dass der Patient von der Arzt-Patienten-Interaktion enttäuscht ist“9.
Gerade in der Einbindung der emotiven und psychosozialen Dimension in das Gespräch liegt ein wesentlicher Faktor, der für das Gelingen der Interaktion als Ganzes verantwortlich ist.
Nach Lalouschek (1993) erfordert diese Einbindung „neben der Erhebung der somatischen Anamnese die Erfassung des familiären und beruflichen Hintergrunds [der Patienten] sowie deren erlebensmäßig-emotionale Struktur“10. Gemeint ist dabei, die Befürchtungen und Ängste der Patienten (concerns) in den Prozess der Bewertung von patientenseitigen Aussagen einzubeziehen. In dieser Einbeziehung erkennt Lalouschek den Schlüssel zum Erfolg einer patientenzentrierten Kommunikation, die sich als prozesshaftes Erarbeiten eines gemeinsamen Krankheitskonzepts manifestiert:
Über die Herausarbeitung lebens- und krankheitsgeschichtlicher Zusammenhänge erfolgt die gemeinsame Erarbeitung eines Krankheitskonzepts. Dieses Vorgehen ist schließlich die Grundlage einer tragfähigen Arzt-Patient-Beziehung.11
Der Hinweis auf diesen Integrationsgedanken ist deswegen wichtig und notwendig, weil die Bearbeitung von Emotionen in der Vergangenheit nicht oder zumindest nicht häufig auch Teil der ärztlichen Verantwortung gewesen ist bzw. von den Ärzten als weniger wichtig bewertet wurde. Einen Hinweis auf dieses Problem, der sicher als Mahnung verstanden werden darf, formuliert Lalouschek 1993 auf der Basis ausgewerteter Patientengespräche wie folgt:
Wenn PatientInnen Erleben und Emotionen thematisieren, wird die affektive Dimension dieser Darstellung normalerweise nicht interaktiv manifestiert, sondern vom Arzt / von der Ärztin als Teil des ,somatischen Problems‘ behandelt oder als dysfunktional dethematisiert. Wenn es doch zur Manifestation von Emotionen kommt, wird im Normalfall die somatisch-technische Perspektive wieder etabliert. Bei den kommunikativen Mustern der Emotionsbearbeitung im herkömmlichen Arzt-Patient-Gespräch handelt es sich daher vorwiegend um die Regulation von Emotionen in Form von Glaubensbekundungen und nicht um interaktiv weiterführende Prozessierungsstrategien wie Fokussierung, Deutung, Eingehen oder Hinterfragen.12
Bis heute scheint dieses Grundproblem nicht gelöst zu sein. Die Regeln, nach denen Arzt-Patient-Gespräche ritualisiert, formalisiert und institutionell determiniert sind, scheinen sich nur langsam – und wesentlich durch die Kenntnis der patientenseitigen Dimensionen, die im ICE-Modell erst in neuerer Zeit in den Vordergrund treten (in ihrer Wichtigkeit für den Interaktionsprozess zahlreich belegt durch Studien, s. Kap. 3.1) – zu verändern. So stellt Fiehler noch im Jahr 2005 fest: „Arzt-Patienten-Gespräche sind eine besondere Form institutioneller Kommunikation. Sie dienen der Erfüllung bestimmter Zwecke, und für sie sind eigene Regeln herausgebildet worden, Regeln, die von denen der Alltagskommunikation abweichen“13. Diese funktional begründeten Abweichungen sind problematisch für die Arzt-Patient-Beziehung, weil sie sich v.a. in der Ausblendung von Emotionen manifestieren:
Eine der Abweichungen besteht darin, dass das Arzt-Patienten-Gespräch – im Rahmen einer somatisch-naturwissenschaftlichen Konzeption von Medizin – dem Anspruch nach ganz weitgehend sachorientiert auf die Behandlung von somatischen Beschwerden, Krankheiten und Ausnahmezuständen […] bezogen ist und dass das Erleben und die Emotionalität des Patienten wie auch des Arztes weitgehend ausgeklammert bleiben.14
In der neueren Forschung liegen zahlreiche Untersuchungen vor, die insbesondere auf den hohen Stellenwert der Berücksichtigung von Emotionen hinweisen und die belegen, dass Emotionen einen wichtigen Aspekt medizinischer Kommunikation insgesamt bilden.15 Diese Erkenntnisse scheinen sich bei den Ärzten selbst noch nicht ausreichend herumgesprochen zu haben. Zugleich weist Lindemann nämlich noch im Jahr 2015 darauf hin, dass Emotionen im Gespräch häufig nur als Randbemerkungen thematisiert, häufig nur implizit angedeutet und bisweilen sogar explizit als nicht relevant bezeichnet werden:16 „Emotionen zeichnen sich bei genauem Hinsehen vor allem durch ihren nur angedeuteten Charakter, ihre Verneinung oder ihre offensichtliche Problematik für den Gesprächsverlauf aus“17. Hier kommt es künftig (stärker als bisher) bei der Entwicklung von Kommunikationscurricula für die Lehre darauf an, diese emotive Dimension in Modelle ärztlicher Gesprächsführung zu integrieren und fest zu verankern.18
Modelle wie das ICE-Modell, das als patientenorientiertes Modell in der Arzt-Patient-Kommunikation vor allem die Erlebensdimension in das traditionell eher sachorientierte Problemlösungsgespräch integrieren will, helfen dabei, der somatischen Fragmentierung der Patienten entgegenzuwirken.
Dass hierbei besonders die Dimension der Ängste und Befürchtungen (concerns) stärker in den Blick genommen werden muss, liegt in der (untrennbaren) Einheit aus somatischen Phänomenen und psychischen Prozessen begründet, die eine Integration beider Dimensionen in das Gespräch fordert.
Zugleich ist es hilfreich, Gefühle zu prozessieren, bevor sie aufgetreten sind, diese also im Gesprächsverlauf zu antizipieren, wodurch sich Ängste kommunikativ beeinflussen bzw. regulieren lassen: „Eine […] Form des Umgangs mit Erleben und Emotionen besteht in der Prozessierung von Gefühlen, bevor sie aufgetreten sind: der Erlebnisprävention durch den Arzt“19. Diese Form von Gefühlsarbeit basiert auf der Kenntnis der Komponente concerns des ICE-Modells, was diesem Element eine zentrale Rolle im Interaktionsprozess zuweist.
Verglichen mit den beiden anderen Elementen ideas und expectations werden concerns seltener im Gespräch aktualisiert (sowohl von Patienten als auch von Ärzten), was in der traditionellen Sachorientierung dieser Gesprächsform sowie der Rollenasymmetrie zwischen Ärzten und Patienten begründet sein dürfte. Denn: Auch Patienten besitzen eine sehr genaue (gelernte) Vorstellung davon, welche Inhalte im Arzt-Patient-Gespräch üblich und relevant sind und vermeiden häufig die aktive Bezugnahme auf ihre Erlebnissituation. Lalouschek bezeichnet diesen Umstand als ,doppelte Fragmentierung‘20, weil Patienten zum einen die aus ihrer Sicht medizinisch relevanten Informationen aus ihrem komplexen Lebenszusammenhang herauslösen müssen, um diese Informationen sprachlich einzubringen, und weil sie zum anderen die Erlebnissituation, die sie für irrelevant halten, ausblenden müssen. Diese traditionelle Rollenvorstellung, die viele Patienten haben, führt dann zu einem Fragmentierungsproblem (somatische Fragmentierung), wenn Ärzte als die Gesprächsverantwortlichen nicht genau dies zu vermeiden wissen. Die Exploration der emotiven Komponente des ICE-Modells ist im Sinne der ganzheitlichen Betrachtung des Patienten als Menschen zwingend erforderlich.
1.2.3 Expectations
Für das patientenzentrierte Modell des CDM (dt. PEF) spielen auch Erwartungen (expectations) eine wichtige Rolle, weil Arzt und Patient auf der Folie gemeinsamen Wissens mögliche Behandlungsoptionen besprechen und gemeinsam Ziele festlegen sollen. Die Kenntnis der Vorstellungen des Patienten sind für die Planung des weiteren Vorgehens (i.d.R. zum Abschluss der Gesprächssituation) entscheidend. Wenn Patienten möglichst umfassend in den Behandlungsprozess involviert werden sollen, müssen Ärzte auch in Erfahrung bringen, welche Erwartungen (Präferenzen) patientenseitig vorhanden sind.
Konkret werden Patientenerwartungen im ICE-Modell aufgefasst als „the expressed or reported expectations about treatment, a diagnosis, or a certificate“1.
Matthys et al. beziehen mit dieser Definition den Aspekt der Erwartung nicht nur auf das Behandlungsergebnis (treatment), sondern auch auf die Diagnose und die institutionellen Rahmenbedingungen. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob die so weit gefasste Dimension expectations trennscharf von den beiden anderen Dimensionen unterschieden werden kann. Vorstellungen möglicher Diagnosen (ideas) sind m.E. per se geknüpft an die Erwartung der Diagnoseerhebung (expectations) als medizinische Leistung sowie an Befürchtungen (concerns), was das Ergebnis einer Diagnose betrifft (positiver vs. negativer Befund):
Was Patienten über Diagnosen und Behandlungen wissen (ideas; z.B. Identität, Machbarkeit und (Behandlungs-)Verfahren), ist untrennbar verwoben mit ihren Erwartungen (expectations) zu Diagnosen und Behandlungen und wirkt sich auf der emotiven Ebene unmittelbar auf ihre Ängste (concerns) aus. Dieses Wissen ist z. T. erfahrungsbasiert.
Das ICE-Modell, das diese drei Dimensionen ins Zentrum patientenorientierter Gesprächsführung stellt (indem nach diesen Dimensionen zu fragen ist)2, ist also nur holistisch zu verstehen. Damit stellt sich das Modell zunächst als ein kognitiver und emotiver Bezugsrahmen für das Arzt-Patient-Gespräch dar, dem allerdings in Deutschland – auch in der Forschung und der konkreten Umsetzung in der Lehre – bislang der Bezug zu interaktionalen Techniken und die Phasenorientierung (wann frage ich was und wie?) fehlt.
In Kapitel 4 soll dieses Desiderat in der Betrachtung der Calgary Cambridge Guides ein Stück weit aufgelöst werden.3 In Kapitel 3 wird zuvor ein systematischer Überblick über die Entwicklung des ICE-Modells und über Evidenzen zu dessen Wirksamkeit in der Arzt-Patient-Kommunikation gegeben, der den internationalen Forschungsstand kondensiert abbildet.4 Außerdem zeigen kognitionslinguistische Überlegungen, dass es sich beim ICE-Modell um das Abbild komplexer kognitiver Vorgänge handelt, die für die Organisation von Gesprächen maßgeblich sind.
Im nächsten Kapitel soll zunächst das große Ganze, also der kommunikative Rahmen für die Entfaltung des Modells, in den Blick genommen werden. Der Blick wird dabei vom Allgemeinen (Kommunikation) zum Speziellen (Arzt-Patient-Gespräche) geführt. Es wird sich zeigen, dass Arzt-Patient-Gespräche in besonderer Weise geordnet sind und mentalen Skripten folgen, die bislang die soeben skizzierten Dimensionen ideas, concerns und expectations noch kaum involvieren.
2 Arzt-Patient-Kommunikation – Grundbegriffe, Definitionen und Dimensionen
2.1 Kommunikation – eine (kurze) Begriffsbestimmung
Die Wirkung von Kommunikation im medizinisch-therapeutischen Bereich ist gut vergleichbar mit dem Bild einer Waagschale: Gelingende Kommunikation kann Krankheiten lindern, mangelhafte Kommunikation kann Krankheitsverläufe und das subjektive Krankheitsgefühl der Patienten negativ beeinflussen. Ein erfolgreiches Gespräch wird sich in vielen Fällen positiv auf die Gesundheit der Patienten auswirken. Mängel in der kommunikativen Interaktion führen in vielen Fällen zu Verschlechterungen des Gesundheitszustands.1
Diese Zusammenhänge basieren nicht allein auf den subjektiven Empfindungen von Patienten und Ärzten, es handelt sich nicht um introspektive Einschätzungen. Zahlreiche internationale Untersuchungen zeigen, dass Kommunikation ein wesentlicher Wirkungsfaktor in der medizinischen Therapie ist – und damit ein zentrales Instrument zur Qualitätssicherung.2 So hat sich beispielsweise gezeigt, dass eine einfühlsame Zuwendung und eine patientenzentrierte Kommunikation bei Patienten mit körperlichen Erkrankungen den Krankheitsverlauf signifikant verkürzen und die Quote der Nebenwirkungen von Medikamenten nachweislich senken können.3 Wenn Ärzte hingegen die Sorgen und Nöte ihrer Patienten nicht ausreichend berücksichtigen, ihr subjektives Krankheitserleben nicht hinterfragen und sich auf das Krankheitsmodell ihrer Patienten nicht einlassen, sinkt deren Lebensqualität bisweilen deutlich.4 Die Studien zeigen:
Ineffektive Arzt-Patient-Kommunikation führt zu unrealistischen Behandlungserwartungen, psychischer Komorbidität, psychosozialer Belastung, Behandlungsunzufriedenheit, geringerer Lebensqualität und zu einer ungünstigeren Krankheitsbewältigung.
Zudem können Mängel in der Kommunikation zu einer emotionalen Belastung mit langfristig negativen Folgen (Burnout) aufseiten der Ärzte führen.5
Im Sinne der Professionalisierung ärztlichen Handelns ist es notwendig, die „Spielregeln“ zwischenmenschlicher Kommunikation und Interaktion nicht nur zu kennen, sondern zielführend nach ihnen zu agieren. Das Befolgen bestimmter kommunikativer Regeln dient nicht nur der Sicherung des Behandlungserfolgs; auch der ökonomische Erfolg und eine langfristige Patientenbindung sind eng verwoben mit dem Gelingen kommunikativer Bemühungen. Anders als viele andere Berufsgruppen müssen Ärzte daher ihr Sprachhandeln (zu dem auch nonverbale Interaktionsformen zählen) bewusst wahrnehmen, reflektieren und situativ anpassen.
Die Kenntnis bestimmter Kommunikationstechniken hilft dabei, das verbale und nonverbale Handeln an die spezifischen Erfordernisse des Patientengesprächs anzupassen. Jedoch müssen Gesprächstechniken immer an kommunikative Bedürfnisse der Beteiligten rückgebunden werden. Aktives Zuhören beispielsweise ist als Gesprächstechnik dann sinnvoll, wenn der Zuhörende weiß, bei welchen Aussagen er genau hinhören muss. Auch das Stellen zielführender Fragen im Arzt-Patient-Gespräch kann nur gelingen, wenn Ärzte wissen, wonach sie fragen sollen.
Somatische Fakten sind oft geknüpft an subjektive Empfindungen, sodass das reine Abfragen von somatischen Informationen oft nur die halbe Wahrheit ans Licht bringt. Häufig kommt es durch die fachwissenschaftliche Fixierung an Objektivitätsidealen zu einer somatischen Fragmentierung der Patienten, weil Patienteninteressen oft nicht abgefragt und berücksichtigt werden.6 Im Sinne einer ganzheitlichen Beschwerdeerfassung ist die Patientensicht jedoch entscheidend. Dazu gehört zwingend das Wissen darüber, mit welchen Vorstellungen (ideas), Ängsten und Befürchtungen (concerns) und Erwartungen (expectations) Patienten ihren Ärzten gegenübertreten. Dieses Wissen ist der entscheidende Schlüssel, um beispielsweise Partizipationspräferenzen antizipieren zu können. Die Elemente ideas, concerns und expectations stehen im Zentrum des ICE-Modells, das als ein Beispiel für ein patientenzentriertes Kommunikationsmodell skizziert und bewertet werden soll.
Bevor die (v.a. institutionell bedingten) Besonderheiten der Arzt-Patient-Kommunikation näher betrachtet werden, soll im Folgenden zunächst einführend diskutiert werden, welcher allgemeingültige Kommunikationsbegriff am ehesten dazu geeignet ist, das komplexe Wechselspiel der zwischenmenschlichen sprachlichen und nichtsprachlichen Interaktionsabfolgen in Gesprächen im Allgemeinen zu bestimmen.
Unter dem Begriff Kommunikation versteht man dem Wortsinn nach (lat. communicatio) den wechselseitigen Austausch von Informationen mithilfe eines Mediums.7 Während Bienen beispielsweise über Duftstoffe miteinander in Kontakt treten, dienen in der menschlichen Kommunikation sprachliche und nichtsprachliche Zeichen (Wörter und Gesten) zur Verständigung. Auch in der Arzt-Patient-Kommunikation ist der Austausch von Informationen von Bedeutung, jedoch – und das gilt für menschliche Kommunikation insgesamt – erschöpft sich unsere kommunikative Kompetenz nicht in der Codierung und Decodierung von Informationen in einem Zeichensystem. Vielmehr folgt Kommunikation immer einem Zweck, sodass Kommunikationshandlungen immer als intentionale und finale Handlungen in einem sozialen Bezugsrahmen zu verstehen sind.
Der Aspekt der Intention ist für zwischenmenschliche Kommunikation elementar. Lehrbücher, die sich mit Kommunikation beschäftigen, verweisen häufig auf das von Watzlawick entworfene Axiom „Man kann nicht nicht kommunizieren“8. Dieses Axiom fußt auf der Annahme, dass sich a) Menschen stets verhalten, b) Kommunikation eine Form des Verhaltens ist und c) der Beobachtung, dass Verhalten kein Gegenteil hat. Aus eben dieser Beobachtung folgt der Schluss: Man kann sich nicht nicht verhalten. Dieser Schluss ist korrekt, jedoch kann man ihn nicht ohne Weiteres auf den Gegenstand Kommunikation übertragen. Durch die (falsche) Gleichsetzung von Verhalten und Kommunikation und die (korrekte) Auffassung, dass Verhalten kein Gegenteil hat, entsteht das vielzitierte Axiom, demzufolge man nicht nicht kommunizieren könnte. Jedoch ist dieser Analogieschluss problematisch. Wenn man Kommunikation nämlich als das Bemühen versteht, durch soziales Handeln Ziele zu erreichen (beispielsweise eine bestimmte Verhaltensweise bei seinem Gegenüber auszulösen), dann weitet man den Kommunikationsbegriff unangemessen weit aus, wenn man jedem Verhalten ein kommunikatives Potenzial zuweist. Zwar ist jedes kommunikative Handeln eine Form des Verhaltens, jedoch ist nicht jedes Verhalten Kommunikation. Richtig ist: Intentionale sprachliche Handlungen sind Verhaltensweisen und erlauben damit einen interpretativen Zugriff. Nicht-intentionale Verhaltensweisen besitzen hingegen kein kommunikatives Potenzial. Darauf weist auch Burkart hin:
Obwohl es zunächst einsichtig erscheint (und auch gar nicht in Abrede zu stellen ist), daß jedes Verhalten gewissermaßen ein ,kommunikatives Potenzial’ besitzt, d.h. Bedeutungen vermitteln kann, so hieße es dennoch den Begriffsrahmen überspannen […], wollte man jedes Verhalten mit Kommunikation gleichsetzen: wenn alles Verhalten Kommunikation ist, dann wäre ja z.B. auch das Betragen eines schlafenden Individuums bereits als ,Kommunikation‘ zu bezeichnen.9
In der kommunikativen Wirklichkeit spielen Bemühungen, Kommunikation willentlich abzubrechen oder sich kommunikativen Situationen bewusst zu entziehen, eine besondere Rolle. Zugleich beobachten wir Rituale der Kommunikationsaufnahme, die wir als Kommunikationsversuche beschreiben können. Solche Bemühungen sind intentionale Handlungen, die über reines Verhalten hinausgehen. Die Fähigkeit, durch unser Verhalten handeln zu können, also bewusste und finale Entscheidungen zu treffen und zugleich gewünschte Wirkungen zu erzielen, ist eine der grundlegenden menschlichen Eigenschaften. Der Begriff Kommunikationsfähigkeit involviert entsprechend einen Handlungsbegriff, der durch seinen intentionalen Charakter geprägt ist. Für die Untersuchung zwischenmenschlicher Kommunikation – und damit auch für die Modellierung von Kommunikationsprinzipien und -regeln beispielsweise im Kontext der Arzt-Patient-Interaktion – ist diese Sichtweise elementar, weil „menschliches Handeln nicht Selbstzweck (‚ich handle nicht, um des Handelns willen‘), sondern stets Mittel zum Zweck ist“10. Die Sprecherabsichten lassen sich erkennen, beschreiben und kategorisieren. Zugleich können wir erkennen, wann und wodurch Ziele erreicht bzw. nicht erreicht werden, wenn wir Korpusdaten mit dieser Fokussierung betrachten. Wenn wir kommunikatives Handeln als soziales Handeln ansehen, können wir sozial bestimmte Abläufe rekonstruieren und zugleich Basisregeln der Kommunikation identifizieren. Dabei handelt es sich um Idealisierungen, die Menschen in ihrer Verständigungspraxis vornehmen. Die Austauschbarkeit von Standpunkten sowie die Kongruenz der Relevanzsysteme gehören ebenso dazu wie zahlreiche Interpretationsverfahren oder Verstehensmethoden, die wir auf der Folie von Basisregeln anwenden. Insbesondere im Prozess des Aushandelns von Status und Rolle spielen normative Regeln des Kommunizierens eine zentrale Rolle. Im Wesentlichen sind dies (nach Cicourel):11
Reziprozität / Gegenseitigkeit der Perspektiven, d.h. die Unterstellung einer für alle gleichermaßen verbindlichen Sichtweise,
die Unterstellung von Normalität bzw. Rationalität des Handelns und
das et-cetera-Prinzip, also die Annahme eines unausgesprochenen Konsenses zwischen den Gesprächsbeteiligten, so dass abweichend erscheinendes Verhalten stillschweigend ergänzt wird, bzw. erwartet wird, dass diese Diskrepanzen durch später nachgelieferte oder nachlieferbare Informationen in ihrer Normalität erkennbar würden.
Wenn man Kommunikation als gerichtetes soziales Verhalten begreift, dann sind jegliche kommunikative Bemühungen stets auf einen anderen Menschen hin ausgerichtet (Dialog) – und sie können gelingen oder scheitern.
Unter dem Aspekt der Dialogizität, die für Kommunikation schon dem Wortsinne nach bestimmend ist,12 verbirgt sich die Vorstellung von einem dualen System, in dem Kommunikationspartner ihre Interessen wechselseitig einbringen. Kommunikation erfordert (neben den rein technischen Einheiten Sprecher und Hörer) die Fähigkeit zur Interpretation. Das bekannte, aus der Informationswissenschaft stammende, Sender-Empfänger-Modell von Shannon und Weaver taugt aus diesem Grund zur Bestimmung dessen, was Kommunikation im engeren Sinn bedeutet, wenig. Dieses Modell geht (grob gesagt) davon aus, dass Menschen über den Weg der Informationsverschlüsselung (in Sprache) Informationen austauschen.
Dieser Vorgang ist gut vergleichbar mit dem Versenden eines Pakets. Dabei werden Gegenstände, z.B. ein Buch, ein Pullover und ein Paar Socken in einen Karton gelegt, der Karton wird verschlossen und über einen Versanddienstleister auf die Reise geschickt. Wenn das Paket nach ein paar Tagen bei seinem Empfänger angekommen ist – und wenn es auf dem Weg dorthin nicht beschädigt wurde –, findet der Empfänger ganz genau das darin vor, was der Absender zuvor hineingegeben hat. Die Übermittlung der verpackten Waren ist verlustfrei geglückt. Bezogen auf Kommunikation würde dieser Prozess wie folgt ablaufen: Der Sender einer Botschaft verpackt gewissermaßen seine Informationen in Sprache, sendet diese verpackte Information und der Empfänger dieser sprachlich kodierten Nachricht entschlüsselt die Information und wertet sie aus.13