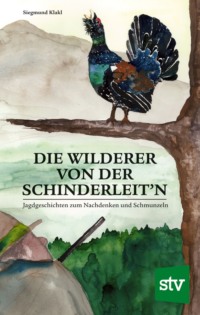Kitabı oku: «Die Wilderer von der Schinderleit'n», sayfa 2
Keiner der Jäger wollte die Geschichte mit dem Kopfschuss glauben, alle lachten sie über diese maßlose Aufschneiderei, und jeder einzelne suchte den Wildkörper nach einem Einschuss ab. Doch es war tatsächlich keiner zu finden. Allesamt blieben ein wenig ratlos, sie sahen den Schuss am Haupt des Kapitalen mit ihren eigenen Augen, aber glauben wollte es dennoch keiner so richtig.
Am Abend gab es dann in der Gaststube noch geröstete Hirschleber mit Kartoffeln und weiterhin zu trinken, was hineinpasste in die durstigen Kehlen. Es wurde wahrlich ein feuchtfröhliches Fest, und Hartmut schwebte auf Wolken, betrunken und glückselig lallte er jedem einzelnen seine Geschichte vom Jagderlebnis vor – dass sich der Jäger Sepp außergewöhnlich heftig um seine Frau Brigitte kümmerte, berührte ihn nur am Rande. Am Ende des Gelages gingen Hartmut und Brigitte Hand in Hand hinauf in ihr Zimmerchen und beide trugen, wenn auch aus recht unterschiedlichen Gründen, ein Leuchten in ihren Augen, das sie in Berlin niemals voneinander zu sehen bekamen.
Und der Jäger Sepp schnalzte mit der Zunge und barg ein weiteres süßes Geheimnis hinter seinen feurig funkelnden Augen.

Der Bock vom Unterland
In meinem herrlichen Bergrevier, das ich damals in Pacht hatte, gab es ein kleines Problem, wirklich ein kleines, sozusagen ein „Luxus-Problem“. Denn während ich dort mit freudvollen Erfolgen – im bescheidenen Rahmen natürlich – auf Rotwild und Gams, Birkhahn und Murmel und sogar auf den großen Hahn jagen konnte, war der Rehwildbestand lausig. Vom Sepp, meinem guten Freund und Besitzer dieser Eigenjagd, wusste ich, dass mein Vorgänger als Pächter darauf gar keinen Wert gelegt und auf die Rehwildhege vollkommen verzichtet hatte. Ich erhielt dann zwar die Erlaubnis, eine sorgsam eingezäunte Rehfütterung zu errichten, doch um den Bestand nachhaltig zu verbessern, musste man sich schon einige Jahre gedulden. Und mein Jägerherz, das sich so sehr danach sehnte, einmal einen richtig guten Bock zu erlegen, wurde auf eine harte Geduldsprobe gestellt.
Doch wie so oft im Leben, wenn eine Tür klemmt, dann geht zuweilen eine andere auf. Und Jägerstammtische gibt es ja auch nicht ganz umsonst. Von so einem Stammtisch kannte ich den Fritz, einen sogenannten „Landler-Bauern“ (wir nannten sie so, weil sie ihre Höfe unten „am Land“ hatten, meist viel größer und viel leichter zu bearbeiten als die Bergbauernhöfe bei uns heroben). Fritz hatte seine Eigenjagd da unten, mit prächtigen, ebenen Wiesen und Äckern, dafür aber nur mit einem kleinen Waldanteil. Er hatte auch keine Alm, denn die Berge, die es dort gab, waren weit niedriger und über ihre Rücken hinweg bewaldet. Und so gab es in seinem Revier natürlich keine Gämsen!
Der eine möchte also für sein Leben gern einmal eine Gams schießen, der andere sehnt sich danach, einmal auf einen guten Rehbock zu gehen. Was tut also St. Hubertus? Er führt die beiden zusammen und lässt sie einen Handel abschließen. „I lod di ein auf an guaten Rehbock ba mir im Revier, dafür derf i im Spotherbst ba dir a Gams schieaßn, wos sogst dazua?“, meinte Fritz eines Tages bei einem sonntäglichen Frühschoppen beim Pfandlwirt. Dagegen war nun wirklich nichts zu sagen, eine wunderbare Idee, wir gaben uns die Hand drauf, und der Austausch war zu beider Zufriedenheit besiegelt.
Ende Juli rief mich Fritz an, er hätte bereits einen sehr guten Bock bestätigt, die Brunft wäre schon in vollem Gange und ich könnte jederzeit kommen. Wir vereinbarten für den kommenden Freitag den Abendansitz. Ich teilte es mir so ein, dass ich auch Samstag und Sonntag noch als Jagdtage zur Verfügung hatte, für alle Fälle.
„Eine knappe Autostunde trennt mich noch von meinem kapitalen Rehbock“, dachte ich, als ich meine Jagdsachen sorgfältig in den Kofferraum packte. Ich sollte so gegen 17 Uhr am Hof von Fritz gestellt sein. Ich war pünktlich, Fritz hatte noch einige Dinge zu erledigen, wie das auf einem Bauernhof eben so ist, doch gegen 18 Uhr brachen wir auf.
Die Sonne stand noch hoch und drückte uns ihre brütende Hitze unbarmherzig ins Gesicht. Wir pirschten einen von Birken und Pappeln gesäumten Wiesenweg leicht bergan, erreichten einen Waldstreifen, durch den ein gerade noch erkennbarer Jägersteig führte, und kamen leicht verschwitzt zu einem Hochsitz am Rande einer geradezu märchenhaften Wiese, eingesäumt von dichtem und saftigem Mischwald, nur gegen Süden hin leicht geöffnet hinaus auf die wogenden Getreidefelder. „Vor drei Tog hot da Bock do a Gaoß über die gaunze Wiesn triebn“, raunte mir mein Pirschführer zu, wir setzten uns auf den etwas wackligen Hochsitz und harrten der Dinge, die da kommen würden.
Fast zwei Stunden lang wurden wir von Mücken und Gelsen umschwirrt, man konnte also nicht sagen, dass wir keinen Anblick gehabt hätten, aber jagdbares Wild war nicht zu sehen. Dann trat am südlichen Wieseneck doch noch eine Geiß mit einem starken Kitz aus, die beiden genossen sichtlich die würzigen Leckerbissen der üppigen Wiese, Bock war aber keiner zu sehen. Beim Abbaumen meinte Fritz, dass so etwas natürlich schon vorkommen könnte. Er zeigte mir noch einen Pirschsteig, der in nordwestliche Richtung weiterführte zu einer anderen, kleineren Blöße, wo sich der Bock auch herumtreiben könnte, dort müsste man vielleicht auch einmal Nachschau halten.
Zu Hause angekommen, musste ich natürlich noch mit hinein in die Stube auf einen Schnaps und ein Bier, ich lernte seine fesche und resche Bäuerin Cilli kennen, und wir plauderten ein Weilchen. Fritz eröffnete mir schließlich, dass ich ab sofort alleine auf Ansitz gehen könne, ich wisse ja jetzt schon Bescheid. Auf die Wiese und den kleinen Schlag dahinter solle ich mich konzentrieren und natürlich auf den starken Bock, den er mir noch einmal beschrieb, so gut er konnte. An der linken Stange hätte er ein zusätzliches Ende nach hinten, das mache ihn unverwechselbar. Er selbst hätte gerade jetzt sehr viel Arbeit am Hof und am Feld, das möge ich verstehen. Freilich verstand ich das, und ich freute mich über das Vertrauen, das er mir damit entgegenbrachte. Ich kündigte an, schon am nächsten Morgen wieder hinauszugehen und verabschiedete mich nach einem gemütlichen Plauderstündchen frohgelaunt.
Es war bereits nach Mitternacht, als ich nach Hause kam, meine liebe Ehefrau war noch wach, sie hatte schon befürchtet, mich abholen zu müssen, weil ich beim Bock-Feiern versackt war. Nein, aber im Sommer ist der Tag halt so lang, man sitzt fast bis halb zehn am Hochsitz, und bis dann alles besprochen ist und die lange Heimfahrt …
Um halb 4 Uhr rasselte der Wecker, um halb 5 Uhr saß ich wieder auf dem Hochsitz. Unten am offenen Teil der Wiese meinte ich im diffusen Grau der langsam zurückweichenden Nacht die Umrisse von zwei oder drei Rehen zu erkennen, doch sie entschwanden, bevor mir das Licht des heraufdämmernden Tages erlaubt hätte, sie anzusprechen. Etwas später stand dann im rechten Eck der Wiese auf einmal ein junger Bock, suchte ein wenig nervös herum und drückte sich bald wieder ins Holz.
Die Sonne hob sich hinter meinem Rücken in den stahlblauen Himmel, ein prachtvoller Tag zog herauf, nur die Wiese vor mir blieb leer. Also pirschte ich bedächtig zurück, sah im großen Feld hinter dem Bauernhof weit entfernt noch drei Rehe, dann setzte ich mich ins Auto und rauschte nach Hause. Am Abend wollte ich etwas früher hinaus und nahm mir vor, auch meinen Rehfiep mitzunehmen (damit war ich damals allerdings noch sehr ungeübt).
Es war wirklich ein sehr heißer Tag, die Luft flimmerte noch, als ich es mir wieder gemütlich machte „im vorderen Winkel“, wie Fritz diesen Revierteil nannte. Und es dauerte tatsächlich nicht lange, ich drohte gerade ein wenig einzudösen, da stürmte eine Geiß daher, getrieben von einem Bock, den ich rasch als den bereits gestern gesehenen ansprechen konnte. Die beiden jagten über die Wiese, dass es eine Freude war, einmal fingen sie sich auch tatsächlich in einem Art „Hexenring“, doch so schnell wie sie gekommen waren, verließen sie die Bühne auch wieder. Ich war sicher, dass sich der Dreijährige darüber im Klaren war, dass er sich auf gefährlichem Terrain bewegte, nämlich im Einstandsgebiet eines viel stärkeren Bockes. Aber der zeigte sich nicht. Ich fiepte ein paarmal ein wenig zaghaft, die gewünschte Wirkung blieb aus. Ein malerischer Sonnenuntergang half mir über die erste leichte Enttäuschung hinweg.
Sonntag früh setzte ich mich wieder auf den Hochsitz, wieder sah ich den jungen Bock, diesmal ganz unten an der Wiesenöffnung, wie er seine Geiß ins Getreidefeld trieb. Kurz meinte ich, einen zweiten Bock gesehen zu haben, zum Ansprechen reichte es aber nicht.
Am Abend erinnerte ich mich an den Steig, den mir Fritz bei unserem ersten Ansitz gewiesen hatte, und pirschte ihn mit äußerster Vorsicht entlang, bis ich den kleinen Kahlschlag erreicht hatte, den der Fritz „hinterer Winkel“ nannte. Die Himbeerstauden waren gerade dabei, von der kleinen freien Fläche Besitz zu ergreifen, für einen Hochsitz hatte Fritz wohl noch keine Zeit gehabt. Ich kauerte mich an einen alten Wurzelkörper und konnte den Schlag ganz gut überblicken, also beschloss ich, sitzen zu bleiben. Vielleicht hatte der Bock seinen Einstand ja tatsächlich bis hierher ausgeweitet.
Nach einigen Minuten versuchte ich es mit dem Lockruf der Geiß. Nichts! Doch kurz bevor das Büchsenlicht zu schwinden drohte, stakste tatsächlich ein Reh aus dem Altholz. Es war ein Bock! Sehr starker Körperbau, aber doch irgendwie jugendlich, das Krickel massig und stark vereckt, aber kaum über Lauscher hoch. Das war nicht der Bock, den mir Fritz beschrieben hatte, das war ein junger, gut veranlagter, dem man jedenfalls noch ein paar Jahre geben sollte. Ich schaute ihm eine Zeit lang zu, wie er sich ein paar Blätter von den frischen, saftigen Stauden zupfte und schließlich verschwand, wie er gekommen war.
Als ich um die Stadlecke des stattlichen Bauernhofes einbog, stand der Fritz vor der Haustüre und rief mir von weitem schon ungläubig zu: „Wos is lous, wou is da Rehbock?“ Ich erzählte ihm wahrheitsgetreu, wie es mir ergangen war, und Fritz schüttelte ungläubig den Kopf. „Aber der Bock is do, deis is gaunz sicher, do muasst hiaz draubleibn, du kaust jederzeit ausigeih, wias’d holt Zeit host!“ Er zog mich mit hinein in die Stube, wo Cilli bereits eine zünftige Jause für mich aufgetischt hatte. „Mia hätt ma uns schou denkt, dass du heit mit’n Bock hoamkimmst“, grinste mich die Bäuerin an und stellte mir auch noch ein Bier auf den Tisch.
Nun hatte ich leider neben der Bockjagd auch noch etwas anderes zu tun und musste die nächsten Tage aussetzen. Am Mittwoch zum Abendansitz war ich aber wieder zur Stelle, eine kurze Besprechung mit Fritz ergab keine neuen Erkenntnisse, also setzte ich mich wieder auf den Hochsitz im „vorderen Winkel“. Das Wetter hatte umgeschlagen, der Himmel war bedeckt, und es war erheblich kühler, doch der Wind stand gut. Nur der Bock kam nicht. Auch am darauffolgenden Morgen saß ich drei Stunden vergebens auf dem Hochsitz. Ich muss gestehen, dass mich bereits die ersten Zweifel beschlichen, doch am Abend kam die Wende. Ich wagte ein paar zaghafte Fieplaute, und nach ein paar Minuten stand er da! Tatsächlich ein kapitaler Bock, so wie Fritz ihn mir beschrieben hatte, mit dem auffälligen, zusätzlichen Ende auf der linken Stange. Zur gleichen Zeit erschien allerdings von mir unbemerkt in der anderen Ecke der Bühne eine Geiß, und da war es um den Bock natürlich geschehen. In hohen Fluchten jagte er über die ganze Wiese, erreichte seine Angebetete und verschwand mit ihr im Unterholz, so schnell konnte ich gar nicht schauen.
Ich wartete bis zum allerletzten Büchsenlicht, doch sie kamen nicht mehr zurück. In der Bauernstube beim Fritz und bei der Cilli erzählte ich freudestrahlend von meinem Anblick und Fritz schmunzelte vor sich hin: „Na jo, auf an guaten Bock muass ma schou a poarmol geihn, sunst hot man neit vadient, deis is a oide Haubn.“ Ich nahm das zur Kenntnis, fuhr nach Hause und plante auch das kommende Wochenende jagdlich.
Am Freitagabend erschien im unteren Wieseneck gegen das Getreidefeld hin wieder der Dreijährige. Am Samstag blieb ich den ganzen Tag unten im „Unterland“, streifte auch über Mittag durchs Revier, fiepte da und dort, bekam noch einen weiteren jungen Bock in Anblick, der ebenfalls mit einer Geiß beschäftigt war. Am Sonntag in der Früh regnete es in Strömen, da trat mein Kapitaler ganz unten kurz aus dem Getreidefeld, für einen weidgerechten Schuss war es jedoch viel zu weit. Am Abend packte ich nach weiteren drei Hochsitzstunden meine Sachen und fuhr nach Hause, ein bisschen enttäuscht war ich schon. Fritz sprach mir unermüdlich Mut zu, ich solle nur ja nicht verzagen, ich würde ihn schon kriegen, versprach er mir.
Meine allerliebste Ehefrau, die verständnisvollste von allen, konnte nicht umhin, ihrem Befremden darüber Ausdruck zu verleihen, dass ich so unglaublich viel Zeit dafür verwendete, einem Rehbock nachzujagen. Meine Erklärungsversuche scheiterten erwartungsgemäß. Aber immerhin erkämpfte ich mir das Recht, auch das folgende Wochenende noch einmal jagdlich zu planen.
Mit Optimismus, der allerdings durchwachsen war von einem Hauch von Verzagtheit, das muss ich gestehen, machte ich mich auch am folgenden Freitag wieder auf den Weg ins Unterland. Mein Freund Fritz versicherte mir, dass er den bewussten Revierteil die ganze Woche über in Ruhe gelassen hätte und dass er nach wie vor sicher wäre, dass der Bock im vorderen Winkel seinen Einstand hätte. Das Wetter war gut, der Wind mäßig, als ich mich am Hochsitz einrichtete, stand er mir im Gesicht, also beste Voraussetzungen.

Eine gute Stunde tat sich nichts, ich genoss den lauschigen Abend und ließ mich von Vogelgezwitscher und Grillengezirpe verzaubern. Den Rehfiep packte ich nicht mehr aus, Fritz hatte gemeint, ich solle das lieber bleiben lassen. Und dann auf einmal: der Bock! Da stand er, dicht am Waldrand rechts oben, mit dem Stich zu mir, ich hatte das Gefühl, er äugte mir direkt in meine Augen! Langsam, wirklich ganz langsam hob ich das Glas, um mich zu vergewissern, der Bock stand da wie angewurzelt. Er war es, ohne Zweifel. Und wieder ganz langsam griff ich zur Büchse, der Bock konnte mich nicht im Wind haben, irgendetwas schien ihm aber doch nicht ganz zu passen.
Er begann zu äsen, warf aber immer wieder in kurzen Abständen auf. Er stand immer noch spitz, zog herein auf die Wiese, wurde immer schneller und sprang schließlich flüchtig gegen das Altholz zurück. Ich hatte ihn im Zielfernrohr. Jetzt sprach ich ihn nicht mehr an, sondern ich schrie ihn an. Und da machte er das „Haberl“, das sein Schicksal besiegeln sollte. Der Schuss krachte hinaus in die abendliche Dämmerung, so laut, kam mir vor, dass ihn auch meine Frau oben am Tauern gehört haben musste. Und wenn nicht den Schuss, dann den Jauchzer, der mir gleich darauf entfuhr, denn der Bock lag im Feuer! Es war bei Weitem der beste Bock, den ich bis dahin erlegt hatte.
Das war dann natürlich ein großes Hallo beim Fritz, der rief gleich noch ein paar Nachbarn zu sich ins Haus, und die emsige Cilli trug Jause und Getränke auf, dass sich der alte Bauerntisch bog, eine Bockfeier der zünftigen Art nahm ihren Lauf. Von Fritz bekam ich dann noch so eine Art Orden: Er hätte schon vielen Jägern einen Bockabschuss in seinem Revier ermöglicht, ich wäre derjenige gewesen, der mit Abstand am längsten dazu gebraucht hatte! Ich habe nachgerechnet, es waren 16 Pirschgänge gewesen. „Zache Jaga mochn Wüdbrat!“, lobte mich der Fritz und klopfte mir anerkennend auf die Schulter. Und meine liebe Frau oben am Tauern war auch nicht sonderlich böse darüber, dass ich die Nacht im gastlichen Haus von Fritz und Cilli verbrachte, an ein Nachhausefahren war nicht zu denken.
Als wir im November das erste Mal ins Stierkar aufstiegen und Ausschau hielten nach einem passenden Gamsbock für Fritz, dachte ich kurz darüber nach, ob ich es ihm nicht auch ein wenig schwerer machen könnte und ihn zumindest beim ersten Mal auf gar keinen Fall zu Schuss kommen lassen sollte. Aber den Gedanken verwarf ich gleich, denn so etwas rächt sich meistens. Ich sah an diesem kalten und klaren Novembertag die Gämsen schon von Weitem in den Wandeln stehen, wir kamen bei passendem Wind gut heran, und Fritz erlegte mit sicherem Schuss seinen Gamsbock. Und die Freundschaft eines Gebirgsjägers mit einem Landler-Bauern, die mit einem jagdlichen (Bock-)Handel begonnen hatte, war für lange Zeit gefestigt.
Der Wödhabel-Luis
Einen hatten wir in unserem Dorf, der hieß Alois. Jedenfalls war das sein richtiger Name. Die Leute nannten ihn alle Luis. Der Luis war ein riesenhafter Lackel und maß wohl nicht viel weniger als zwei Meter in der Höhe, aber auch seine Breite war mehr als bemerkenswert. Hände hatte er wie Bärentatzen und eine Kraft, die jedem Wirtshaus-Randalierer schon beim Gedanken daran die Schweißperlen auf die Stirn trieb. Luis war häufig im Gasthaus anzutreffen, was dem Frieden am Stammtisch stets sehr zuträglich war. Denn der Luis war keineswegs ein Raufbold, ganz im Gegenteil, er war meist derjenige, der Meinungsverschiedenheiten zur Einigung brachte, und da reichte üblicherweise bereits seine bloße Anwesenheit. Außerdem war der Luis praktisch immer guter Laune, war zu jedem freundlich, zeigte sich stets hilfsbereit und konnte keine Bitte abschlagen. Wenn also für irgendeine Arbeit besonders viel menschliche Muskelkraft erforderlich war, rief man den Luis, der machte das. Und als der Bruckenwirt dem Luis einmal anerkennend auf die Schulter klopfte, als dieser gerade wieder einmal einen besonderen Kraftakt vollbracht hatte, meinte der Luis mit seinem unnachahmlichen Grinsen im Gesicht: „Woaßt, Bruckenwirt, i moa, waun die Wöd Habel hätt, i hebat sie aus!“ Das gefiel dem Bruckenwirt und den anderen umstehenden Mannsbildern, und der bärenstarke Luis hieß fortan „Wödhabel-Luis“!
Sicher, ein bisschen einfältig war er schon, der Kraftlackel, denn wer glaubt denn allen Ernstes, dass er die Welt aus den Angeln heben könnte? Und wer ist schon zu jedermann freundlich, will keinem etwas Böses tun und hilft überall, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten? Der Luis tat das und war immer zufrieden mit dem, was man ihm gab. Ganz schön oft war das auch nur ein halbherziges Dankeschön. Aber natürlich bekam er für manche Arbeiten auch Geld, und wenn er von einem Bauern um Hilfe gebeten wurde, gab es für einige Tage auch Essen und Trinken. Ausgeschlagen hat er keinem eine Bitte, aber je kleiner und armseliger ein Bäuerlein war, desto lieber half ihm der Luis. Denn bei den großen Bauern saß er zu Mittag am Gesindetisch und bekam meistens einen Teller Sterz und einen gewässerten Most. Bei den ärmeren Bauern saß er aber stets mit den Bauersleuten am Tisch und bekam, was auch diesen aufgetischt wurde. Komisch eigentlich, dachte sich der Luis jedes Mal wieder.
Natürlich wurde er auch ab und zu gehänselt und immer wieder einmal gefragt, wann er denn nun die Welt aus den Angeln heben würde, aber meist war man doch sehr froh, dass man ihn hatte. Denn wenn etwa Zaunstipfel für einen Almzaun auf den Berg zu tragen waren, lud sich der Luis dreimal so viel auf seinen Rücken wie der Bauer. Wenn an einem Karren ein Rad zu wechseln war, hielt der Luis den Karren ohne viel Mühe währenddessen in die Höhe. Wenn irgendwo ein Loch zu graben war, erledigte der Luis das in einem Bruchteil der Zeit, die ein anderer dafür gebraucht hätte. Und wenn ihm dann anerkennend auf die Schulter geklopft und seine titanenhafte Kraft bewundert wurde, war er glücklich, der Wödhabel-Luis.
Es war ein guter alter Brauch, dass sich Anfang November jedes Jahr die Jäger des Dorfes zur Hubertusjagd versammelten. Der Luis war zwar kein Jäger, aber er war ein unentbehrlicher und höchst begeisterter Treiber. Ihm konnte man ohne Bedenken die doppelte Wegstrecke der anderen Treiber zumuten, das machte ihm überhaupt nichts aus, vermutlich wäre er sogar beleidigt gewesen, wenn man es nicht getan hätte. In einem Jahr, in dem zu dieser Zeit bereits der erste Schnee gefallen war und der Wind ordentlich durch das Tal pfiff, machten sie sich wieder auf, um vielleicht einen passenden Hubertushirsch zur Strecke zu bringen. Der Sepp, der Karl, der Gottlieb und natürlich der Luis waren die Treiber. Luis, der sich auch in den meisten Revieren bestens auskannte, stellte zuerst die Schützen an, stapfte dann wieder ganz hinunter ins Tal und war zur Stelle, als der Trieb angeblasen wurde. Nachdem bereits ein „Schneberl“ lag, wie die Jäger das nannten, also eine dünne Schneedecke das Land überzog, ließen sich auch die Fährten sehr schön verfolgen, und es dauerte tatsächlich nicht besonders lange, bis die ersten Schüsse fielen.
Luis kam nach einer guten Stunde zum Albrecht, der am oberen Rand einer wirklich sehr steilen Felsrinne stand, die in einer Art Doline endete, und einigermaßen besorgt in die Tiefe blickte. „I haun auf an Hirsch gschossn, und stöll da vor, der is genau in deis Loch einigrutscht!“, meinte er zum verdutzten Luis. Da war nun guter Rat teuer, wie sollte man den Hirsch in diesem eigentlich unzugänglichen Gelände bergen? Einige der anderen Jäger hatten sich ebenfalls eingefunden, alle blickten sie zaghaft hinunter zum verendeten Hirsch, aber keiner machte irgendwelche Anstalten, etwas zu unternehmen.
Inmitten der herumstehenden Jäger war der Luis der einzige, dem etwas einzufallen schien. Und wie immer stand seine Muskelkraft im Mittelpunkt seiner Überlegungen, er entledigte sich seines Rucksacks und seines Wetterflecks und kletterte bedächtig, aber zielstrebig hinein in die steile Felsrinne. Nach und nach bemerkten es die Jäger und schauten ihm nicht ohne Besorgnis nach. „Wos tuast denn do, Luis?“, rief ihm der Bruckenwirt hinterher. „Jo, oana muass jo den Hirsch huin, oder wuits n liegn lossn?“, gab der Luis zur Antwort und ließ sich nicht mehr davon abbringen, hinunterzuklettern zum verendeten Hirsch. Dort angekommen, spuckte er sich ein paarmal ordentlich in die Hände, band die Vorder- und die Hinterläufe des Hirsches mit einem „Strangl“ zusammen, hob sich den ganzen Hirsch auf seinen Buckel und kraxelte langsam, aber sicher die elend steile Felswand herauf. Die Münder aller oben stehenden Jäger standen weit offen, keiner sagte ein Wort. Dass der Luis sehr viel Kraft hatte, das wussten sie, aber dass er mit einem Hirsch auf dem Buckel eine Felswand nach oben klettern konnte, das ging ihnen entschieden zu weit. Und als der Luis dann tatsächlich über die Felskante heraufschaute, schweißüberströmt und schwer schnaubend, und ihnen den Hirsch vor die Füße schmiss, ging ein Raunen durch die Reihen. Die Männer schüttelten ihre Köpfe, sie konnten nicht glauben, was sie gerade mit eigenen Augen gesehen hatten.

„Luis, bist hiaz gaunz narrisch worn?“, meinte der Bruckenwirt. „Na, sou wos haun i wirkli nou nia gsehgn!“, stammelte der Albrecht. „Hest wos gsogt, mia hättn da jo ghulfn!“, nuschelte der Sepp vor sich hin, aber der Luis sah da schon so ein merkwürdiges Grinsen im Gesicht vom Sepp. Und dann kamen noch ein paar spöttische Bemerkungen von den anderen dazu, die dem Luis nicht gefielen. Es beschlich ihn allmählich das Gefühl, dass er hier nicht bewundert, sondern ausgelacht wurde, und das war etwas, was der Luis gar nicht leiden konnte. Und als dann der Hias noch meinte: „Luis, du bist a festa Depp, du hest in Hirsch wenigstens aufbrechen sulln!“, brannten beim Luis die Sicherungen durch. Er packte den Hirsch kurzerhand und warf ihn mit Schwung zurück hinunter in das Felsenloch!
„Daunn huits eich eichern Hirsch hoit söba!!“ Sprach’s, griff sich seinen Rucksack und den Wetterfleck und ging seines Weges. Da war es natürlich augenblicklich still in der Jägerrunde, so lang waren ihre Gesichter ganz bestimmt noch nie.
Als der Luis nach ein paar Tagen wieder ins Gasthaus kam, tat er, als wäre nichts geschehen und war zu allen freundlich, wie immer. Aber das Verhalten der anderen ihm gegenüber hatte sich grundlegend geändert. Was für ein Respekt ihm auf einmal von allen Leuten im Dorf entgegengebracht wurde, das war schon sehr bemerkenswert. Alle wussten jetzt nicht nur, dass er stark war wie ein Bär, sondern auch eine sehr sensible, empfindsame Seele hatte, die man besser nicht verletzte. Den Namen „Wödhabel-Luis“ trug er fortan wie einen Adelstitel.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.