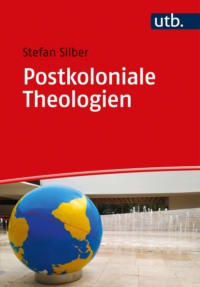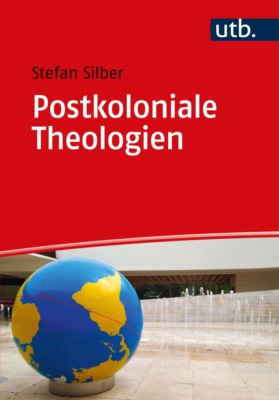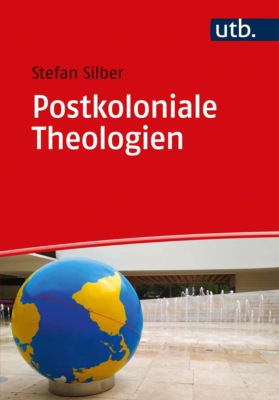Kitabı oku: «Postkoloniale Theologien», sayfa 4
2 Diskurspraktiken
Wissen kann in der Gegenwart nicht mehr einfach als objektiv vorhanden oder zuverlässig erwerbbar gelten. Es wird vielmehr in vielfältigen Diskursen generiert, verändert, weitergegeben und fortentwickelt. Im Zusammenhang mit Machtkonstellationen, wie sie etwa in kolonialen und postkolonialen Kontexten gegeben sind, ist es zu erwarten, dass auch die Diskurse, die Wissen hervorbringen, von diesen Machtverhältnissen durchdrungen sind und in ihnen operieren.
Die postkoloniale Kritik – und mit ihnen postkoloniale Theologien – widmet daher den verschiedenen Strategien und Praktiken des Diskurses sehr viel Aufmerksamkeit. Denn auch die Theologie ist ein Beziehungssystem vielfacher Diskurse, in denen Wissen produziert wird. Und auch theologische Diskurse sind in vielfältige Machtbeziehungen eingewoben. Die Produktion theologischen Wissens in Diskurspraktiken muss daher – gerade auch aus postkolonialer Perspektive – kritisch auf ihre Beeinflussung durch Machtverhältnisse hin befragt werden.
In diesem Kapitel werden einige wichtige Begriffe der postkolonialen Diskurskritik insbesondere anhand ihrer Verwendung in postkolonial-theologischen Texten vorgestellt. Zwei sehr wichtige Konzepte stehen am Anfang: das ↗ Othering oder die Erfindung des/der Anderen (2.1) und die Essentialisierung oder Versteinerung von Identitäten und Begriffen (2.2). Beide sind stark aufeinander bezogen und treten in der Praxis häufig in Verbindung miteinander auf. Kulturelle Bereiche, in denen besonders augenfällig diese Praktiken des Othering und der Essentialisierung nachgezeichnet werden können, sind der Rassismus (2.3) und die Genderbeziehungen (2.6). Auch der Diskurs über Religion und Religionen ist von externen Zuschreibungen, die versteinernd wirken können, geprägt (2.5). Im Kolonialismus wirkt sich besonders stark eine mehr oder weniger offene Überzeugung von der europäischen Überlegenheit (2.4) aus, die sich beispielsweise auch in der Geschichtsschreibung findet (2.7).
Aufgrund der Vielfalt dieser Perspektiven und ihrer komplexen wechselseitigen Beeinflussung wird in postkolonialen Debatten inzwischen mehr und mehr das Konzept der Intersektionalität oder der Überschneidungen solcher Perspektiven aufgegriffen (2.8).
Allen diesen eher kulturell oder diskursiv orientierten Perspektiven gemeinsam ist die charakteristische Eigenschaft kultureller Phänomene, prägend auf das Bewusstsein der Menschen zu wirken, ohne immer offen sichtbar in Erscheinung zu treten. Bestimmte kulturelle Vorstellungen gelten als selbstverständlich, ohne hinterfragt zu werden. Vielmehr werden sie mit einer scheinbaren Sicherheit ‚gewusst‘, weil sie bereits die Wahrnehmung prägen. Ähnlich wie Sophie BessisBessis, Sophie in ihrer Kindheitserinnerung (vgl. oben 1.1) nicht daran zweifelte, dass die ‚Französinnen‘ in ihrer Schule ihnen überlegen waren, so ‚wissen‘ Menschen auch heute in sehr unterschiedlichen postkolonialen Konstellationen aus tiefster Überzeugung, dass manche Identitäten so und nicht anders sind, bestimmte Menschen weniger wert oder weniger fortgeschritten als andere und dass geschichtliche Prozesse so abgelaufen sind, wie es die Mächtigen aufschreiben ließen.
Postkoloniale Studien hinterfragen und kritisieren diese Selbstverständlichkeit und stellen analytische Mittel bereit, um die scheinbare Sicherheit des kulturellen Wissens zu durchbrechen. Sie decken auch Diskurspraktiken in der Theologie auf, in denen solche Stereotypen als Grundlage verwendet oder als Ergebnis begründet werden. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur selbstkritischen Überprüfung theologischer Diskurse.
2.1 Die Erfindung des Anderen
Die Erfindung des Anderen ist eine wichtige von den postkolonialen Studien kritisierte Diskursstrategie. In ihr geht es darum, anderen Menschen, oft innerhalb eines angenommenen Kollektivs, bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben, durch die diese Menschen zugleich charakterisiert und bewertet werden sollen. Dadurch, dass diese Eigenschaften im Unterschied zu den behaupteten Eigenschaften der definierenden Gruppe (oder Subjekts) bestimmt werden, betont diese Strategie die (vermeintlichen) Unterschiede mehr als die Gemeinsamkeiten, die Individuen in beiden Gruppen verbinden. Die Menschen der so definierten Gruppe scheinen grundlegend anders zu sein: Sie werden zu Anderen gemacht. Der Postkolonialismus nennt diese Strategie ↗ „Othering“1, man könnte das als ‚VeranderungVeranderung‘2 oder ‚fremd machen‘, ‚anders machen‘ übersetzen.
Gayatri SpivakSpivak, Gayatri hat das Phänomen des Othering ausführlich analysiert und beschrieben3. Ihr zufolge geht es beim Othering nicht nur um die Beschreibung, Differenzierung oder Abgrenzung, sondern immer auch um die Abwertung und Beherrschung derjenigen, die zu Anderen gemacht werden: Es impliziert die Bestätigung einer Machtbeziehung durch moralische Gegensätze wie wild/zivilisiert, verräterisch/zuverlässig usw., die in scheinbares Wissen über den Anderen oder die Andere umgesetzt werden. Dieses Wissen und seine Produktion sind wiederum nur dem Herrschenden in dieser Machtbeziehung zugänglich. Auf diese Weise wird die Herrschaft scheinbar legitimiert.
Homi BhabhaBhabha, Homi macht darüber hinaus noch darauf aufmerksam, dass diese Veranderungsprozesse nicht nach einem festgelegten Schema stattfinden, sondern Ambivalenzen und Veränderungen einschließen4. Die Bewertung des ‚Anderen‘ kann zwischen Spott und Sehnsucht changieren, nährt sich aus unterbewussten Fantasien und Obsessionen, so dass der veranderte Mensch zugleich Projektionsfläche der eigenen Wünsche wie der eigenen Verachtung sein kann.
Der US-amerikanische Bibelwissenschaftler Uriah Y. KimKim, Uriah zeigt, wie sich Prozesse des Othering auch in der Bibel finden lassen. Dazu beschreibt er zunächst, wie sich das Fremdmachen von Menschen in der nordamerikanischen Geschichte bis in die Gegenwart legitimiert. Er fragt:
„Wie kann es sein, dass die Abkömmlinge von Europäern, die […] bis 1492 nie aus Europa herausgekommen sind, heute als ‚Einheimische‘ in diesen Ländern gelten und sich auch dafür halten“, während „die indigenen Bevölkerungen […] als das andere leben und gelten?“5
KimKim, Uriah verbindet diese scheinbare Legitimation mit der Notwendigkeit, die koloniale Machtordnung zu stabilisieren: Damit die Mächtigen im kolonialen System ihre Herrschaft aufrechterhalten können, auch wenn sie rein nummerisch in der Minderheit sind, werden die Beherrschten als menschlich, intellektuell und/oder moralisch unterlegen qualifiziert. Die tatsächliche Überlegenheit der Herrschenden wird so zu einer scheinbar natürlichen und unhinterfragbaren Wirklichkeit. Sie kann zur ethnologischen oder rassenideologischen ‚Wissenschaft‘ werden.
Im Fall der Vereinigten Staaten beschreibt Kim eine weitere Komplexität dieses Veranderungsprozesses: Während „nationale ethnische Minderheiten (Iren, Italiener, Polen, Griechen und andere weiße Europäer) nach und nach Teil der Mehrheitsgruppe wurden“, gelang dies weder den UreinwohnerInnen noch anderen ImmigrantInnen: „Nichteuropäische ethnische Gruppen (Schwarze, einheimische Indianer, Asiaten, Latinos)“6 wurden den anderen Gruppen gegenüber abgewertet, vereinzelt, als Minderheiten abgestempelt und gegeneinander ausgespielt.
Während KimKim, Uriah die innere Differenzierung und Hierarchisierung der ‚weißen‘ Bevölkerungsgruppe vernachlässigt, zeigt er dennoch anschaulich, wie Menschen allein aufgrund äußerer Merkmale und geografischer Herkunft kulturell (und damit unbewusst) in hierarchisierte Menschengruppen eingestuft werden.
Vergleichbare Prozesse des Othering im biblischen RichterbuchOthering deckt KimKim, Uriah im biblischen Richterbuch auf. Dies legt sich nicht zuletzt deswegen nahe, weil die Eroberung indigener Territorien Nordamerikas im 18. Jahrhundert durch europäische EinwandererInnen unter anderem auch mit dem Verweis auf die biblischen Landnahmeerzählungen legitimiert und glorifiziert wurden.
Im Richterbuch werden nun die Völker des Landes Kanaan zwar mit einzelnen Namen genannt, jedoch nicht differenziert: Sie werden als Einheit, als feindliche Einheit konstruiert, die die Identität und die Existenz des erobernden Volkes bedroht7. Ebenso wird das Volk Israel als Einheit konstruiert, dessen interne Differenzierungen weitgehend minimiert werden. Die Unterschiede zwischen der einen, eigenen und der fremden, feindlichen Einheit werden dagegen in binärer, kontrastierender Weise übersteigert.
Auf einer vordergründigen Ebene scheint der Text also durch die Strategie des Othering die Abwertung und schließlich Auslöschung einer erzählten Menschengruppe durch eine andere zu legitimieren. Zumindest wurde der Text in der nordamerikanischen Eroberungsgeschichte von Seiten der Kolonisatoren genau so interpretiert.
KimKim, Uriah analysiert jedoch darüber hinaus, dass der biblische Text interessanterweise diese strenge binäre Unterscheidung selbst an vielen einzelnen Punkten nicht durchhält: In manchen Episoden wird erzählt, wie Israeliten sich schlimmer verhalten als die Kanaaniter (wie in Ri 19,25Ri 19,25 ). An anderen Stellen gibt es Kanaaniter, die sich mit den Israeliten solidarisieren (Ri 1,24-26Ri 1,24-26 ), und Personen, die nicht eindeutig einer der beiden Gruppen zugeordnet werden können (Ri 3,31Ri 3,31 ). Ja, eines der transversalen Themen des Richterbuchs ist gerade die immer wieder erzählte Tatsache, „dass es Israel nicht gelungen ist, den Hauptunterschied zwischen sich und den Anderen aufrechtzuerhalten“8. Der biblische Text verhält sich auf einer untergründigen Erzählebene widerständig gegenüber dem Narrativ der Veranderung, das an der erzählten Oberfläche aufrechterhalten wird. Veranderungsprozesse werden dadurch vom Text selbst subtil durchbrochen.
Eine nicht unbedeutende Rolle für die Konstruktion der binären Unterscheidung zwischen Israel und Kanaan – ebenso wie für deren Durchbrechung – spielen dabei die in den Erzählungen auftauchenden Frauen9. Denn einerseits werden Frauen in patriarchaler Weise als den Männern (auch gewaltsam) untergeordnet beschrieben, andererseits zeigt es sich, etwa im Erzählkreis um Samson, dass die narrativ doppelt untergeordneten und abgewerteten Kanaaniterinnen die bedrohliche Macht besitzen, auch den stärksten israelitischen Mann zu besiegen: „Jede Frau kann Israel seiner Mannheit berauben.“10 Auch hier wird also die vordergründige Dualität der Veranderung im Text selbst ironisch gebrochen.
KimKim, Uriah kontextualisiert die Redaktion des Richterbuchs in einer deutlich späteren Epoche, in der von einer militärischen Eroberung des Landes gerade nicht mehr die Rede sein konnte, und deutet die Funktion des Othering im Text mit dem Wunsch, die eigene Gruppenidentität zu stärken und mögliche Abweichungen von dieser Identität zu verurteilen11. Die im Richterbuch erzählten Gewalttaten aufgrund des Otherings können daher – in der Interpretation Kims – gerade nicht binäre Veranderungsdiskurse in der Gegenwart und mit ihnen einhergehende Gewalt legitimieren. Eine Interpretation des Richterbuchs in der Gegenwart muss diese Kontextualisierung ebenso berücksichtigen wie die andauernde Realität des Othering in postkolonialen Gesellschaften. In kolonialen oder postkolonialen Kontexten kann der Text sonst eine Bedeutung erlangen, die der ursprünglichen Intention des biblischen Textes nicht entspricht. KimKim, Uriah demaskiert dadurch zugleich die oberflächliche Inanspruchnahme der Landnahmeerzählungen durch die nordamerikanischen ErobererInnen und die Auswirkungen dieser Aneignung bis in die Gegenwart.
Uriah KimKim, Uriahs postkoloniale Interpretation des Richterbuchs ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Theorien und Werkzeuge der postkolonialen Studien dazu dienen können, biblische Texte und die Theologie im Allgemeinen kritisch anzufragen. So können Diskurspraktiken aufgedeckt werden, die in den biblischen und theologischen Texten bereits durchscheinen und zur Legitimation von Veranderung und anderen Formen der Sicherung von Herrschaftsansprüchen in der Gegenwart dienen. Ebenso kann aber auch gezeigt werden, inwiefern ein bestimmter Gebrauch biblischer Texte missbräuchlich ist und in erster Linie koloniale Interessen durchsetzen soll.
Othering tritt überdies nicht nur in kolonialen Kontexten auf, sondern wird in vielen anderen Prozessen der Ausübung und Legitimation von Macht eingesetzt, etwa auch in rassistischen, sexistischen und klerikalen Settings. Postkoloniale Methoden können insofern auch in anderen Kontexten, in denen nicht auf den ersten Blick ein ausdrücklich kolonialer Hintergrund zu erkennen ist, erhellend und befreiend wirken.
2.2 Die Versteinerung von Identitäten
Die Erfindung des Anderen wird noch verschärft, wenn dem/der Anderen – und damit gewissermaßen spiegelbildlich auch dem Subjekt selbst – klar umgrenzte, statische und scheinbar unveränderliche Identitäten zugeschrieben werden. Die negative Bewertung und Unterordnung des/der (erfundenen) Anderen unter den eigenen Dominanzanspruch wird auf diese Weise verfestigt und versteinert. Der/die Andere erscheint minderwertig, einfach weil er/sie einer Gruppe von Menschen zuzugehören scheint, die als minderwertig konstruiert wurde, damit der Machtanspruch, der gegenüber dieser Gruppe erhoben wird, als legitim erscheinen kann. Diesen Vorgang nennt man in der postkolonialen Theorie ↗ EssentialisierungEssentialisierung oder Naturalisierung1. Die kulturell zugeschriebene ‚Identität‘ wird so verstanden, als wäre sie auf ‚natürliche‘ Weise oder ‚essenziell‘, also ‚wesenhaft‘, mit einer bestimmten Menschengruppe und den zugehörigen Individuen verbunden.
Insbesondere Rassismus und Sexismus in ihren vielfältigen Spielarten arbeiten mit diesen Essentialisierungen. Menschen mit bestimmten phänotypischen Merkmalen wie Haut- oder Haarfarbe bzw. Menschen, die einem bestimmten Geschlecht zugeordnet werden, wird eine kulturell bestimmte Identitätsformation zugeschrieben, die scheinbar allen Individuen dieser Gruppe eigen ist. In rassistischen und sexistischen Diskursen werden dazu häufig auch noch ‚wissenschaftliche‘ Analysen, Systematisierungen und Begründungen erarbeitet, so dass diese versteinerten Identitätszuschreibungen auch akademisch untermauert gelehrt und verwendet werden.
Rassismus und Sexismus wurden als wichtige Instrumente kolonialer Herrschaft eingesetzt und stellen auch in der Gegenwart zentrale Elemente postkolonialer kultureller Kontexte dar (vgl. Kapitel 2.3 und 2.6). Darüber hinaus bieten sich kulturelle, ethnische oder nationale Identitäten als Material für die Versteinerung an. Die Theologin → Namsoon KangKang, Namsoon, die aus Korea stammt und in den USA lehrt, zeigt etwa, dass in der Theologie ein essentialistisches Bild von Asien und asiatischen Theologien konstruiert wurde. Mit ausdrücklichem Bezug auf Edward SaidSaid, Edward schreibt sie:
„Das Bild des Orients neigt dazu, unbeweglich, eingefroren, und auf ewig festgelegt zu sein; deshalb wird die Möglichkeit der Transformation und Entwicklung des Orients geleugnet.“2
Essentialistische GegenstrategieDer kolonialistischen Abwertung Asiens und des (essentialisierten) Asiatischen entspricht dann eine von KangKang, Namsoon ebenfalls kritisierte essentialistische Gegenstrategie, in der die asiatische Theologie „glorifiziert, mystifiziert und idealisiert [wird] als die Weisheit des Ostens“3. Asiatische Theologie erscheint in dieser Gegenstrategie ebenso als festgelegt und vereinheitlicht: Bestimmte mystische oder weisheitliche Beispiele asiatischer Theologien werden als Paradigma oder als Wesen ‚der‘ asiatischen Theologie konstruiert und als ‚Anderes‘ des rationalen und diskursiven Europa festgelegt. Dies wird laut Kang „sowohl von den Menschen der westlichen Halbkugel als auch von den Asiaten selbst“4 so praktiziert.
Asiatische TheologInnen, die nicht diesem westlich-mystischen Klischee entsprechen, sondern ‚westliche‘ theologische Methoden anwenden, können dann schnell als entfremdet oder kolonialisiert denunziert werden. Insbesondere der Feminismus kann so als etwas ‚Nichtasiatisches‘ ausgeschlossen werden, sowohl von ‚asiatischer‘ wie von ‚westlicher‘ Seite5. Hier bezieht KangKang, Namsoon sich ausdrücklich auf die feministisch-postkoloniale Theoretikerin Chandra Talpade MohantyMohanty, Chandra Talpade, die bereits 1984 darauf aufmerksam gemacht hatte, dass es Menschen aus Asien gerade auch im akademischen Kontext schwer gemacht wird, im Westen oder dem Westen gegenüber eine Identität einzunehmen, die nicht mit der klischeehaften Vorstellung des Asiatischen übereinstimmt6.
Aber auch in der ‚westlichen‘ Feministischen Theologie deckt KangKang, Namsoon essentialistische Herangehensweisen auf: Anhand einer Arbeit von Rosemary Radford RuetherRuether, Rosemary Radford aus dem Jahr 1998 zeigt Kang, wie Ruether „durch die Erwähnung verschiedener individueller feministischer TheologInnen im Westen“ „die Falle der Verallgemeinerung zu vermeiden sucht“7, dann aber bei der Darstellung der Feministischen Theologie des Globalen Südens genau in diese Falle tappt, indem sie die individuellen Theologinnen in den Kategorien Lateinamerika, Afrika und Asien namenlos verschwinden lässt.
Innerhalb der Theologie in Asien selbst können Frauen und ihre gesellschaftliche Rolle ebenfalls essentialisiert erscheinen:
„Im asiatischen theologischen Diskurs über die Frauen, zum Beispiel, werden die Frauen als reine Opfer oder sich befreiende Persönlichkeiten dargestellt, die über all den Schmerz und das Leid mit einer verblüffenden, erlösenden Kraft hinauswachsen.“8
Frauen als Täterinnen, Frauen als Angehörige der Machtelite oder in anderen gesellschaftlichen Rollen kommen dagegen nicht in den Blick. Auch ihre kulturellen, ethnischen, nationalen und klassenbezogenen Differenzen und persönlichen, individuellen Eigenschaften bleiben unberücksichtigt: „Die asiatischen Frauen werden einseitig als Opfer betrachtet und jedwede historisch-kulturelle Eigenart wird ihnen aberkannt.“9 Dagegen müssten sowohl die interne Diversität der Gruppe ‚asiatische Frauen‘ als auch die Vielfältige Beziehungen von Ähnlichkeiten und Differenzenvielfältigen Beziehungen von Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen ‚asiatischen Frauen‘ einerseits und ‚nichtasiatischen Frauen‘ bzw. ‚asiatischen‘ und ‚nichtasiatischen Männern‘ andererseits Berücksichtigung finden.
So kritisiert KangKang, Namsoon beispielsweise auch den Theologen Aloysius PierisPieris, Aloysius aus Sri Lanka, der die Erfahrung der Armut und die Vielfalt der Religionen als zwei gemeinsame Nenner der asiatischen Theologie ausmacht10. Andere Herausforderungen in asiatischen Kontexten, die sich nicht mit diesen beiden großen Kategorien in Verbindung bringen ließen, könnten so nicht Gegenstand einer ‚asiatischen Theologie‘ im Sinn dieser Definition sein.
Das Aufgreifen einer essentialistischen Vorstellung von ‚der asiatischen Theologie‘ durch TheologInnen aus Asien wird dabei von KangKang, Namsoon ausdrücklich nicht verworfen, da sie es auch als eine verständliche Gegenreaktion und legitime Widerstandspraxis gegen die westliche Abwertung ansieht. Dies bezieht sich auf Gayatri SpivakSpivak, Gayatris Rede vom „Strategischer Essentialismusstrategischen Essentialismus“11: Unter bestimmten Bedingungen kann eine Essentialisierung als Mittel zum Widerstand, zur Mobilisierung von Menschen oder auch zur Markierung einer Gegenposition als strategisches Instrument zum Einsatz kommen, wenn dabei der Gefahr der Versteinerung entgegengewirkt wird.
Die negativen Auswirkungen dieser Essentialisierungen müssen jedoch immer kritisch und selbstkritisch im Blick bleiben. Insbesondere müssen sowohl interne Differenzen zwischen den Personen, die unter einen strategischen Essentialismus fallen, als auch die Beziehungen, die zwischen den als verschieden markierten Positionen herrschen, benannt und analysiert werden. Sonst droht die Gefahr eine Isolation der verschiedenen sich selbst als rein und unveränderlich verstehenden Identitäten. KangKang, Namsoon warnt daher ausdrücklich:
„Heutzutage ist es völlig klar, dass alles, was sich isoliert, sei es westliche oder asiatische Theologie, versteinert. Und alles, was versteinert, stirbt.“12
Neben solchen versteinerten Identitätszuschreibungen, die sich auf Menschen anderer Regionen, Kulturen und Ethnien richten können, finden sich Essentialisierungen auch in anderen diskursiven Bereichen. Auch Begriffe und Konzepte können essentialistisch verwendet werden können, so als ob ihre Bedeutung festgelegt und unveränderlich wäre.
Auch Essentialisierungen in der Theologiein der Theologie werden solche generalisierenden Begriffe häufig unkritisch verwendet und können zu Essentialisierungen und politischer, aber auch theologischer Versteinerung führen und so zur bewussten oder unbewussten Machtausübung eingesetzt werden. Die argentinisch-schottische feministische Theologin → Marcella Althaus-ReidAlthaus-Reid, Marcella analysiert am Beispiel der Gnadenlehre, wie auch theologische Lehrsysteme, wenn sie in einer versteinerten Weise angewendet werden, zur Rechtfertigung von Gewalt, Ausbeutung und Mord gebraucht werden können. Bei der Eroberung Lateinamerikas sei der Gnadenbegriff dazu missbraucht worden, die UreinwohnerInnen des Kontinents als ‚Heiden‘, als „Minderwertige“13 abzuwerten. Allerhand „Sünden“ seien dazu konstruiert worden: „Kannibalismus, abweichendes Sexualverhalten, Faulheit und mangelnde geistige Ernsthaftigkeit“ konnten „als Vehikel für die Gnade“ dienen, auch wenn sie „(wie im Fall des Kannibalismus) reine Phantasiegebilde angesichts der tatsächlichen Identität der Eingeborenen waren“14. Die ‚Gnade‘ der Evangelisierung mussten die UreinwohnerInnen mit ihrem Land, ihrer Arbeitskraft und oft genug mit dem Leben bezahlen.
Einen ähnlichen Missbrauch eines versteinerten Lehrbegriffs konstatiert Althaus-ReidAlthaus-Reid, Marcella bei der Rede von der Gnade während der argentinischen Militärdiktatur (1976–1983), die zum Tod oder spurlosen Verschwinden von Zehntausenden argentinischer Staatsangehöriger führte. Die Inanspruchnahme versteinerter Lehren, die sich von ihrer ursprünglichen biblischen und theologischen Bedeutung entfernt hatten und nur noch den Begrifflichkeiten nach am Christentum festhielten, konnte zur Legitimation der Diktatur und ihrer Verbrechen werden:
„Bestimmte Predigten zur damaligen Zeit sprachen von einem Land, das vom Kommunismus erlöst werden musste nach dem Beispiel von JesusJesus am Kreuz, und diese Erlösung sollte ‚durch das Blut‘ von Mitbürgern erreicht werden.“15
Solche kritisch zu bewertenden Praktiken finden sich auch in politischen und befreienden Theologien. → R.S. SugirtharajahSugirtharajah, R.S. kritisiert beispielsweise an der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung, dass sie dazu neige, „die Armen zu reifizieren“ und dann „zu romantisieren“16. ‚Reifizierung‘, also Verdinglichung, kann mit dem verglichen werden, was hier als ‚Essentialisierung‘ oder Versteinerung bezeichnet wird. ‚Die Armen‘, ‚die Frauen‘, ‚die Arbeiter‘, ‚die Laien‘, ‚die Ausgeschlossenen‘ (usw.) sind klassische „masterwords“17 im Sinn von Gayatri SpivakSpivak, Gayatri. Darunter versteht sie Wörter, die als machtvolle Oberbegriffe eine größere, heterogene Gruppe von Menschen so bezeichnen, als wäre sie homogen. Zugleich – durch die Macht der Verallgemeinerung – üben diese Begriffe Herrschaft (im Sinn des englischen master) über diese Menschen aus, indem sie sie homogenisieren und ihre individuellen Differenzen verschwinden lassen. Diese Herrschaft üben natürlich nicht die Begriffe selbst aus, sondern diejenigen, die sie verwenden. Durch die Benennung als masterwords lässt sich diese Herrschaftsausübung an den Begriffen selbst sichtbar machen.