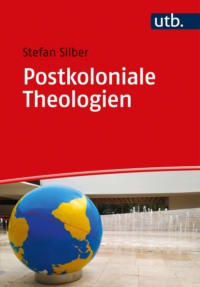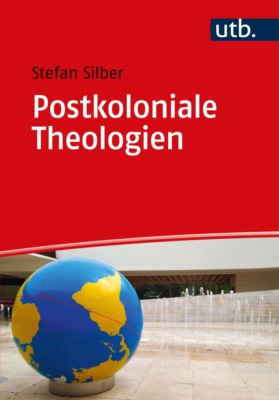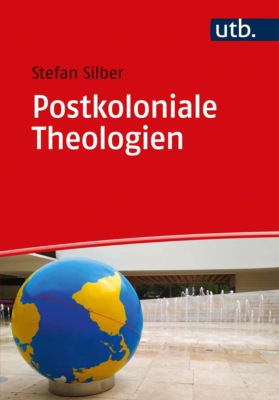Kitabı oku: «Postkoloniale Theologien», sayfa 6
2.5 Gibt es überhaupt Religionen?
Die Frage in der Überschrift mag zunächst ungewöhnlich erscheinen. Die postkoloniale Kritik an der erkenntnistheoretischen Kategorie der Religion kann jedoch die Konsequenz nach sich ziehen, danach zu fragen, was mit diesem Begriff denn nun eigentlich gemeint ist: Auf welche kulturellen und historischen Phänomene trifft der Begriff in welcher Weise zu? Gibt es ein Machtinteresse, das mit seiner Verwendung verbunden ist oder war? Welche Funktion übte er beispielsweise in der Legitimation und Praxis der Kolonisierung aus1?
Auch die aktuelle Religionswissenschaft sieht berechtigte Zweifel an der Konsistenz des Religionsbegriffs, insbesondere in seiner Anwendung. Denn eine Religionswissenschaft, die sich neutral gegenüber den Selbstdefinitionen der Religionsgemeinschaften, insbesondere dem Konfessionalismus verhalten will, steht vor dem Problem zu entscheiden, wie eine Religion genau zu definieren oder zu beschreiben ist. So schreibt Ulrich BernerBerner, Ulrich:
„Die Problematik all dieser Ordnungs- und Klassifikationsversuche […] liegt […] in der Tendenz zur Essentialisierung, d.h. der Tendenz, das ‚Wesen‘ oder die ‚Sinnmitte‘ der einzelnen Religionen oder der Religion überhaupt zu definieren.“2
Welchen Stellenwert besitzt beispielsweise für ‚das Christentum‘ die Bibel oder die Eucharistie? Je nach christlicher Konfession wird das ein anderer sein. Dasselbe gilt für den Sabbat ‚im Judentum‘ oder den Koran ‚im Islam‘. BernerBerner, Ulrich zitiert daher Pierre BourdieuBourdieu, Pierre mit der Aussage, dass vielen „gemeinhin als christlich bezeichneten Glaubensinhalten und Praktiken“ oft „kaum mehr als der Name gemein ist“3.
Nicht-Homogenität von ReligionenReligionen sind also nicht homogen, wurden aber gerade in der kolonialen Praxis häufig als solche behandelt, um sie durch die ↗ Essentialisierung leichter beherrschen und manipulieren zu können, sowie durch sie die koloniale Herrschaft zu stabilisieren. Die koloniale Religionswissenschaft unterstützte diese Praxis, indem sie verschiedene Ausprägungen einer Religion zu ‚abweichenden‘ oder ‚heterodoxen‘ Strömungen erklärte, häufig in Übereinstimmung mit einheimischen Eliten, mit denen die Kolonialbeamten zusammenarbeiteten.
→ KwokKwok, Pui-lan Pui-lan kritisiert diese westliche religionswissenschaftliche Praxis als eine „Reifizierung der Religionen“4, also ihre Verdinglichung oder Essentialisierung. Was an einer Religion lebendig, flexibel und auf Austausch ausgerichtet ist, wird zugunsten eines starren, scheinbar wissenschaftlichen Begriffs von unterscheidbaren Religionsgemeinschaften zurückgedrängt.
Dieser Ausschluss kann sogar – wie der chinesische Theologe LaiLai, Pan-chiu Pan-chiu erläutert – christliche Traditionen in einem kolonialen Setting treffen: Christliche Spuren in Asien, die von nestorianischen, arianischen und monophysitischen ChristInnen aus der Zeit ihrer Verfolgung im Römischen Reich stammen, wurden in der kolonialen Mission nicht als etwas christlich-Eigenes aufgegriffen sondern als heterodox abgelehnt. Sie können aber heute zur Ausbildung einer eigenen, inkulturierten chinesischen Identität des Christlichen beitragen5.
Der Reifizierung oder Verdinglichung der Religionen entspricht eine trennende oder unterscheidende Abgrenzung der einen von der anderen Religion. Die verschiedenen Beziehungen, die Angehörige der Religionen untereinander aufbauen, werden marginalisiert oder zur Abweichung erklärt. So scheinen etwa die Möglichkeiten der Marienverehrung im Hinduismus6 oder der Sabbatobservanz statt Sonntagsheiligung im Christentum für die jeweilige Religion untypisch zu sein. Sie stellen aber Beispiele von Praktiken dar, die bei Angehörigen vieler Religionen selbstverständlich geübt werden, wenn sie in ihren Kontexten mit Riten und Überzeugungen von Angehörigen anderer Religionen in Berührung kommen. Solche Phänomene verweisen auf diese Weise darauf, dass eine essentialistische Beschreibung von Religionen ihrer lebendigen kulturellen und interkulturellen Dynamik überhaupt nicht angemessen ist.
Vielmehr muss jedes Studium ‚der Religionen‘ der Tatsache Rechnung tragen, dass es Vielfältige Beziehungen zwischen Religionenvielfältige Beziehungen zwischen den Religionen gibt, nicht nur Ähnlichkeiten, sondern auch wechselseitige Abhängigkeiten, geteilte und verwobene Geschichten. Der Begriff der „entangled histories“7, der von der postkolonialen Ethnologin Shalini RanderiaRanderia, Shalini vertreten wird, und die Tatsache benennt, dass auch scheinbar getrennte Geschichten immer ineinander verwoben und miteinander verflochten sind, hat hier seine besondere Berechtigung.
So zeigt beispielsweise Sigrid RettenbacherRettenbacher, Sigrid in ihrer Dissertation, wie verschiedene Religionsgemeinschaften ihre Beziehungen, Differenzen und Abgrenzungen im Lauf der Geschichte immer wieder durch ↗ Verhandlungen im Diskurs ausbildeten8. Christentum und Judentum waren nach dieser Lesart sehr viel länger miteinander verbunden und trennten sich erst dann in zwei voneinander zu unterscheidende Religionsgemeinschaften, als das Christentum eine Machtposition im Römischen Reich gewonnen hatte. Der äußeren Abgrenzung zwischen den künftig als getrennt wahrgenommenen Religionen entspricht dabei genau auch eine innere Essentialisierung:
„Mit der Trennung bzw. Schaffung von Judentum und Christentum im vierten Jahrhundert wurde also zugleich auch die Differenz von Orthodoxie und Häresie festgeschrieben, so dass fortan eindeutig zu definieren war, wer sich drinnen und wer sich draußen befindet.“9
→ R.S. SugirtharajahSugirtharajah, R.S. macht auf die Verflochtenheit des Christentums mit den asiatischen Religionen aufmerksam: Durch „Händler, Handwerksleute, Migranten und vor religiöser Verfolgung Flüchtende“10 breitete sich das ‚Christentum‘ in den ersten Jahrhunderten in die gesamte damals bereiste Welt, bis ins heutige Japan, aus, ohne gezielt ‚Mission‘ im heutigen (oder im kolonialen) Sinn zu betreiben. Auch umgekehrt lassen sich Spuren östlicher Weisheit und Kulturen in den christlichen Überlieferungen nachweisen. So korreliert Sugirtharajah den historisch bezeugten „religiösen Akt der freiwilligen Selbstopferung“11, der von dem indischen (buddhistischen?) Emissär ZarmanochegasZarmanochegas im Jahr 37 v. Chr. in Athen vollzogen wurde, mit der Selbstverbrennung, auf die PaulusPaulus in 1 Kor 13,31 Kor 13,3 anspielt. Religiöse Traditionen müssten insofern immer als ↗ Hybride gelesen werden und verweisen auf interreligiöse Beziehungen.
In der postkolonialen Kritik wird aus diesen Gründen der Infragestellung des ReligionsbegriffsReligionsbegriff selbst in Frage gestellt. Der britische Religionswissenschaftler Richard KingKing, Richard urteilt, dass der Begriff Religion selbst „eine Kategorie der christlichen Theologie“ sei, „das Produkt kulturell spezifischer Diskursprozesse christlicher Theologie im Westen, hergestellt im Schmelztiegel interreligiösen Konflikts und Interaktion.“12 Durch die Aufnahme dieses christlich-theologischen Begriffs in die westliche Religionswissenschaft, argumentiert KwokKwok, Pui-lan Pui-lan, erhält er eine Deutekraft über alle Phänomene weltweit, die mit ihm bezeichnet werden, ungeachtet ihrer kulturellen Besonderheiten, sogar in säkularen akademischen und dadurch auch nicht-akademischen Kontexten. „Auf diese Weise dient das Christentum weiterhin als Prototyp einer Religion und als Standard, mit dem andere Weisheitstraditionen bewertet werden“13, folgert Kwok.
Auch Sigrid RettenbacherRettenbacher, Sigrid argumentiert (mit Daniel BoyarinBoyarin, Daniel): „Religion“ gibt es als „erkenntnistheoretische Kategorie[…]“14 nicht vor dem 4. Jahrhundert u.Z. Diese Kategorie und mit ihr die ‚Religionen‘ des Christentums und des Judentums wurden „erfunden“ (invented)15, um das bezeichnen zu können, was sich durch die Trennung von Judentum und Christentum auszudifferenzieren begann. Diese religionswissenschaftliche Kategorie kann daher nicht ohne weiteres auf ganz andere kulturelle Phänomene in weit entfernten Kontexten angewendet werden.
Welche Konsequenzen sich daraus für die koloniale Religionswissenschaft ergaben, zeigt RettenbacherRettenbacher, Sigrid an zahlreichen Beispielen. So zeichnet sie nach, wie bei der kolonialen Beschreibung des Hinduismus gezielt nach Phänomenen gesucht wurde, die man aus dem Christentum kannte, nämlich heiligen Schriften und geistlichen Eliten, ohne sich zu fragen, ob solche Institutionen tatsächlich auch eine wichtige Bedeutung in der untersuchten ‚Religion‘ besaßen – bzw. welche Bedeutung das war16. So kann man von einer westlichen Erfindung des Hinduismus im Interesse der Kolonialmacht und der mit ihr zusammenarbeitenden einheimischen Eliten sprechen.
Dass in einer Religionswissenschaft, die von solchen Voraussetzungen geprägt ist, der unmittelbare Vergleich zwischen dem Christentum und den ‚Religionen‘ der kolonisierten Völker in der Regel zugunsten der Religion der Kolonialherren ausging, mag da nicht mehr überraschen. Dieses Selbstverständnis der eigenen Überlegenheit deckt KwokKwok, Pui-lan Pui-Lan jedoch auch noch in der säkularisierten Religionswissenschaft und in der liberalen Religionstheologie, etwa bei John Hick, auf. Dessen Annahme, dass alle Religionen Antworten auf dieselbe transzendente Realität seien, verwischt nach ihrer Kritik die tatsächlichen Differenzen zwischen den Religionen und betrachtet sie wiederum aus einer scheinbar überlegenen westlichen Perspektive – nun des Pluralismus17.
Ein solcher nivellierender Pluralismus wird den vielfältigen Differenzierungen in der Welt der ‚religiösen‘ Phänomene nicht gerecht: „Statt unser Denken auf das liberale Paradigma des religiösen Pluralismus zu bauen, müssen wir eine postkoloniale Theologie der religiösen Differenz in den Blick nehmen“18, schreibt KwokKwok, Pui-lan. In dieser Theologie stehen dann nicht mehr ‚Religionen‘ als essentialisierte und abgegrenzte Größen im Blickpunkt, sondern die Differenzen, die sich zwischen den Erfahrungen von Menschen aus unterschiedlichen kulturellen, weisheitlichen, lebensweltlichen und religiösen Kontexten ergeben.
Zugleich richtet eine postkoloniale Theologie der Religionen ihren Blick nicht nur auf die Differenzen zwischen den religiösen Erfahrungen, Vorstellungen und Praktiken, sondern auch auf ihre Gemeinsamkeiten, Überlappungen und Komplementaritäten. So beschreibt der malaysische Jesuit Jojo FungFung, Jojo, der auf den Philippinen lehrt, die verschiedenen Erfahrungen des Geistes in der indigenen Welt, im Schamanismus, in der chinesischen Kultur, in der Bibel und in der säkularen Moderne und bezieht die unterschiedlichen Vorstellungen aufeinander19. Auf diese Weise kann er herausstellen, dass es ungerecht und unzutreffend ist, dem Schamanismus und den indigenen Religionen Primitivität zu unterstellen und die säkulare Moderne (oder das Christentum) demgegenüber für fortschrittlich zu halten. Vielmehr zeigen sich für Fung in diesen verschiedenen Beschreibungen des ‚Geistes‘ unterschiedliche Ausdrucksformen der menschlichen Suche nach einer Beziehung mit dem in der Bibel beschriebenen Geist Gottes. Der Schamanismus muss daher aus christlicher Sicht für Fung respektiert und als Dialogpartner geschätzt werden.
2.6 (Post-)Koloniale Genderbeziehungen
Die bisher beschriebenen kolonialen Diskurspraktiken wirken auch im Bereich der Geschlechterverhältnisse, und sie werden insbesondere von der postkolonialen feministischen Theologie auch kritisch analysiert. ↗ Othering und ↗ Essentialisierung sind klassische Methoden, um aus der Perspektive einer männlichen Dominanz Frauen als das ‚andere‘ oder das ‚zweite‘ Geschlecht zu klassifizieren. Sie dienten auch zur Bestätigung europäischer Überlegenheit in kolonialen Kontexten.
Auch binäre Geschlechtskonstruktionen tendieren dazu, dualistisch und zugleich exklusiv zu werden. Geschlechtliche Identitäten, die sich nicht in diesen Dualismus einordnen lassen, werden dann als abweichend oder unnatürlich, als Ausnahme oder schlichtweg als nicht existierend eingestuft. Die Beispiele in diesem Abschnitt kritisieren meistens eine patriarchal-dualistische Geschlechterkonstruktion ohne explizit auf die tiefere Problematik eines zweigeschlechtlichen Menschenbildes aufmerksam zu machen. Diese weiterführende Kritik wird von diesen feministischen Überlegungen jedoch mit angestoßen und muss immer im Blick bleiben1.
Auch im Bereich der Kirchen und der Theologie Verschlechterte Beziehungen zwischen den Geschlechtern durch den Kolonialismushat der Kolonialismus die Beziehungen zwischen den Geschlechtern häufig grundlegend zum Schlechteren verändert. → Musa DubeDube, Musa, Theologin und Bibelwissenschaftlerin aus Botswana, zeigt, wie der Umgang der europäischen Missionare mit den vorkolonialen Gottesauffassungen in Botswana von patriarchalen und eurozentrischen Vorurteilen geprägt war und zu innerkulturellen Störungen der Beziehungen zwischen den Geschlechtern führen konnte2.
Denn vor der Ankunft der MissionarInnen kannte die einheimische Bevölkerung ein System von höheren und niederen Gottheiten, die sie sich als genderneutral vorstellte. Auch die AhnInnen, die in diese spirituelle Struktur eingebunden waren, wurden mit einem geschlechtsneutralen Plural bezeichnet. Die „Priesterfiguren“3, die es in der Setswana-Kultur gab, konnten sowohl männlich als auch weiblich sein; Frauen hatten in der religiösen Tradition der ethnischen Gruppe der Batswana die Möglichkeit, ihre spirituellen Fähigkeiten in die Gemeinschaft einzubringen und sich mit göttlichen Wesen zu identifizieren und in Beziehung zu setzen.
Durch die Mission und die Einführung einer ins Setswana übersetzten Bibel wurde Modimo, die ehemals geschlechtsneutrale höchste Gottheit, vermännlicht und mit dem biblischen Vatergott identifiziert. Die niederen Gottheiten wurden zu Dämonen erklärt, und die priesterlichen Rollen und Funktionen, die vorher beiden Geschlechtern offenstanden, in die Nähe eines Hexenkultes gerückt. Auf diese Weise veränderte der Kolonialismus die Geschlechterbeziehungen auf drastische Weise:
„Der koloniale Prozess entfremdete die Batswana von ihren kulturellen Machtsymbolen und drängte ganz besonders die eingeborenen Frauen an den Rand; die Männer konnten sich zumindest mit Modimo, dem Gottvater identifizieren, und mit seinem Sohn, der das Oberhaupt der Kirche ist, so wie die Männer die Oberhäupter der Familie sind (Eph 5,22Eph 5,22 ).“4
Diese theologisch-biblische Unterordnung von (männlichem) Gott und Dämonen, Männern und Frauen, Ehemännern und Ehefrauen wurde in der kolonialen Praxis durch Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen, Wirtschaftsstrukturen und Handelssysteme, die nach europäischem Vorbild patriarchal organisiert waren, verstärkt. Auf diese Weise paarte sich die essentialistische Gottesauffassung eurozentrischer Theologie mit einem hierarchischen Geschlechterdualismus und der patriarchalen Organisation des Alltags zu einer fatalen ↗ epistemischen Gewalt, deren Opfer vor allem Frauen waren.
→ KwokKwok, Pui-lan Pui-lan nennt weitere Beispiele aus Asien und Afrika dafür, wie gesellschaftliche und kulturelle Geschlechterverhältnisse durch den Kolonialismus verschlechtert wurden5. Die von ihr zitierte philippinische Ordensfrau und Theologin Mary John MananzanMananzan, Mary John beschreibt die drastischen Auswirkungen der katholischen spanischen Mission auf den Philippinen für die Rolle der Frauen in der Gesellschaft und ihr Selbstverständnis:
„Im 16. Jahrhundert brachte Spanien das Christentum und die westliche Zivilisation mit ihrer patriarchalen Prägung in die Philippinen. Die gleiche frauenfeindliche Grundstimmung, die in der westlichen Kirche herrschte, wurde auf die Inseln mitgebracht.“6
Während Frauen auf den Philippinen vor der Ankunft der MissionarInnen weitgehend gleiche Rechte und gesellschaftliches Ansehen genossen wie Männer, wurden ihre Aufgaben durch den Kolonialismus auf den Bereich des familiären Haushalts beschränkt und ihre gesellschaftliche Teilhabe massiv beschnitten. Die Begründungen mit biblischen und theologischen Argumenten lagen der europäischen Kultur der Zeit entsprechend auf der Hand.
Für die bolivianische Theologin Cecilia TitizanoTitizano, Cecilia „haben indigene Frauen unter der kolonialen Zivilisationsmission furchtbare Gewalt erlitten“7, da koloniale Ausbeutung und sexuelle Gewalt mit einer Dämonisierung indigener Kosmovision einherging, die weibliche Gottheiten sowie Lebenserfahrungen und Weisheit von Frauen gleichermaßen abwertete. Der Einsatz für die Würde und die Rechte der Frauen erfordert es für Titizano daher, Herausforderung des patriarchalen christlichen Vatergottesdas patriarchale christliche Gottesbild des Vatergottes herauszufordern.
Stattdessen verweist sie auf die vorkoloniale weibliche Gottheit der Mama Pacha (oder Pachamama) als einer Identifikationsfigur sowohl für weibliche als auch für indigene Erfahrungswelt. Als ‚Erd-Mutter‘ (eine mögliche Übersetzung des andinen ‚Mama Pacha‘) integriert sie auch agrarische und ökologische Welt- und Schöpfungserfahrung. TitizanoTitizano, Cecilia beansprucht nicht, den christlichen Vatergott durch Pachamama zu ersetzen, sondern macht auf die Chancen eines ganzheitlicheren Gottesbildes aufmerksam und beschreibt die Zerstörungen, die durch die koloniale Mission angerichtet wurden.
Eine andere postkoloniale Strategie der Wiederaneignung der weiblichen Aspekte der Gottheit beschreibt der peruanisch-mexikanische Theologe und Anthropologe Héctor LaportaLaporta, Héctor. Seine Feldforschungen in verschiedenen Marienwallfahrtsorten Lateinamerikas zeigten, dass die Figur der Gottesmutter von ihren VerehrerInnen kultisch und im Fest aufgewertet wurde:
„Meine ethnografischen Forschungen bestätigen, dass die Verehrung Unserer Lieben Frau von Guadalupe [in Mexiko] die koloniale Ordnung unterbricht und die Dogmen und die Politik der katholischen Kirche übertritt. Dabei bricht die Verehrung Unserer Lieben Frau von Guadalupe mit den auferlegten kolonialen Werten wie Macht, Rasse, Sprache und untergräbt die katholische Lehre und verlässt die Kontrolle des materiellen Raums der Kirche.“8
Zwar nicht in der liturgischen Sprache, wohl aber in der Festpraxis wird die Gestalt der Guadalupe wie eine Göttin – insbesondere als Verkörperung der altmexikanischen Gottheit Tonantzin – behandelt9. In dieser Praxis werden koloniale Muster durchbrochen. Gleichzeitig werden auch andere gesellschaftliche und kulturelle Werte durch das Fest übertreten. Die Prozession mit der Heiligenfigur und das anschließende Fest, die beide außerhalb des ummauerten kirchlichen Raums stattfinden, interpretiert LaportaLaporta, Héctor als ein Verlassen der kolonialen Ordnung und einen Bruch mit dieser. Selbst der exzessive Alkoholkonsum und die sexuelle Permissivität, die auf diesen Festen erlebt werden können, gelten ihm als Anzeichen eines Bruchs der kolonialen Gesellschaftsordnung, motiviert und unterstützt durch die Wiederaneignung der Göttin: „Maria springt von der offiziellen Bühne und nimmt aktiv an der fiesta teil, in der die Musik, das Trinken, Essen und Flirten ein wichtiger Teil der Feiern sind.“10
Kritisch anzumerken ist jedoch, dass Gewalt gegen Frauen in Lateinamerika häufig auch unmittelbare Folge des massiven Alkoholkonsums nicht zuletzt auf diesen Festen ist. Eine allzu unkritische Bewertung dieser Feiern als Bruch mit der kolonialen Ordnung verbietet sich daher. Dennoch zeigt das Beispiel, wie eine postkoloniale Auseinandersetzung mit religiösen Institutionen und Vorgängen zu einem entscheidenden theologischen Perspektivwechsel beitragen kann.
Diese wenigen Beispiele zu kolonialen und postkolonialen Geschlechterbeziehungen und Strategien ihrer Überwindung können nicht in das komplexe Feld postkolonialer feministischer Theologien oder Studien einführen11. Sie verweisen vorerst nur auf die grundlegende Bedeutung feministischer Kritik im Postkolonialismus. In den folgenden Abschnitten und Kapiteln werden noch mehr Beispiele aus feministischen Perspektiven beschrieben, die weitere wichtige Aspekte zu diesem transversalen Thema beitragen werden12.