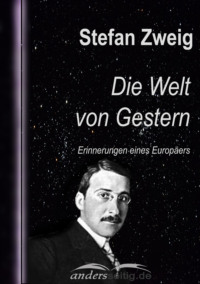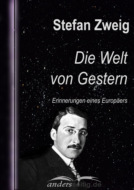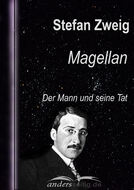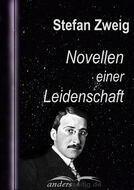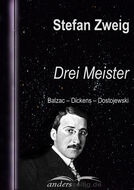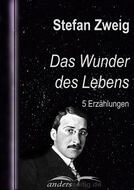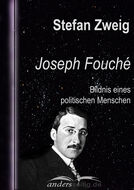Kitabı oku: «Die Welt von Gestern», sayfa 7
Universitas vitae
Endlich war der lang ersehnte Augenblick gekommen, da wir mit dem letzten Jahr des alten Jahrhunderts auch die Tür des verhassten Gymnasiums hinter uns zuschlagen konnten. Nach mühsam bestandener Schlussprüfung – denn was wussten wir von Mathematik, Physik und den scholastischen Materien? – beehrte uns, die wir zu diesem Anlass schwarze feierliche Bratenröcke anziehen mussten, der Schuldirektor mit einer schwungvollen Rede. Wir seien nun erwachsen und sollten durch Fleiß und Tüchtigkeit unserem Vaterlande Ehre machen. Damit war eine achtjährige Kameradschaft zersprengt, wenige meiner Gefährten auf der Galeere habe ich seitdem wiedergesehen. Die meisten von uns inskribierten sich an der Universität, und neidvoll blickten uns diejenigen nach, die sich mit anderen Berufen und Beschäftigungen abfinden mussten.
Denn die Universität hatte in jenen verschollenen Zeiten in Österreich noch einen besonderen, romantischen Nimbus; Student zu sein, gewährte gewisse Vorrechte, die den jungen Akademiker weit über alle Altersgenossen privilegierten; diese antiquarische Sonderbarkeit dürfte in außerdeutschen Ländern wenig bekannt und darum in ihrer Absurdität und Unzeitgemäßheit einer Erklärung bedürftig sein. Unsere Universitäten waren meist noch im Mittelalter gegründet worden, zu einer Zeit also, da Beschäftigung mit den gelehrten Wissenschaften als etwas Außerordentliches galt, und um junge Menschen zum Studium heranzulocken, verlieh man ihnen gewisse Standesvorrechte. Die mittelalterlichen Scholaren unterstanden nicht dem gewöhnlichen Gericht, durften in ihren Collegien nicht von den Bütteln gesucht oder belästigt werden, sie trugen besondere Tracht, hatten das Recht, sich ungestraft zu duellieren und waren als eine geschlossene Gilde mit eigenen Sitten oder Unsitten anerkannt. Im Lauf der Zeit und mit der zunehmenden Demokratisierung des öffentlichen Lebens, als alle andern mittelalterlichen Gilden und Zünfte sich auflösten, verlor sich in ganz Europa diese Vorrechtsstellung der Akademiker; nur in Deutschland und in dem deutschen Österreich, wo das Klassenbewusstsein immer über das demokratische die Oberhand behielt, hingen die Studenten zäh an diesen längst sinnlos gewordenen Vorrechten und bauten sie sogar zu einem eigenen studentischen Kodex aus. Der deutsche Student legte sich vor allem eine besondere Art studentischer ›Ehre‹ neben der bürgerlichen und allgemeinen zu. Wer ihn beleidigte, musste ihm ›Satisfaktion‹ geben, das heißt, mit der Waffe im Duell entgegentreten, sofern er sich als ›satisfaktionsfähig‹ erwies. ›Satisfaktionsfähig‹ wiederum war nun nach dieser selbstgefälligen Bewertung nicht etwa ein Kaufmann oder ein Bankier, sondern nur ein akademisch Gebildeter und Graduierter oder ein Offizier – kein anderer unter den Millionen konnte der besonderen Art ›Ehre‹ teilhaftig werden, mit einem solchen bartlosen dummen Jungen die Klinge zu kreuzen. Anderseits musste man, um als ›richtiger‹ Student zu gelten, seine Mannhaftigkeit ›bewiesen‹ haben, das heißt, möglichst viele Duelle bestanden haben und sogar die Wahrzeichen dieser Heldentaten als ›Schmisse‹ im Gesicht tragen; blanke Wangen und eine nicht eingehackte Nase waren eines echt germanischen Akademikers unwürdig. So sahen sich die Couleurstudenten, das heißt solche, die einer Farben tragenden Verbindung angehörten, genötigt, um immer neue ›Partien schlagen‹ zu können, sich gegenseitig und andere völlig friedfertige Studenten und Offiziere unablässig zu provozieren. In den ›Verbindungen‹ wurde auf dem Fechtboden jeder neue Student für diese würdige Haupttätigkeit ›eingepaukt‹ und auch sonst in die Gebräuche des Burschenschaftswesens eingeweiht. Jeder ›Fuchs‹, das heißt jeder Neuling, wurde einem Korpsbruder zugeteilt, dem er sklavischen Gehorsam zu leisten hatte und der ihn dafür in den edlen Künsten des ›Komments‹ unterwies, die da waren: bis zum Erbrechen zu saufen, einen schweren Humpen Bier in einem Satz bis zur Nagelprobe (bis zum letzten Tropfen) zu leeren, um so glorreich zu erhärten, dass er kein ›schlapper Bursche‹ sei, oder Studentenlieder im Chor zu brüllen und im Gänsemarsch nachts durch die Straßen randalierend die Polizei zu verhöhnen. All das galt als ›männlich‹, als ›studentisch‹, als ›deutsch‹, und wenn die Burschenschaften mit ihren wehenden Fahnen, bunten Kappen und Bändern samstags zum ›Bummel‹ aufzogen, fühlten sich diese einfältigen, durch ihr eigenes Treiben in einen sinnlosen Hochmut getriebenen Jungen als die wahren Vertreter der geistigen Jugend. Mit Verachtung sahen sie auf den ›Pöbel‹ herab, der diese akademische Kultur und deutsche Männlichkeit nicht gebührend zu würdigen verstand.
Für einen kleinen Provinzgymnasiasten, der als grüner Junge nach Wien kam, mochte wohl diese Art forscher und ›fröhlicher Studentenzeit‹ als Inbegriff aller Romantik gelten. Noch jahrzehntelang sahen in der Tat die bejahrten Notare und Ärzte in ihren Dörfern weinselig gerührt empor zu den in ihrem Zimmer gekreuzt aufgehängten Schlägern und bunten Attrappen, stolz trugen sie ihre Schmisse als Kennzeichen ihres ›akademischen‹ Standes. Auf uns dagegen wirkte dieses einfältige und brutale Treiben einzig abstoßend, und wenn wir einer dieser bebänderten Horden begegneten, wichen wir weise um die Ecke; denn uns, denen individuelle Freiheit das Höchste bedeutete, zeigte diese Lust an der Aggressivität und gleichzeitige Lust an der Hordenservilität zu offenbar das Schlimmste und Gefährlichste des deutschen Geistes. Überdies wussten wir, dass hinter dieser künstlich mumifizierten Romantik sich sehr schlau berechnete, praktische Ziele versteckten, denn die Zugehörigkeit zu einer ›schlagenden‹ Burschenschaft sicherte jedem Mitglied die Protektion der ›alten Herren‹ dieser Verbindung in den hohen Ämtern und erleichterte die spätere Karriere. Von den Bonner ›Borussen‹ führte der einzig sichere Weg in die deutsche Diplomatie, von den katholischen Verbindungen in Österreich zu den guten Pfründen der herrschenden christlich-sozialen Partei, und die meisten dieser ›Helden‹ wussten genau, dass ihre farbigen Bänder ihnen in Hinkunft ersetzten mussten, was sie an eindringlichen Studien versäumt, und dass ein paar Schmisse auf der Stirn ihnen bei einer Anstellung einmal förderlicher sein konnten, als was hinter dieser Stirn war. Schon der bloße Anblick dieser rüden, militarisierten Rotten, dieser zerhackten und frech provozierenden Gesichter hat mir den Besuch der Universitätsräume verleidet; auch die anderen, wirklich lernbegierigen Studenten vermieden, wenn sie in die Universitätsbibliothek gingen, die Aula und wählten lieber die unscheinbare Hintertür, um jeder Begegnung mit diesen tristen Helden zu entgehen.
Dass ich an der Universität studieren sollte, war im Rate der Familie von je beschlossen gewesen. Aber für welche Fakultät mich entscheiden? Meine Eltern ließen mir die Wahl vollkommen frei. Mein älterer Bruder war bereits in das väterliche Industrieunternehmen eingetreten, demgemäß lag für den zweiten Sohn keinerlei Eile vor. Es handelte sich schließlich doch nur darum, der Familienehre einen Doktortitel zu sichern, gleichgültig welchen. Und sonderbarerweise war die Wahl mir ebenso gleichgültig. An sich interessierte mich, der ich meine Seele längst der Literatur verschrieben, keine einzige der fachmäßig dozierten Wissenschaften, ich hatte sogar ein geheimes, noch heute nicht verschwundenes Misstrauen gegen jeden akademischen Betrieb. Für mich ist Emersons Axiom, dass gute Bücher die beste Universität ersetzen, unentwegt gültig geblieben, und ich bin noch heute überzeugt, dass man ein ausgezeichneter Philosoph, Historiker, Philologe, Jurist und was immer werden kann, ohne je eine Universität oder sogar ein Gymnasium besucht zu haben. Zahllose Male habe ich im praktischen Leben bestätigt gefunden, dass Antiquare oft besser Bescheid wissen über Bücher als die zuständigen Professoren, Kunsthändler mehr verstehen als die Kunstgelehrten, dass ein Großteil der wesentlichen Anregungen und Entdeckungen auf allen Gebieten von Außenseitern stammt. So praktisch, handlich und heilsam der akademische Betrieb für die Durchschnittsbegabung sein mag, so entbehrlich scheint er mir für individuell produktive Naturen, bei denen er sich sogar im Sinn einer Hemmung auszuwirken vermag. Insbesondere an einer Universität wie der unsern in Wien mit ihren sechs- oder siebentausend Studenten, die durch Überfüllung den so fruchtbaren persönlichen Kontakt zwischen Lehrern und Schülern von vornherein hemmte und überdies durch allzu große Treue zu ihrer Tradition gegen die Zeit zurückgeblieben war, sah ich nicht einen einzigen Mann, der mich für seine Wissenschaft hätte faszinieren können. So wurde das eigentliche Kriterium meiner Wahl nicht, welches Fach mich am meisten innerlich beschäftigen würde, sondern im Gegenteil, welches mich am wenigsten beschweren und mir das Maximum an Zeit und Freiheit für meine eigentliche Leidenschaft verstatten könnte. Ich entschloss mich schließlich für Philosophie – oder vielmehr ›exakte‹ Philosophie, wie es bei uns nach dem alten Schema hieß –, aber wahrhaftig nicht aus einem Gefühl innerer Berufung, denn meine Fähigkeiten zu rein abstraktem Denken sind gering. Gedanken entwickeln sich bei mir ausnahmslos an Gegenständen, Geschehnissen und Gestalten, alles rein Theoretische und Metaphysische bleibt mir unerlernbar. Immerhin war hier das rein stoffliche Gebiet am eingeschränktesten, der Besuch von Vorlesungen oder Seminaren in der ›exakten‹ Philosophie am leichtesten zu umgehen. Alles, was not tat, war, am Ende des achten Semesters eine Dissertation einzureichen und einige Prüfungen zu machen. So legte ich mir von vornherein eine Zeiteinteilung zurecht: drei Jahre um das Universitätsstudium mich überhaupt nicht bekümmern! Dann in dem einen letzten Jahr in scharfer Anstrengung den scholastischen Stoff bewältigen und irgendeine Dissertation rasch fertigmachen! Dann hatte die Universität mir gegeben, was einzig ich von ihr wollte: ein paar Jahre voller Freiheit für mein Leben und für die Bemühung in der Kunst: universitas vitae.
Überblicke ich mein Leben, so kann ich mich an wenige so glückliche Augenblicke erinnern wie jene ersten dieser Universitätszeit ohne Universität. Ich war jung und hatte darum noch nicht das Gefühl der Verantwortung, Vollendetes leisten zu müssen. Ich war leidlich unabhängig, der Tag hatte vierundzwanzig Stunden, und alle gehörten mir. Ich konnte lesen und arbeiten, was ich wollte, ohne irgend jemandem Rechenschaft schuldig zu sein, die Wolke der akademischen Prüfung rührte noch nicht an den hellen Horizont, denn wie lang sind drei Jahre, gemessen am neunzehnten Lebensjahr, wie reich, wie füllig und wie voll von Überraschungen und Geschenken kann man sie gestalten!
Das erste, was ich begann, war, meine Gedichte in einer – wie ich meinte: unerbittlichen – Auslese zu sammeln. Ich schäme mich nicht, zu bekennen, dass mir eben absolvierten neunzehnjährigen Gymnasiasten als der süßeste Geruch auf Erden, süßer als das Öl der Rosen von Schiras, damals jener der Druckerschwärze erschien; jede Annahme eines Gedichts in irgendeiner Zeitung hatte meinem von Natur aus sehr schwachbeinigen Selbstbewusstsein einen neuen Anschwung gegeben. Sollte ich nicht jetzt schon ansetzen zu dem entscheidenden Sprunge und die Veröffentlichung eines ganzen Bandes versuchen? Der Zuspruch meiner Kameraden, die mehr an mich glaubten als ich selbst, entschied. Ich sandte das Manuskript verwegen genug gerade an jenen Verlag, der damals der repräsentative für deutsche Lyrik war, Schuster & Löffler, die Verleger Liliencrons, Dehmels, Bierbaums, Momberts, jener ganzen Generation, die zugleich mit Rilke und Hofmannsthal die neue deutsche Lyrik geschaffen. Und – Wunder und Zeichen! – es kamen einer nach dem andern jene unvergesslichen Glücksaugenblicke, wie sie sich im Leben eines Schriftstellers auch nach den größten Erfolgen nicht mehr wiederholen: es kam ein Brief mit dem Signet des Verlags, den man unruhig in Händen hielt, ohne den Mut, ihn zu öffnen. Es kam die Sekunde, wo man angehaltenen Atems las, dass der Verlag sich entschlossen habe, das Buch zu veröffentlichen und sich sogar das Vorrecht für die folgenden ausbedinge. Es kam das Paket mit den ersten Korrekturen, das man mit maßloser Erregung aufschnürte, um die Type zu sehen, den Satzspiegel, die embryonale Gestalt des Buchs, und dann nach wenigen Wochen das Buch selbst, die ersten Exemplare, die man nicht müde wurde zu beschauen, zu betasten, zu vergleichen, einmal und noch einmal und noch einmal. Und dann die kindische Wanderung zu den Buchläden, ob sie schon Exemplare in der Auslage hätten und ob sie in der Mitte des Ladens prangten oder bescheiden am Rande sich versteckten. Und dann das Warten auf die Briefe, auf die ersten Kritiken, auf die erste Antwort aus dem Unbekannten, dem Unberechenbaren – alle diese Spannungen, Erregungen, Begeisterungen, um die ich jeden jungen Menschen heimlich beneide, der sein erstes Buch in die Welt wirft. Aber dies mein Entzücken war nur eine Verliebtheit in den ersten Augenblick und keineswegs Selbstgefälligkeit. Wie ich bald selbst über diese frühen Verse dachte, ist durch die einfache Tatsache bezeugt, dass ich nicht nur diese ›Silbernen Saiten‹ (dies der Titel jenes verschollenen Erstlings) nie mehr neu drucken, sondern kein einziges Gedicht daraus in meine ›Gesammelten Gedichte‹ aufnehmen ließ. Es waren Verse unbestimmter Vorahnung und unbewussten Nachfühlens, nicht aus eigenem Erlebnis entstanden, sondern aus sprachlicher Leidenschaft. Immerhin zeigten sie eine gewisse Musikalität und genug Formgefühl, um sie interessierten Kreisen bemerkbar zu machen, und ich konnte mich über mangelnde Aufmunterung nicht beklagen. Liliencron und Dehmel, die damals führenden lyrischen Dichter, gaben dem Neunzehnjährigen herzliche und schon kameradschaftliche Anerkennung, Rilke, der so sehr von mir Vergötterte, sandte mir als Gegengabe für das ›so schön gegebene Buch‹ einen ›dankbar‹ gewidmeten Sonderdruck seiner jüngsten Gedichte, den ich als eine der kostbarsten Erinnerungen meiner Jugend aus den Trümmern Österreichs noch nach England herübergerettet habe (wo mag er heute sein?). Gespenstisch freilich mutete es mich zuletzt an, dass diese erste freundschaftliche Gabe Rilkes an mich – die erste von vielen – vierzig Jahre alt war und die vertraute Schrift mich aus dem Totenreiche grüßte. Die unvermutetste Überraschung von allen jedoch war, dass Max Reger, neben Richard Strauss der größte damals lebende Komponist, sich an mich um die Erlaubnis wandte, sechs Gedichte aus diesem Bande vertonen zu dürfen; wie oft habe ich seitdem davon eines oder das andere in Konzerten gehört – meine eigenen, von mir selbst längst vergessenen und verworfenen Verse durch die brüderliche Kunst eines Meisters hinübergetragen über die Zeit.
Diese unverhofften Zustimmungen, die auch von freundlichen öffentlichen Kritiken begleitet waren, zeitigten immerhin die Wirkung, mich zu einem Schritt zu ermutigen, den ich bei meinem unheilbaren Misstrauen gegen mich selbst nie oder zumindest nicht so frühzeitig unternommen hätte. Schon in der Gymnasialzeit hatte ich außer Gedichten kleinere Novellen und Essays in den literarischen Zeitschriften der ›Moderne‹ veröffentlicht, nie aber mich unterfangen, einen jener Versuche einer mächtigen und weitverbreiteten Zeitung anzubieten. In Wien gab es eigentlich nur ein einziges publizistisches Organ hohen Ranges, die ›Neue Freie Presse‹, die durch ihre vornehme Haltung, ihre kulturelle Bemühtheit und ihr politisches Prestige für die ganze österreichisch-ungarische Monarchie etwa das gleiche bedeutete wie die ›Times‹ für die englische Welt und der ›Temps‹ für die französische; selbst keine der reichsdeutschen Zeitungen war so sehr um ein repräsentatives kulturelles Niveau bemüht. Ihr Herausgeber, Moritz Benedikt, ein Mann von phänomenaler Organisationsgabe und unermüdlichem Fleiß, setzte seine ganze, geradezu dämonische Energie daran, auf dem Gebiete der Literatur und Kultur alle deutschen Zeitungen zu übertreffen. Wenn er von einem namhaften Autor etwas begehrte, wurden keine Kosten gescheut, zehn und zwanzig Telegramme hintereinander an ihn gesandt, jedes Honorar im voraus bewilligt; die Feiertagsnummern zu Weihnachten und Neujahr stellten mit ihren literarischen Beilagen ganze Bände mit den größten Namen der Zeit dar: Anatole France, Gerhart Hauptmann, Ibsen, Zola, Strindberg und Shaw fanden sich bei dieser Gelegenheit zusammen in diesem Blatte, das für die literarische Orientierung der ganzen Stadt, des ganzen Landes unermesslich viel getan hat. Selbstverständlich ›fortschrittlich‹ und liberal in seiner Weltanschauung, solid und vorsichtig in seiner Haltung, repräsentierte dieses Blatt in vorbildlicher Art den hohen kulturellen Standard des alten Österreich.
Dieser Tempel des ›Fortschritts‹ barg nun noch ein besonderes Heiligtum, das sogenannte ›Feuilleton‹, das wie die großen Pariser Tageszeitungen, der ›Temps‹ und das ›Journal des Débats‹, die gediegensten und vollendetsten Aufsätze über Dichtung, Theater, Musik und Kunst ›unter dem Strich‹ in deutlicher Sonderung von dem Ephemeren der Politik und des Tages publizierte. Hier durften nur die Autoritäten, die schon lange Bewährten zu Wort kommen. Einzig die Gediegenheit des Urteils, vergleichende Erfahrung vieler Jahre und vollendete Kunstform konnten einen Autor nach Jahren der Erprobtheit an diese heilige Stelle berufen. Ludwig Speidel, ein Meister der Kleinkunst, Eduard Hanslick hatten für Theater und Musik dort die gleiche päpstliche Autorität wie Sainte-Beuve in Paris in seinen ›Lundis‹; ihr Ja oder Nein entschied für Wien den Erfolg eines Werks, eines Theaterstücks, eines Buches und damit oft eines Menschen. Jeder dieser Aufsätze war das jeweilige Tagesgespräch der gebildeten Kreise, sie wurden diskutiert, kritisiert, bewundert oder befeindet, und wenn einmal ein neuer Name inmitten der längst respektvoll anerkannten ›Feuilletonisten‹ auftauchte, bedeutete dies ein Ereignis. Von der jüngeren Generation hatte einzig Hofmannsthal mit einigen seiner herrlichen Aufsätze dort gelegentlich Eingang gefunden; sonst mussten jüngere Autoren sich beschränken, rückwärts im Literaturblatt versteckt, sich einzuschmuggeln. Wer auf der ersten Seite schrieb, hatte seinen Namen für Wien in Marmor gegraben.
Wie ich die Courage fand, eine kleine dichterische Arbeit der ›Neuen Freien Presse‹, dem Orakel meiner Väter und der Heimstatt der siebenfach Gesalbten, anzubieten, ist mir heute nicht mehr fassbar. Aber schließlich, mehr als eine Zurückweisung konnte mir nicht widerfahren. Der Redakteur des Feuilletons empfing dort bloß an einem Tage der Woche zwischen zwei und drei Uhr, da durch den regelmäßigen Turnus der berühmten, festangestellten Mitarbeiter nur ganz selten Raum für die Arbeit eines Außenseiters war. Nicht ohne Herzklopfen stieg ich die kleine Wendeltreppe zu dem Büro empor und ließ mich anmelden. Nach einigen Minuten kam der Diener zurück, der Herr Feuilletonredakteur lasse bitten, und ich trat in das enge, schmale Zimmer.
Der Feuilletonredakteur der ›Neuen Freien Presse‹ hieß Theodor Herzl, und es war der erste Mann welthistorischen Formats, dem ich in meinem Leben gegenüberstand – freilich ohne selbst zu wissen, welch ungeheure Wendung seine Person im Schicksal des jüdischen Volkes und in der Geschichte unserer Zeit zu erschaffen berufen war. Seine Stellung war damals noch zwiespältig und unübersehbar. Er hatte mit dichterischen Versuchen begonnen, früh eine blendende journalistische Begabung gezeigt und war zuerst als Pariser Korrespondent, dann als Feuilletonist der ›Neuen Freien Presse‹ der Liebling des Wiener Publikums geworden. Seine Aufsätze, heute noch bezaubernd durch ihren Reichtum an scharfen und oft weisen Beobachtungen, ihre stilistische Anmut, ihren edlen Charme, der selbst im Heiteren wie Kritischen nie die eingeborene Noblesse verlor, waren das Kultivierteste, was man sich im Journalistischen erdenken konnte, und das Entzücken einer Stadt, die für Subtiles den Sinn sich geschult hatte. Auch im Burgtheater hatte er mit einem Stück Erfolg gehabt, und nun war er ein angesehener Mann, vergöttert von der Jugend, geachtet von unseren Vätern, bis eines Tages das Unerwartete geschah. Das Schicksal weiß immer sich einen Weg zu finden, um den Menschen, den es braucht für seine geheimen Zwecke, heranzuholen, auch wenn er sich verbergen will.
Theodor Herzl hatte in Paris ein Erlebnis gehabt, das ihm die Seele erschütterte, eine jener Stunden, die eine ganze Existenz verändern: er hatte als Korrespondent der öffentlichen Degradierung Alfred Dreyfus' beigewohnt, hatte gesehen, wie man dem bleichen Mann die Epauletten abriß, während er laut ausrief: »Ich bin unschuldig.« Und er hatte bis ins innerste Herz gewusst in dieser Sekunde, dass Dreyfus unschuldig war und dass er diesen grauenhaften Verdacht des Verrats einzig auf sich geladen dadurch, dass er Jude war. Nun hatte Theodor Herzl in seinem aufrechten männlichen Stolz schon als Student unter dem jüdischen Schicksal gelitten – vielmehr, er hatte es in seiner ganzen Tragik schon vorausgelitten zu einer Zeit, da es kaum ein ernstliches Schicksal zu sein schien, dank seines prophetischen Instinkts der Ahnung. Mit dem Gefühl, zum Führer geboren zu sein, wozu ihn seine prachtvoll imposante äußere Erscheinung nicht minder als die Großzügigkeit seines Denkens und seine Weltkenntnis berechtigte, hatte er damals den fantastischen Plan gefasst, dem jüdischen Problem ein für allemal ein Ende zu bereiten, und zwar durch Vereinigung des Judentums mit dem Christentum auf dem Wege freiwilliger Massentaufe. Immer dramatisch denkend, hatte er sich ausgemalt, wie er in langem Zuge die Tausende und Abertausende der Juden Österreichs zur Stefanskirche führen würde, um dort in einem vorbildlich symbolischen Akt das gejagte, heimatlose Volk für immer vom Fluch der Absonderung und des Hasses zu erlösen. Bald hatte er das Unausführbare dieses Plans erkannt, Jahre eigener Arbeit hatten ihn vom Urproblem seines Lebens, das zu ›lösen‹ er als seine wahre Aufgabe erkannte, abgelenkt; jetzt aber, in dieser Sekunde der Degradierung Dreyfus', fuhr der Gedanke der ewigen Ächtung seines Volkes wie ein Dolch ihm in die Brust. Wenn Absonderung unvermeidlich ist, sagte er sich, dann eine vollkommene! Wenn Erniedrigung unser Schicksal immer wieder wird, dann ihm begegnen durch Stolz. Wenn wir leiden an unserer Heimatlosigkeit, dann eine Heimat uns selbst aufbauen! So veröffentlichte er seine Broschüre ›Der Judenstaat‹, in der er proklamierte, alle assimilatorische Angleichung, alle Hoffnung auf totale Toleranz sei für das jüdische Volk unmöglich. Es müsse eine neue, eine eigene Heimat gründen in seiner alten Heimat Palästina.
Ich saß, als diese knappe, aber mit der Durchschlagskraft eines stählernen Bolzens versehene Broschüre erschien, noch im Gymnasium, kann mich aber der allgemeinen Verblüffung und Verärgerung der Wiener bürgerlich-jüdischen Kreise wohl erinnern. Was ist, sagten sie unwirsch, in diesen sonst so gescheiten, witzigen und kultivierten Schriftsteller gefahren? Was treibt und schreibt er für Narrheiten? Warum sollen wir nach Palästina? Unsere Sprache ist deutsch und nicht hebräisch, unsere Heimat das schöne Österreich. Geht es uns nicht vortrefflich unter dem guten Kaiser Franz Joseph? Haben wir nicht unser anständiges Fortkommen, unsere gesicherte Stellung? Sind wir nicht gleichberechtigte Staatsangehörige, nicht eingesessene und treue Bürger dieses geliebten Wien? Und leben wir nicht in einer fortschrittlichen Zeit, welche alle konfessionellen Vorurteile in ein paar Jahrzehnten beseitigen wird? Warum gibt er, der doch als Jude spricht und dem Judentum helfen will, unseren bösesten Feinden Argumente in die Hand und versucht uns zu sondern, da doch jeder Tag uns näher und inniger der deutschen Welt verbindet? Die Rabbiner ereiferten sich von den Kanzeln, der Leiter der ›Neuen Freien Presse‹ verbot, das Wort Zionismus in seiner ›fortschrittlichen‹ Zeitung auch nur zu erwähnen. Der Thersites der Wiener Literatur; der Meister des giftigen Spotts, Karl Kraus, schrieb eine Broschüre ›Eine Krone für Zion‹, und wenn Theodor Herzl das Theater betrat, murmelte man spöttelnd durch alle Reihen: »Seine Majestät ist erschienen!«
Im ersten Augenblick konnte Herzl sich missverstanden fühlen; Wien, wo er sich durch seine jahrelange Beliebtheit am sichersten vermeinte, verließ und verlachte ihn sogar. Aber dann dröhnte Antwort mit solcher Wucht und Ekstase so plötzlich zurück, dass er beinahe erschrak, eine wie mächtige, ihn weit überwachsende Bewegung er mit seinen paar Dutzend Seiten in die Welt gerufen. Sie kam freilich nicht von den behaglich lebenden, wohlsituierten bürgerlichen Juden des Westens, sondern von den riesigen Massen des Ostens, von dem galizischen, dem polnischen, dem russischen Gettoproletariat. Ohne es zu ahnen, hatte Herzl mit seiner Broschüre den unter der Asche der Fremde glühenden Kern des Judentums zum Aufflammen gebracht, den tausendjährigen messianischen Traum der in den heiligen Büchern bekräftigten Verheißung der Rückkehr ins Gelobte Land – diese Hoffnung und zugleich religiöse Gewissheit, welche einzig jenen getretenen und geknechteten Millionen das Leben noch sinnvoll machte. Immer, wenn einer – Prophet oder Betrüger – in den zweitausend Jahren des Golus an diese Saite gerührt, war die ganze Seele des Volkes in Schwingung gekommen, nie aber so gewaltig wie diesmal, nie mit solchem brausenden, rauschenden Widerhall. Mit ein paar Dutzend Seiten hatte ein einzelner Mann eine verstreute, verzwistete Masse zur Einheit geformt.
Dieser erste Augenblick, solange die Idee noch traumhaft ungewisse Formen hatte, war bestimmt, der glücklichste in Herzls kurzem Leben zu sein. Sobald er begann, die Ziele im realen Raum zu fixieren, die Kräfte zu binden, musste er erkennen, wie disparat dieses sein Volk geworden war unter den verschiedenen Völkern und Schicksalen, hier die religiösen, dort die freigeistigen, hier die sozialistischen, dort die kapitalistischen Juden, in allen Sprachen gegeneinander eifernd und alle unwillig, sich einer einheitlichen Autorität zu fügen. In jenem Jahr 1901, da ich ihn zum ersten Male sah, stand er mitten im Kampf und war vielleicht auch mit sich selbst im Kampf; noch glaubte er dem Gelingen nicht genug, um die Stellung, die ihn und seine Familie ernährte, aufzugeben. Noch musste er sich teilen in den kleinen journalistischen Dienst und die Aufgabe, die sein wahres Leben war. Noch war es der Feuilletonredakteur Theodor Herzl, der mich damals empfing.
Theodor Herzl erhob sich, um mich zu begrüßen, und unwillkürlich empfand ich, dass das höhnisch gemeinte Witzwort ›der König von Zion‹ etwas Wahres traf: er sah wirklich königlich aus mit seiner hohen, freien Stirn, seinen klaren Zügen, seinem langen, fast bläulich-schwarzen Priesterbart und seinen tiefblauen, melancholischen Augen. Die weiten, etwas theatralischen Gesten wirkten bei ihm nicht erkünstelt, weil sie durch eine natürliche Hoheit bedingt waren, und es hätte nicht dieser besonderen Gelegenheit bedurft, um ihn mir imposant erscheinen zu lassen. Selbst vor dem abgenutzten, mit Papier überhäuften Schreibtisch in dieser kläglich engen, einfenstrigen Redaktionsstube wirkte er wie ein beduinischer Wüstenscheich; ein wallender weißer Burnus hätte ihn ebenso natürlich gekleidet wie sein sorgfältig geschnittener, sichtlich nach Pariser Muster gehaltener schwarzer Cutaway. Nach einer kurzen, absichtlich eingeschalteten Pause – er liebte diese kleinen Effekte, wie ich später oft bemerkte, und hatte sie wohl im Burgtheater studiert – reichte er mir herablassend und doch durchaus gütig die Hand. Auf den Sessel neben sich weisend, fragte er: »Ich glaube, ich habe Ihren Namen schon irgendwo gehört oder gelesen. Gedichte, nicht wahr?« Ich musste zustimmen. »Nun«, lehnte er sich zurück. »Was bringen Sie mir?«
Ich berichtete, dass ich ihm gerne eine kleine Prosaarbeit vorgelegt hätte, und überreichte ihm das Manuskript. Er sah das Titelblatt an, schlug über bis zur letzten Seite, um den Umfang zu messen, lehnte sich dann noch tiefer in den Sessel zurück. Und zu meinem Erstaunen (ich hatte es nicht erwartet) bemerkte ich, dass er bereits das Manuskript zu lesen begonnen hatte. Er las langsam, immer ein Blatt zurücklegend, ohne aufzublicken. Als er das letzte Blatt gelesen hatte, faltete er langsam das Manuskript zusammen, tat es umständlich und noch immer ohne mich anzusehen in ein Couvert und schrieb mit Blaustift einen Vermerk darauf. Dann erst, nachdem er mich mit diesen geheimnisvollen Machinationen genügend lang in Spannung gehalten, hob er den schweren, dunklen Blick zu mir auf und sagte mit bewusster, langsamer Feierlichkeit: »Ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass Ihre schöne Arbeit für das Feuilleton der ›Neuen Freien Presse‹ angenommen ist.« Es war, als ob Napoleon auf dem Schlachtfelde einem jungen Sergeanten das Ritterkreuz der Ehrenlegion anheftete.
Dies scheint an sich eine kleine, belanglose Episode. Aber man muss Wiener und Wiener jener Generation sein, um zu verstehen, welchen Ruck nach oben diese Förderung bedeutete. Ich war damit in meinem neunzehnten Jahr über Nacht in eine Prominentenstellung aufgerückt, und Theodor Herzl, der mir von dieser ersten Stunde an gütig zugetan blieb, nutzte gleich einen zufälligen Anlass, um in einem seiner nächsten Aufsätze zu schreiben, man solle in Wien nicht an eine Dekadenz der Kunst glauben. Im Gegenteil, es gebe neben Hofmannsthal jetzt eine Reihe junger Talente, von denen das Beste zu erwarten sei, und er nannte an erster Stelle meinen Namen. Ich habe es immer als besondere Auszeichnung empfunden, dass es ein Mann von der überragenden Bedeutung Theodor Herzls war, der als erster für mich öffentlich an einer weithin sichtbaren und darum verantwortungsvollen Stelle eingetreten ist, und es war für mich ein schwerer Entschluss, mich – scheinbar in Undank – nicht, wie er es gewünscht hätte, tätig und sogar mitführend seiner zionistischen Bewegung anschließen zu können.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.