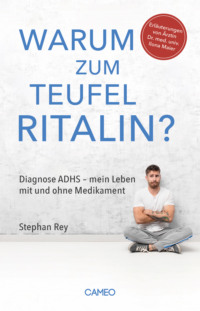Kitabı oku: «Warum zum Teufel Ritalin?», sayfa 3
Schwarzkatholisch
Im Freiamt der 1970er-Jahre wurde Religion mit Drohungen gleichgesetzt, die wie die Jahrhunderte zuvor von einem strafenden Gott kamen. Das kümmerte mich aber kaum. Ich erinnere mich noch gut, dass ich an Ostern immer die gleichen Filme über Jesus und sein Leben vorgesetzt bekam, die mich ängstigten, aber auch seltsam faszinierten. Das Resultat war, dass mich nach dem Ansehen der Filme immer große Ängste plagten. Darum musste ich im Zimmer meiner Schwester schlafen und wurde zusätzlich mit einem Filmverbot für die Zeit während der Ostertage belegt. Klar: Das Spiel sollte sich zu jedem Osterfest genau gleich wiederholen. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche.
Was ich mit dieser Geschichte andeuten möchte: In meinem Elternhaus gab es Regeln und moralische Werte, die uns vermittelt wurden, und unser Verhalten hatte dem Konsens der Gemeinde zu entsprechen. Doch es gab praktisch immer einen Spielraum, der kleine Abweichungen erlaubte. So ließ ich liebend gerne die Schülermesse am Dienstagmorgen sausen, auch wenn es danach alle im Dorf erfuhren. Ausschlafen war eindeutig besser angesagt als morgens um sieben aufzustehen und in die Kirche zu trotten.
Ich erinnere mich nicht an große Standpauken oder an körperliche Züchtigungen im Elternhaus. Die Erwartungshaltung meiner Eltern war auch nicht übertrieben. Dafür bin ich meiner Mutter und meinem Vater noch heute dankbar. Im Großen und Ganzen waren beide tolerant und großzügig. Der Kampf ums tägliche Brot ließ es ihnen oft an Zeit und Energie mangeln, um all unsere Schritte ständig zu überwachen. Die Rollenverteilung war klassisch und jener Zeit geschuldet. Meine Mutter wirkte als Hausfrau, mein Vater brachte das Geld nach Hause. Wir waren stets ordentlich gekleidet und gut genährt. Da sich die Eltern nicht jede Minute um uns kümmern konnten, kamen wir schon früh in den Genuss einiger Freiheiten. Auch solche, von denen manche Kinder im Jahr 2020 nur träumen können. So fiel es auch nicht immer auf, dass ich ein besonders lebhaftes und quirliges Kind war.
Gut bürgerlich
Mein Vater war 1972 mit dem Aufbau seiner Schreinerei beschäftigt. Die ersten Jahre erwiesen sich dabei als besonders beschwerlich. Wie bei vielen selbstständigen Handwerkern üblich, lauerte immer die Gefahr von Auftragsflauten, was konkret bedeutete, dass man die guten Zeiten für Rücklagen nutzen musste, um die mageren Jahre überstehen zu können.
Die schweren Zeiten kannte er aus seiner eigenen Kindheit nur zu gut: Mein Großvater väterlicherseits verstarb früh als mein Vater gerade mal 8 war und die Mutter stand mit den vier Kindern, ein fünftes war unterwegs, alleine da. In jenen Jahren gab es keine Witwenrenten oder anderweitige soziale Auffangnetze, und man kann es aus heutiger Sicht als Wunder betrachten, dass die Kinder nicht verdingt werden mussten. Das war, wie ich später erfuhr, zu weiten Teilen der Dorfgemeinschaft zu verdanken, die der Familie in jeder Hinsicht zur Seite stand. Es hatte aber auch mit der Anpassungsfähigkeit meiner Großmutter zu tun, die mit den Kindern in die Hauswartswohnung in der Schule zog und dort nach dem Rechten sah. Das Geld reichte natürlich bei Weitem nicht. So kam es, dass die sechsköpfige Familie am Sonntagmorgen in den Wald pilgerte, Beeren und Brennholz sammelte und danach schwer bepackt nach Hause zurückkehrte, um rechtzeitig in die nachmittägliche Christenlehre zu gelangen, die im Nachbardorf stattfand.
Mein Vater arbeitete wohl auch deshalb so hart, weil er sich an die eigene beschwerliche Kindheit erinnerte. Er wollte, dass es uns Familienmitgliedern an nichts fehlte. Ich erinnere mich ausschließlich an tolle Geburtstagsfeste und festlichen Weihnachtsfeiern. Wir unternahmen viele Ausflüge, besaßen einen Fernseher und es reichte sogar für ein Auto. Die existenziellen Nöte, die sich mit der Ölkrise Mitte der 1970er-Jahre verschärften, gingen an den Eltern nicht spurlos vorbei und führten innerhalb der Familie zu Spannungen. Wie so oft ging es um das liebe Geld. Mein Vater kritisierte das Haushaltsgeld, das seiner Meinung nach zu hoch war, meine Mutter hielt ihm dafür den «teuren» Schießsport vor. Das alles sorgte für enorme Spannungen, die ich als Kind mit ADHS kaum aushalten konnte. Trotz allem waren Mutter und Vater wild entschlossen, sich einen Traum zu verwirklichen: Sie wollten sich und der Familie ein Haus bauen.
Bis es soweit war, blieben wir in unserem Dorf, wo wir bestens integriert lebten. Meine Mutter hatte Freundinnen, mit denen sie sich regelmäßig traf, und auch mein Vater verfügte über ein gut funktionierendes soziales Umfeld. Ich besuchte während dieser Zeit die erste Klasse. Ziemlich schnell entwickelte ich mich zum Klassenclown, redete viel und störte den Unterricht nachhaltig. Mein Tischnachbar war auch ein bevorzugter Gesprächspartner während der Schulstunde. Zur Strafe musste ich mich immer wieder in die Ecke stellen. Ich schämte mich zwar für mein Label «Klassenclown», aber der Rest der Klasse nahm mir meine Ausreißer nicht übel, denn ich war trotz oder gerade deswegen ihr Liebling. Ich konnte mir das allerdings nie recht erklären, dass man jemanden gernhaben konnte, der sich schämen soll. Aber offenbar fanden die anderen Kinder mein Benehmen belustigend und bereichernd. Solche Vorfälle und die Gründe dafür wurden zwar regelmäßig thematisiert, mein positives Selbstbild, das mir Eltern und Lehrer vermittelten, wurde davon allerdings nicht beeinträchtigt.
In unserer Klasse gab es sieben Schüler, vier Knaben und drei Mädchen. Obwohl unsere Lehrerin noch zwei andere Klassen betreuen musste, hatte sie genügend Zeit und Energiereserven zur Verfügung, um sich um jedes einzelne Kind persönlich zu kümmern. Der Unterricht verlief relativ altmodisch. Es waren die 1970er-Jahre. So etwas wie Frühförderung gab es nicht, und ich erinnere mich auch nicht an Nachhilfeunterricht. Neue Lehrmittel oder moderne Ansätze waren de facto inexistent.
Die Schulstunden gingen für meinen Geschmack recht gemütlich und gemächlich vonstatten. Meinen inneren Turbo konnte ich ja durch permanentes Schwatzen beruhigen. All diese Voraussetzungen schienen mir jedenfalls zu entsprechen, denn meine schulischen Leistungen waren gut. Die Freizeitgestaltung hatte auch nur ein einziges Kriterium zu erfüllen: Sie sollte Spaß machen.
Wälder und Wiesen
Wegen meinem unstillbaren Spaß an der Freude durfte ich viele Stunden hauptsächlich im Freien verbringen. Die nahe gelegenen Wälder, die endlosen Felder und Wiesen waren für mich riesige Spielplätze – sowohl im Frühling, Sommer, Herbst wie auch im Winter. Es gab keine Jahreszeit, in der ich nicht einen oder mehrere Tage draußen verbrachte – ohne dabei eine Leistung erbringen zu müssen, ohne Verhaltensregeln und ohne zeitliche Begrenzung. Mein Bewegungsdrang, meine Abenteuerlust und meine Wildheit fanden in der freien Natur ihre Erfüllung.
Erwachsene haben die Tendenz, nonkonformes Verhalten zu qualifizieren und nicht selten auch zu sanktionieren. Wenn Kinder auf sich allein gestellt sind, tragen Kinder ihren Ungestüm untereinander aus, und so war es auch bei uns. Streitigkeiten und Raufereien fanden ohne Einmischung der Erwachsenen statt und endeten stets in Gelächter und innigen Umarmungen. In Vereinen oder in anderen strukturierten Freizeitaktivitäten fand ich mich hingegen nicht zurecht. Die Blockflöte warf ich nach zwei Musikstunden in die Ecke. Ich war auch ein begeisterter, aber schlechter Fußballspieler. Bereits nach einem Probetraining im Club war meine Karriere als Diego Maradona vorbei. Das Training nach Regeln hatte mir die Freude am Spiel gründlich verdorben. Ich empfand unseren Trainer definitiv als zu streng, und meine individuelle Freiheit wurde dadurch beschränkt. Gleichzeitig spürte ich, dass mein außergewöhnliches Verhalten nicht in ein enges Korsett passte. Ein Streit mit dem Trainer war also quasi vorprogrammiert. Heute kann ich sagen, dass ich schwierigen Situationen, die viel Ausdauer abverlangten, unbewusst aus dem Weg ging.
Fliegende Backsteine
Ich hatte großes Glück mit meinen Eltern. Sie ließen mich mehrheitlich machen, was ich wollte, und sie trauten mir auch einiges zu. Keine Frage: Verglichen mit meinen lebhaften Kameraden war ich mit Sicherheit das turbulenteste, unruhigste und aktivste Kind von allen.
Einige meiner «Aktionen» gingen weit über die bekannten Bubenstreiche hinaus: Einmal besuchte ich mit Freunden eine Baustelle in unserer Straße. Dort entstand gerade ein Zweifamilienhaus. Der erste Stock war bereits fertiggestellt und wir gelangten ungehindert in das Gebäude. Ein Berg nigelnagelneuer Backsteine lag vor uns wie auf dem Präsentierteller. Wer die Initialzündung hatte, einen Backstein in die Hand zu nehmen und diesen aus dem oberen Stock zu werfen, weiß ich nicht mehr so genau. Doch nach dem ersten Steinwurf ergab sich eine unheilige Dynamik bei jedem Einzelnen von uns. Nach einer halben Stunde lagen auch die Steine aus den oberen Stockwerken zertrümmert im Garten. Das Resultat dieser Aktion war nicht nur ein Schaden von mehreren tausend Franken. Es folgten Tage, in denen die Arbeiten am Haus stillgelegt werden mussten, weil das nötige Baumaterial fehlte.
Unser abwegiges Abenteuer hätte in anderen Familien eine regelrechte Krise ausgelöst. Ich war voller Schuldgefühle und beichtete meinem Vater die schlimme Tat bereits am Abend. Ich machte mir große Sorgen, dass meine Zerstörungswut den Traum meiner Eltern vom Eigenheim begraben würde. Es war ein intensives Gefühl, das ich selbst heute noch genauso wahrnehme wie damals. Mein Vater hegte jedoch keinen Groll gegen mich. Er schimpfte nicht mal und Sanktionen blieben ebenso aus. Der Schaden wurde glücklicherweise durch die Versicherung der jeweiligen Eltern abgedeckt.
Mir zeigt das damalige Echo meiner Eltern noch heute eines ganz klar auf: Sie spürten, dass ihr Junge anders war als die anderen, und reagierten entsprechend verständnisvoll und mit Bedacht auf mein doch sehr eigenes Wesen. Dieses Verständnis war geprägt von ihrer großen Liebe zum eigenen Sohn, und das änderte sich selbst dann nicht, wenn mal etwas gehörig schieflief mit mir.
Nach dem kostspieligen Unfug kam es nie wieder zu einer ähnlich unbedachten Aktion. Ich war eingebettet in ein soziales Umfeld, das mich so akzeptierte, wie ich war, und das mir zu jeder Zeit das Gefühl von Sicherheit und Freiheit vermittelte. Ich entwickelte mich gut und niemand aus meinem Verwandten- oder Bekanntenkreis wäre jemals auf die Idee gekommen, mich bei einem Psychologen oder Neurologen auf etwelche Sonderbarkeiten abklären zu lassen.
Dr. med. univ. Ilona Maier erläutert das Kapitel
Fakten zu ADHS:
Wie viele Kinder/Erwachsene haben ADHS und was sind die typischen Merkmale für eine Diagnose?
Bei Kindern in Europa geht man davon aus, dass ca. 5 % von ADHS betroffen sind (Polanczyk et al., 2007), in den USA werden etwas höhere Zahlen genannt.
Bei Jungen wird die Diagnose häufiger gestellt. In der Praxis sehe ich jedoch kaum Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen.
Es ist davon auszugehen, dass bei ca. 60 % der Erwachsenen, welche in der Kindheit ADHS-Symptome zeigten, diese Merkmale weiterhin bestehen bleiben (Faraone, Biederman, & Mick, 2006). Es kann zu einer anderen Gewichtung der Symptome kommen, gerade weil bis ins Erwachsenenalter oft Strategien im Umgang mit gewissen Situationen erlernt wurden. So zeigt sich z. B. die Hyperaktivität, der «Zappelphilipp», bei Erwachsenen häufig in Form von innerer Unruhe und Getriebenheit.
Oftmals wird bei den Erwachsenen aufgrund der Diagnosestellung ihrer Kinder eine ADHS diagnostiziert. Es ist jedoch nach wie vor davon auszugehen, dass die ADHS bei vielen Erwachsenen unentdeckt bleibt. Viele leiden unter Komorbiditäten wie Depressionen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen oder einem Suchtverhalten. Auch Lernstörungen sind relativ häufig mit ADHS kombiniert.
Oft stehen die erbrachten Leistungen in Diskrepanz zum vorhandenen Potenzial.
Erscheinungsbilder der ADHS:
Je nach Vorhandensein der (unten beschriebenen) Symptome werden folgende Erscheinungsbilder unterschieden:
• Vorwiegend unaufmerksames Erscheinungsbild («Hans-Guck-in-die-Luft»)
• Vorwiegend hyperaktives-impulsives Erschenungsbild («Zappelphilipp»)
• Kombiniertes Erscheinungsbild (= Vollbild der ADHS)
Diagnostische Kriterien für ADS/ADHS (Aufmerksamkeitsdefizitstörung/Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) sind Unaufmerksamkeit sowie Impulsivität und Hyperaktivität.
Beispiele für Unaufmerksamkeit (Auswahl, Liste nicht vollständig):
• Kann die Aufmerksamkeit häufig nicht auf Details richten oder macht Flüchtigkeitsfehler bei Schularbeten, bei der Arbeit oder bei anderen Aktivitäten.
• Hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder Aktivitäten aufrechtzuerhalten.
• Scheint oft nicht zuzuhören, wenn andere sie/ihn ansprechen.
• Verliert oft Gegenstände, die sie/er für Aufgaben oder Aktivitäten benötigt.
• Ist durch äußere Reize leicht ablenkbar.
• Ist oft vergesslich bei Alltagstätigkeiten.
Beispiele für Impulsivität und Hyperaktivität (Auswahl, Liste nicht vollständig):
• Zappelt häufig mit Händen oder Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum.
• Steht oft auf in der Klasse oder in anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird.
• Hat oft Schwierigkeiten, ruhig zu sprechen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen.
• Ist häufig «auf Achse» oder handelt, als wäre er/sie «getrieben».
• Redet oftmals übermäßig viel.
• Platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist.
Alles wird anders
Der Traum, ein eigenes Haus zu bauen, erfüllte sich für meine fleißigen Eltern schneller, als sie von Vaters Mutter das Bauland dazu symbolisch geschenkt bekamen. Es wurden Zinsen fällig, allerdings zu einem Freundschaftspreis, der außerhalb der Marktwirtschaft lag. Mir passte das alles jedoch überhaupt nicht in den Kram. Ich hätte jedenfalls gerne weiter in unserem kleinen Dorf gelebt, denn hier ging es mir sehr gut und ich fühlte mich rundum geborgen. Für die Eltern war es aber geradezu eine moralische Verpflichtung, in der Nachbargemeinde zu bauen. Es gab nichts mehr an ihrem Entscheid zu rütteln.
Unser Einfamilienhaus wurde Realität und wir zogen um, als ich 8 war. Die pittoreske und fast nebelfreie Lage auf dem Plateau des Lindenbergs, umgeben von einer einmaligen Erholungszone mit Wiesen und Wäldern, gefiel mir recht gut. Doch obwohl der neue Wohnort nur wenige Kilometer vom alten Zuhause entfernt lag, waren für mich die neuen Umstände derart gravierend, als wären wir ans Ende der Welt gezogen.
Ab sofort stand unsere Familie – und ganz besonders ich selber – unter der Beobachtung der Verwandten meines Vaters, die ebenfalls in der Aargauer Gemeinde lebten. Tief im Innern spürte ich die Erwartungen von außen, dass wir Kinder nicht aufzufallen hatten. Kleinste Abweichungen, davon war ich felsenfest überzeugt, würden in Windeseile die Runde im Dorf machen. Mein Vater und insbesondere meine Mutter nahmen diese neuen Umstände gar nicht oder wenn überhaupt nur am Rande wahr. Ich geriet aber zunehmend unter Druck.
Schulstress
Im Alter von acht Jahren konnte ich nur in Druckschrift schreiben, so hatten wir es an unserer alten Schule gelernt. In der neuen Klasse schrieben die Kinder aber schon die Schreibschrift, eine Herausforderung, die mich von Anfang an vor große Probleme stellte. Auch in den anderen Fächern schienen meine Schulkameradinnen und -kameraden weiter zu sein als ich. Die Ansprüche der Eltern und der Lehrer an mich waren aus meiner Perspektive klar gesetzt: Ich sollte meine Defizite möglichst schnell aufholen und nebenbei noch den neuen Schulstoff bewältigen. Meine Motivation sank fast ebenso schnell wie die Titanic nach dem Crash mit dem Eisberg.
Es war aber eines der ersten Erlebnisse in unserer neuen Schule, das sich tief in meine Erinnerung gebrannt hat, und es erscheint mir heute wie eine Ankündigung auf all das Unschöne, was noch folgen sollte: Unsere Schule gehörte zu jenen Einrichtungen, die es sich auf die Fahnen geschrieben hatten, möglichst modern und fortschrittlich zu sein. Darum fand der Turnunterricht fortan nicht mehr auf einer Wiese im Freien statt, sondern in einer kühlen Halle, die über eine Sprossenwand und Aufhängevorrichtungen für die Ringe verfügte sowie über einen ordentlich aufgeräumten Raum mit Matratzen und Volleybällen. Die Lehrerin erklärte mir als Erstes die Regeln und dass die Körperhygiene ganz groß geschrieben würde. Und das hieß zu meinem großen Schrecken: nach dem Sportunterricht duschten Jungen und Mädchen gemeinsam.
Grenzüberschreitungen
Das Schulpensum war bereits für die damalige Zeit sehr gedrängt, deshalb blieb für die übliche Vorschrift, dass Mädchen und Buben getrennt duschten, meist keine Zeit. Zu meinem äußersten Befremden mussten wir aber splitternackt und in gemischten Gruppen unter die Brause. Die Buben auf der linken und die Mädchen auf der rechten Seite des Raums, ganz ohne eine Trennwand. Ich fühlte mich dabei ausgesprochen unwohl und entwickelte ein großes Schamgefühl. Für die molligeren Kinder war es ein traumatisches Erlebnis. Herzzerreißendes Weinen nützte rein gar nichts. Die Körperhygiene ging vor! Als der «Neue» musste ich Wege finden, mich möglichst schnell zu integrieren. Doch die lieben Kameraden stachelten mich zu einer typischen Buben-Mutprobe an: Ich sollte in den Duschraum pinkeln. Wie befohlen, so getan! Die Jungen verließen danach den Tatort mit schallendem Gelächter, die Mädchen fanden mein Verhalten einfach nur ekelhaft und meldeten es umgehend der Lehrerin. Das Verdikt: Ich musste vor der Lehrerin und der ganzen Klasse die gekachelten Wände und Böden mit einem Eimer und einem Lappen blank putzen. Ich wusste natürlich, dass ich etwas Blödes getan hatte und fühlte mich dabei schrecklich – und gedemütigt. Mein Vorhaben, ins Klassenteam zu gehören, rückte mit dieser Episode in weite Ferne.
Eine eiserne Disziplin und der unbedingte Wille, jeden Tag vollen Einsatz zu zeigen, war an der neuen Schule ein ungeschriebenes Gesetz. Ich erlebte die Umstände als puren Zwang, und das wiederum trug nicht unbedingt dazu bei, dass sich meine schulischen Leistungen verbesserten. Die Lehrerinnen und Lehrer versuchten zwar stets ihr Bestes und unterstützten mich auch, wo sie nur konnten. Letztendlich mussten sie jedoch einem ambitionierten Lehrplan folgen, der so gar nicht gemächlich vonstattenging.
Die Zeit des Herumtollens im Freien war nun also begrenzt und ich musste stattdessen zuhause in meinem Zimmer sitzen und Schulstoff pauken. Ich hasste mein neues Leben! Ständiges Stillsitzen sowie das Verharren an Ort und Stelle fiel mir extrem schwer. Es war eine Qual!
Meine Mutter hatte jeweils Erbarmen und ließ mich dann und wann ins Grüne springen. Doch die Noten wurden nicht besser. Wenn meine Mutter keine Zeit hatte für die üblichen Kontrollgänge, ließ ich die verhassten Hausaufgaben ganz einfach links liegen. Im Schulunterricht fiel ich immer öfter auf und man attestierte mir mangelnde Konzentration. Gleichzeitig wurde ich noch mehr zu dem, der ich bereits in der ersten Klasse gewesen bin: der Klassenclown. Im neuen Gefüge erhielt der Titel jedoch eine negative Konnotation.
Erster Widerstand
Es sollte noch viel schlimmer kommen: Ich trieb unaufhörlich meine Späße, redete freilich auch während des Unterrichts und ich war ständig unruhig sowie unkonzentriert. Wo mir früher viel Toleranz und Wohlwollen entgegengebracht wurde und wo die Strafen verhältnismäßig milde ausfielen, stieß meine Unrast nun auf ersten Widerstand. Ich musste regelmäßig vor die Türe oder wurde gleich ganz vom Schulunterricht ausgeschlossen. Das Appellieren der Lehrer und selbst ihre Ermahnungen fielen nicht auf fruchtbaren Boden. Ich verstand auch nicht immer genau, was meine Pädagogen von mir wollten, und wenn ich es dann einmal verstand, war es mir schlicht unmöglich, all diese Forderungen umzusetzen. Der Wille zur Veränderung war da: Ich versuchte still zu sitzen, schweigsamer zu sein und mich voll auf den Schulstoff zu konzentrieren. Das gelang mir auch immer wieder, allerdings nur für die Dauer von fünf Minuten. In der nächsten Sekunde war alles wieder beim Alten. Ich erinnere mich noch gut, dass ich mich in diesen Momenten absolut machtlos fühlte, um gegen den inneren Drängler und Unruhestifter auch nur ansatzweise anzukämpfen. Meiner Unrast und Geschwätzigkeit fühlte ich mich während der Lektionen wehrlos ausgeliefert. Ja, ich betete sogar zum lieben Gott: «Bitte, mach mich normal!»
Nichts wünschte ich mir sehnlicher, als ein ganz normales Kind sein zu dürfen, das nicht auffällt und niemandem einen Anlass gibt für spitze Kommentare. Doch der Wunsch blieb mir verwehrt. Durch meinen Status als Klassenclown erhoffte ich mir außerdem Nachsicht von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Aber was früher einwandfrei funktionierte, richtete sich nun gegen mich. Man lachte nicht meinetwegen. Man lachte mich vielmehr aus!
Der Deutschunterricht erwies sich als eine maximale Herausforderung im Ausmaß einer Mount-Everest-Besteigung. Kaum hatte ich die Schreibschrift intus, trieb mich die deutsche Rechtschreibung in die nächste Verzweiflung. Die meisten Menschen erkennen ja ihre eigenen Fehler bei der genauen Visualisierung der Wörter. Wenn ich aber meinte, einen Rechtschreibfehler entdeckt zu haben, handelte es sich meist um eine Fehleinschätzung. Ein Teufelskreis begann. Auf die vermeintlich enttarnten Fehler in Wörtern, die ich richtig geschrieben hatte, folgten unzählige Begriffe, die ich dann tatsächlich falsch buchstabierte und auch so niederschrieb. Ein Beispiel: Ich war mir über lange Zeit absolut sicher, dass der Dienstag ohne «e» geschrieben würde. Für meine bildhafte Vorstellung musste das Wort mit einem «e» einfach falsch sein.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.