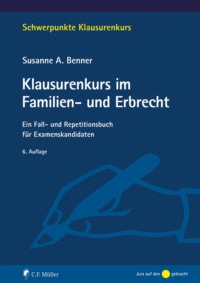Kitabı oku: «Klausurenkurs im Familien- und Erbrecht», sayfa 3
2. Teil Familienrecht
Fall 1 Der Schein kann trügen
12
Jura-Studentin Julia von Jahnsdorf (J) aus Bonn-Bad Godesberg lernt bei einem Berlin Besuch im September 2019 im b-flat den Jazz-Musiker Madu Magoro (M) kennen. Die beiden sehr unterschiedlichen Menschen verlieben sich ineinander. Obwohl ihm seine Freunde abraten, will M um jeden Preis eine Beziehung zu seiner „Prinzessin“. Da er glaubt, ihr etwas bieten zu müssen, erzählt er ihr, wie erfolgreich seine Band sei, dass eine große Konzert-Tournee in Aussicht stünde und bezahlt vor ihren Augen mit gespielter Leichtigkeit mit einem 500,– €-Schein. Er hofft darauf, dass J, wenn sie eines Tages erfahren würde, dass ihm in Wahrheit in manchen Monaten das Geld kaum zum Leben reicht und er inzwischen die Hoffnung fast aufgegeben hat, ganz von seiner Musik leben zu können, trotzdem mit ihm zusammen bleiben würde.
J, die tatsächlich keinen Freund haben will, der nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, ist von dem Auftreten des M sehr beeindruckt und zieht zu ihm in eine Luxus Dachgeschosswohnung in Berlin-Mitte, die M von seiner sich derzeit im Ausland befindlichen Ex-Freundin für wenig Miete bis Ende September 2020 überlassen worden war. Auf den dringenden Wunsch der J, die glaubt, dadurch endlich erwachsen zu werden, heiraten M und J am 2.1.2020, wobei der wenig routinierte Standesbeamte am Ende der Zeremonie vergisst, auszusprechen, dass J und M nunmehr kraft Gesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute seien.
In der Folgezeit wird M als Jazzer immer erfolgreicher und erwirtschaftet mit seinen Einkünften wesentlich mehr als nur seinen eigenen Unterhalt. J trägt durch einen Job als Messe-Hostess ebenfalls zum Lebensunterhalt bei. Ihr Studium hat sie mittlerweile aufgegeben, weil sie keine der angebotenen Klausuren bestanden hatte. Am 11.7.2020 kommt die gemeinsame Tochter Tina (T) zur Welt.
Als J ein Tagebuch ihres Mannes findet und liest, erfährt sie zum einen, dass M sie über seine finanziellen Verhältnisse getäuscht hat und sie bald aus der Wohnung ausziehen müssen. Zum anderen erwähnt M dort, dass er J auf einer Konzert-Tournee kurz nach der Hochzeit mit einer Sängerin betrogen hat. J ist außer sich, obwohl auch sie in dieser Zeit eine kurze Affäre mit ihrem Physiotherapeuten Leo Lohmeyer (L) hatte.
Am 9.8.2020 lässt sich J mit ihrer Tochter T von ihren Eltern abholen und zieht zu ihnen zurück nach Bad Godesberg. Sie ist sich sicher, dass sie mit M nichts mehr zu tun haben will. Ihre Eltern unterstützen sie darin und verwehren M jeglichen Kontakt mit ihr und T. Gemeinsam mit J suchen sie kurz darauf einen befreundeten Anwalt auf und wollen wissen, ob sich J noch im Jahr 2020 scheiden lassen oder ihre Ehe auf andere Weise unproblematisch beenden könne. Auf jeden Fall soll M aber den Familiennamen „von Jahnsdorf“ wieder abgeben müssen. Außerdem wollen sie wissen, ob J Anspruch auf einen Teil des Geldes habe, das sich M während der Ehe dazu verdient und erspart habe. Nach ihrer Rechtsauffassung soll M der J auch die Fortsetzung des unterbrochenen Studiums finanzieren und für ihre Altersversorgung aufkommen, da er durch seine Lügen und die Affäre die Trennung verschuldet habe.
Auch M holt sich anwaltlichen Rat. Er will wissen, was nach Beendigung der Ehe auf ihn zukommt, insbesondere interessiert ihn, ob er dann unterhaltspflichtig sei. Er äußert den (letztlich unbegründeten) Verdacht, womöglich gar nicht der leibliche Vater der T zu sein. Da er T aber vom ersten Augenblick ins Herz geschlossen habe, möchte er sie in jedem Falle in Zukunft sehen dürfen. Außerdem möchte er wissen, was mit den gemeinsamen Haushaltsgegenständen passieren wird.
Die Antworten der Rechtsanwälte sind in einem Gutachten vorzubereiten, wobei Getrenntlebensunterhaltsansprüche nicht zu prüfen sind.
Es ist davon auszugehen, dass M 3000,– € mit in die Ehe gebracht hat, jedoch noch Raten i.H.v. 2000,– € für den erworbenen VW-Bus abzahlen musste. Sein Endvermögen ist mit 5000,– € anzusetzen.
Das Anfangsvermögen der J lässt sich nicht mehr ermitteln. Ihr Endvermögen ist mit 1000,– € anzusetzen, wobei zu berücksichtigen ist, dass sie im April 2020 700,– € für ein Flugticket nach Athen ausgegeben hat, das sie L spendiert hat, um ihn loszuwerden.
Vorüberlegungen
13
| I. | In dieser umfangreichen Klausur sind die Voraussetzungen einer wirksamen Eheschließung darzustellen sowie die Möglichkeiten der Beendigung einer Ehe (Eheaufhebung/Scheidung). Des Weiteren ist darauf einzugehen, welche Rechtsfolgen mit der Beendigung einer Ehe verbunden sind, wobei Getrenntlebensunterhaltsansprüche explizit nicht zu prüfen sind. |
| II. | Problematisch ist hier insbesondere, die prüfungsrelevanten Punkte an den jeweils passenden Stellen zu diskutieren. Häufig wird der Fehler gemacht, im Rahmen der Prüfung einer wirksamen Eheschließung sämtliche diesbezüglich existierenden Soll-Vorschriften zu zitieren. Tatsächlich ist eine Ehe jedoch bereits wirksam geschlossen, wenn sich: 1. zwei volljährige (vgl. § 1303) Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts (vgl. § 1353), 2. vor einem mitwirkungsbereiten Standesbeamten 3. gegenseitig den Eheschließungswillen erklären (vgl. § 1310). |
| III. | Zeitleiste:  [Bild vergrößern] [Bild vergrößern] |
Gliederung
14
| 1. Teil: Rechtslage im Jahr 2020 – Beendigung bzw. Auflösung der Ehe | ||||
| A. | Vorliegen einer wirksamen Ehe | |||
| B. | Aufhebung der Ehe | |||
| C. | Scheidung der Ehe | |||
| I. | Scheitern der Ehe | |||
| II. | Keine Härte i.S.d. § 1568 1. Fall oder § 1568 2. Fall | |||
| III. | Unzumutbare Härte i.S.v. § 1565 II | |||
| D. | Ergebnis | |||
| 2. Teil: Folgen bei Beendigung der Ehe gegen M gemäß §§ 1569 ff. | ||||
| A. | Unterhaltsanspruch der J gemäß §§ 1569 ff. | |||
| I. | Unterhaltsbeziehung | |||
| II. | Bedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten | |||
| 1. | Bedarf aufgrund eines oder mehrerer Tatbestände der §§ 1570 ff. | |||
| a) | Bedarf nach § 1570 | |||
| b) | Bedarf nach § 1575 | |||
| 2. | Keine eigene Deckungsfähigkeit | |||
| III. | Leistungsfähigkeit | |||
| IV. | Rangfolge | |||
| V. | Kein Ausschluss | |||
| 1. | Ausschluss wegen kurzer Ehedauer gem. § 1579 Nr. 1 | |||
| 2. | Ausschluss gemäß § 1579 Nr. 7 | |||
| 3. | Ausschluss gemäß § 1579 Nr. 8 | |||
| 4. | Vertraglicher Ausschluss i.S.d. § 1585c bzw. Ausschluss i.S.d. § 1586 | |||
| VI. | Art der Unterhaltsgewährung | |||
| VII. | Ergebnis | |||
| B. | Anspruch der J gegen M auf Zugewinnausgleich i.S.d. § 1378 i.V.m. §§ 1372 ff. | |||
| I. | Vorliegen einer Zugewinngemeinschaft | |||
| II. | Beendigung zu Lebzeiten | |||
| III. | Zugewinnausgleichsforderung | |||
| 1. | Zugewinn des Anspruchsgegners | |||
| 2. | Zugewinn der Anspruchstellerin | |||
| 3. | Hälfte der Differenz | |||
| 4. | Zwischenergebnis | |||
| IV. | Kein Ausschluss gemäß § 1381 | |||
| V. | Keine Verjährung | |||
| VI. | Ergebnis | |||
| C. | Versorgungsausgleich i.S.d. § 1587 i.V.m. Versorgungsausgleichsgesetz (VersAusglG) | |||
| D. | Unterhaltsanspruch der T gegen M gemäß §§ 1601 ff. | |||
| I. | Unterhaltsbeziehung | |||
| II. | Bedürftigkeit des Kindes | |||
| 1. | Bedarf i.S.v. § 1610 | |||
| 2. | Keine eigene Deckungsfähigkeit | |||
| III. | Leistungsfähigkeit | |||
| IV. | Rangfolge | |||
| V. | Kein Ausschluss | |||
| VI. | Art der Unterhaltsgewährung | |||
| VII. | Ergebnis | |||
| E. | Sorge- und Umgangsrecht | |||
| I. | Elterliche Sorge | |||
| II. | Umgangsrecht | |||
| F. | Ehename | |||
| G. | Verteilung der Haushaltsgegenstände | |||
Lösung
1. Teil: Rechtslage im Jahr 2020 – Beendigung bzw. Auflösung der Ehe
15
Eine Ehe kann gemäß § 1313 und § 1564 durch eine richterliche Entscheidung oder durch den Tod eines der Ehegatten beendet werden. Ob im vorliegenden Fall im Jahr 2020 die Voraussetzungen für eine Eheaufhebung i.S.d. § 1313 oder Scheidung i.S.d. § 1564 erfüllt sind, muss erst beurteilt werden, wenn zwischen J und M überhaupt eine wirksame Ehe besteht.
Exkurs/Vertiefung:
Während es in § 1313 und § 1564 bislang hieß, eine Ehe könne nur durch Urteil aufgehoben werden, wurde das Wort: „Urteil“ (durch das FGG-Reformgesetz[1]) mit Wirkung zum 1.9.2009 durch den Begriff „Entscheidung“ ersetzt. Da die Entscheidung in Familiensachen gemäß § 116 FamFG durch Beschluss erfolgt, wird eine Ehe nunmehr durch einen Beschluss aufgehoben.
Unabhängig vom Terminus bleibt es dabei, dass ein Gestaltungsakt des Gerichts vorliegen muss. Gestaltungsakt insofern, als es unmittelbar durch den richterlichen Ausspruch zu einer Änderung der Rechtslage kommt.
A. Vorliegen einer wirksamen Ehe
16
Fraglich ist, ob J und M rechtswirksam verheiratet sind.
Eine Ehe ist jedenfalls wirksam geschlossen, wenn sich zwei volljährige Personen gleichen oder verschiedenen Geschlechts vor einem mitwirkungsbereiten Standesbeamten gegenseitig erklären, die Ehe miteinander eingehen zu wollen, vgl. §§ 1303, 1310, 1353 I 1. Nur wenn elementare Voraussetzungen einer Eheschließung fehlen, also wenn einer der Ehegatten unter 16 Jahre alt wäre oder sich die Ehegatten nicht vor einem mitwirkungsbereiten Standesbeamten ihren Eheschließungswillen erklärt hätten, liegt eine sog. Nichtehe vor, die keinerlei Rechtswirkungen zwischen den Beteiligten begründet[2]. Andere Verstöße gegen das Eheschließungsrecht (vgl. dazu z.B.: §§ 1304, 1306, 1307 und 1311) ändern nichts daran, dass die Ehe zunächst wirksam geschlossen wurde, sie können i.S.d. § 1314 lediglich zur Aufhebung der Ehe führen. Ein Verstoß gegen Verfahrensvorschriften, also z.B. ein Verstoß gegen § 1312, bleibt völlig sanktionslos[3].
Vorliegend sind die elementaren Voraussetzungen einer Eheschließung erfüllt. Selbst wenn also der Standesbeamte J und M nicht kraft Gesetzes für rechtmäßig verbundene Eheleuten erklärt hat, wie es die Soll-Vorschrift des § 1312 vorsieht, ist dies für die Wirksamkeit der Eheschließung zwischen M und J ohne Belang.
Exkurs/Vertiefung:
Die zum 1.1.2009 wirksam gewordene Änderung des Personenstandsrechts (§§ 67, 67a PStG wurden aufgehoben[4]) ermöglicht zwar eine kirchliche Trauung mit kirchenrechtlichen Folgen, vgl. § 1588, ohne dass die standesamtliche Trauung zuvor vollzogen sein muss, Rechtswirkungen aus zivilrechtlicher Sicht entfaltet die Ehe jedoch lediglich, wenn die oben genannten elementaren Voraussetzungen erfüllt sind[5].
Eine andere Neuerung des PStG ist im Jahr 2018 aufgrund einer entsprechenden Entscheidung des BVerfG erfolgt, das die bis dato geltende Regelung, nach der für Menschen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, kein alternativer Geschlechtseintrag vorgesehen war, als verfassungswidrig ansah[6]. Während auch im Familienrecht grundsätzlich ein binäres Geschlechtermodell zugrunde gelegt wird, kennt das PStG daher nun auch das Geschlecht: „divers“ und nicht nur das „unbestimmte Geschlecht“, vgl. dazu § 22 III PStG in Bezug auf das Geburtenregister.
B. Aufhebung der Ehe
17
Möglicherweise kommt eine Aufhebung der zwischen J und M bestehenden Ehe gemäß den §§ 1313 ff. in Betracht.
Als Ansatzpunkt für einen Aufhebungsgrund ließe sich anführen, dass M die J i.S.d. § 1314 II Nr. 3 1. Hs. arglistig über seine Vermögensverhältnisse getäuscht hat[7]. Zwar hätte J bei Kenntnis der tatsächlichen Sachlage den vermögenslosen M nicht geheiratet, § 1314 II Nr. 3 2. Hs. schließt aber die Täuschung über Vermögensverhältnisse als Aufhebungsgrund von vornherein aus. Auch die übrigen in § 1314 normierten Aufhebungsgründe greifen hier nicht ein und da es sich insoweit um eine abschließende Aufzählung handelt[8], ist eine Analogie nicht möglich, so dass eine Aufhebung der zwischen J und M geschlossenen Ehe nicht in Betracht kommt.
Exkurs/Vertiefung:
Unabhängig von der zivilrechtlichen Betrachtungsweise kann die Nichtbeachtung von Eheverboten zur Strafbarkeit führen, so ist z.B. eine Doppelehe nach § 172 StGB strafbar.
C. Scheidung der Ehe
18
Fraglich ist, ob die Voraussetzungen für eine Scheidung der Ehe zwischen J und M erfüllt sind. Grundlage für die Scheidung einer Ehe ist gemäß § 1565 I 1 allein der Umstand, dass die Ehe – aus welchen Gründen auch immer – gescheitert ist (sog. Zerrüttungsprinzip).
Das Zerrüttungsprinzip hat das bis 1977 geltende Verschuldens- bzw. Schuldprinzip abgelöst, so dass es für eine Scheidung nicht mehr ausschlaggebend ist, ob einem der Ehegatten ein bestimmtes ehewidriges Verhalten zum Vorwurf gemacht wird[9]. Auf ein etwaiges Verschulden des M kann es mithin nicht ankommen, sondern allein auf die Frage, ob die Ehe zwischen J und M als gescheitert anzusehen ist.
I. Scheitern der Ehe
19
Das Scheitern einer Ehe kann folgendermaßen nachgewiesen werden:
Erstens durch die unwiderlegbare Zerrüttungsvermutung des § 1566 I, der ein einjähriges Getrenntleben und das Einverständnis der Ehegatten über die Scheidungsabsicht voraussetzt, zweitens durch die unwiderlegbare Zerrüttungsvermutung des § 1566 II, der ein dreijähriges Getrenntleben voraussetzt und, neben diesen beiden mittelbaren Nachweisen, drittens durch den unmittelbaren Nachweis einer positiven Feststellung des Scheiterns der Ehe nach § 1565 I 2.
Da J und M i.S.v. § 1567 noch nicht einmal ein Jahr getrennt leben und daher die Zerrüttungsvermutungen des § 1566 I bzw. II nicht zum Tragen kommen können, ist das Scheitern der Ehe hier i.S.v. § 1565 I 2 positiv festzustellen.
Nach § 1565 I 2 ist eine Ehe gescheitert, wenn die Lebensgemeinschaft aufgehoben ist – was durch eine sog. Eheanalyse der Lebensverhältnisse aufgrund konkreter Umstände im Einzelfall nachzuweisen ist – und eine Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft aufgrund einer Prognose nicht mehr zu erwarten ist[10].
Die Lebensgemeinschaft zwischen J und M bestand vorliegend nicht mehr und darüber hinaus ist sich J sicher, dass sie mit M nichts mehr zu tun haben will, so dass eine positive Prognose bezüglich der Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft nicht abgegeben werden kann. Somit ist die Ehe zwischen J und M i.S.v. § 1565 I 2 als gescheitert zu qualifizieren.
20
Hinweis zur Lösung:
Um auf die Härteklauseln des § 1568 1. und 2. Fall eingehen zu können, wurde die Prüfung des § 1568 der Prüfung des § 1565 II vorangestellt.