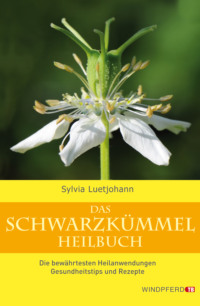Kitabı oku: «Das Schwarzkümmel-Heilbuch», sayfa 2

Typische orientalische „Kräuter-Apotheke“
Die orientalischen Wurzeln
Schwarzkümmel, eine Pflanze aus der Familie der Hahnenfußgewächse, stammt aus dem Mittelmeerraum und ist in Ländern Nordafrikas, Vorderasiens und Südosteuropas heimisch. Die früheste Kultivierung und Verwendung läßt sich mehr als 3000 Jahre bis in das Reich der Assyrer (das heutige Syrien und Teile des Irak) und in das Alte Ägypten zurückverfolgen. Doch auch Indien wird bisweilen als Herkunftsland des legendären schwarzen Samens genannt.
In einem assyrischen Kräuterbuch wird Schwarzkümmel oder „schwarzer Tin-Tir“ als Heilmittel genannt, dem bereits eine vielseitige Anwendung nachgesagt wird: innerlich für den Magen, äußerlich für die Behandlung von Augen, Ohren und Mund sowie von den unterschiedlichsten Hautproblemen, wie Juckreiz, Ausschläge, Geschwüre und Flechten. Auch die später noch bei Plinius aufgeführte Erste Hilfe, bei dem Biß von Schlangen bzw. dem Stich von Skorpionen eine Mischung aus zerstoßenem Schwarzkümmelsamen, Essig und Honig in die Wunde zu streichen, ist bereits seit altersher erprobt worden.
Aus dem Reich der Pharaonen ist die Verwendung von Schwarzkümmel als Digestif nach üppigen Gelagen sowie als Heilmittel bei Entzündungen und bestimmten überempfindlichen Reaktionen des Körpers überliefert, für die wir heute den Begriff „Allergien“ verwenden. Der Nachweis für die Wirksamkeit bestimmter Substanzen bei entzündlichen und allergischen Prozessen ist durch moderne Forschungsergebnisse bereits erbracht worden. Außerdem wird der sprichwörtliche „Bronzeteint“ der alten Ägypter auf die pflegenden Eigenschaften des Schwarzkümmelöls zurückgeführt, die auch der wegen ihrer Schönheit gerühmten Königin Nofretete schon 1350 Jahre vor unserer Zeitrechnung bekannt gewesen sein dürften.
Über den Fund eines Fläschchen Schwarzkümmelöls in der Grabkammer des Tut-enkh-amun ist – ganz wie es einer Wunderpflanze zukommt – schon reichlich spekuliert worden. Sie wurde sogar als Begleiterin für ein Leben nach dem Tode erhoben, obwohl sie diesen ja offenbar nicht hatte verhindern können. Vielleicht wurde das Öl einfach für eine kostbare Grabbeigabe gehalten?
Die Kopten, als die christlichen Nachfahren der alten Ägypter, sorgten dafür, daß die Tradition der Kräutermedizin lebendig blieb, und gaben ihre Kenntnisse auch an andere Völker der arabischen Welt weiter. Im Arabischen heißt der schwarze Kümmel kamûn asvad, im Hocharabischen auch shouniz; außerdem trägt er die Namen habbe sôda, „schwarzer Samen“, oder habbe el-barake, der „unerschöpflich reiche Samen“. Die letztere Bezeichnung leitet sich von dem bereits zu Anfang erwähnten Lob des Propheten Mohammed ab: „Schwarzkümmel heilt jede Krankheit – außer dem Tod“, das in dem Hadith „El Buchari“ aufgezeichnet ist. Zweifellos hat dieses Zitat zur großen Verbreitung des Schwarzkümmels in den islamischen Ländern beigetragen.
Zu Anfang des 11. Jahrhunderts wird Schwarzkümmel von dem berühmten persischen Arzt und Philosophen Ibn Sina (auch als Avicenna bekannt) in seiner großen medizinischen Abhandlung Kitabasch schifa („Buch der Genesung“) ausführlich mit den folgenden Wirkungen erwähnt:
•innere Reinigung und Entgiftung des Körpers
•Entschleimung und Kräftigung der Lungen
•Hausmittel bei Fieber, Husten, Schnupfen, Zahn- und Kopfschmerzen
•Mittel bei Hautleiden und für die Wundbehandlung
•Mittel gegen Darmparasiten und Würmer, auch gegen Bisse und Stiche von giftigen Tieren.
Im Orient überliefert und durch viele Rezepte belegt ist außerdem seine vorwiegend schmerzstillende und krampflösende Wirkung bei Magen-Darm-Beschwerden, Blähungen, Durchfall und Verstopfung, Gelbsucht und Gallenkoliken, für die Anregung der Nieren und eine vermehrte Harnausscheidung, gegen Infektionen, Verschleimung und Bronchialleiden, bei Menstruationsbeschwerden und zur Förderung der Milchsekretion, gegen Hautparasiten und vor allem bei Kindern als Wurmmittel. Im Volk ist auch die Verwendung als hautpflegendes Mittel sowie gegen Schuppen und Haarausfall überliefert. Bis heute ist er überall in den orientalischen Gewürzbasaren zu finden. Der türkische Name Çörekotu, der sich etwa als „Gras(samen) für kleines Gebäck“ übersetzen läßt, weist auf einen seiner Verwendungszwecke hin. Er wird auch, ähnlich wie Mohn oder Sesam, auf Brotfladen gestreut. Viele Mohammedaner nehmen jeden Morgen zur Stärkung nicht nur der Manneskraft eine Prise des Samens in Honig zu sich. Und nicht zuletzt gilt der Samen auch als „Segen des Propheten Mohammed“ für die Rede.
Aus der Türkei ist die Verwendung als Räuchermittel sowie auch der Volksbrauch überliefert, genau 41 Samen des Schwarzkümmels in bunte Stoffsäckchen einzunähen und mit einer Sicherheitsnadel an der Kleidung von Kindern zu befestigen. Dieser Talisman soll sie beschützen. Die Samen werden auch wie Perlen an Schnüren aufgereiht und, mit bunten Stoffetzen verziert, im Fenster aufgehangen. Ein solches Nazarlik soll gegen den „Bösen Blick“ schützen. Auch in Indien gilt dieses blauschwarze Gewürz des dunklen Planeten Ketu, geformt wie eine Träne, als Beschützer gegen das böse Auge. Aus dem Jemen ist der Volksbrauch überliefert, Schwarzkümmel als Amulett zur Vertreibung böser Geister zu tragen.
Von Südosteuropa (Griechenland und Bulgarien) und Nordafrika (Sudan, Äthiopien, Ägypten) über die vorderasiatischen Mittelmeerländer, Syrien, die Türkei, das alte Zweistromland, Persien und Pakistan ist der Schwarzkümmel bis nach Indien und sogar nach China gelangt. In Indien wird Schwarzkümmel vor allem in den Regionen Punjab, Himachal Pradesh, Bihar und Assam kultiviert. Als Brot- und Speisegewürz oder in Rezepturen der indisch-ayurvedischen Medizin verwendet, galt und gilt Kalonji, der „schwarze Zwiebelsamen“, als wohlschmeckendes Gewürz zur Unterstützung des Stoffwechsels sowie als Heilmittel bei Verdauungsstörungen und den gefürchteten Durchfallerkrankungen, wie Amöben- und Bakterienruhr. Außer den Samen und dem fetten Öl wird hier auch traditionell das ätherische Schwarzkümmelöl verwendet.
Nach der ayurvedischen Überlieferung und der Typenlehre von den drei Doshas vermindert Schwarzkümmel Vata und Kapha und vermehrt Pitta. Daraus wurde die Behandlung auch bei ungewöhnlichen Indikationen, z. B. bei Magersucht, bestimmten Störungen des Nervensystems, Ausfluß und venerischen Krankheiten entwickelt. Eine besondere Rolle spielt weiterhin die Frauenheilkunde, wo Schwarzkümmel aufgrund seiner uteruskontrahierenden Wirkung auch bei zu schwachen Wehen und bei Kindbettfieber eingesetzt wurde, wegen der Möglichkeit einer Früh- oder Fehlgeburt allerdings nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden sollte. Dementsprechend gilt Schwarzkümmel auch als „pflanzliches Verhütungsmittel“ und taucht in zahlreichen indischen Pflanzenrezepturen mit abortivem Wirkungspotential auf.
Außerdem wird den Samen eine allgemein anregende, tonisierende und stimmungsaufhellende Wirkung zugeschrieben.
In ganz Indien gibt es im Volk den Brauch, zwischen Stoffe und Tücher zerstoßene Kalonji-Samen zur Insektenabwehr zu streuen. Bekannt ist auch die antibakterielle und daher für die Nahrungskonservierung nützliche Wirkung der Samen.
Die europäische Überlieferung (1. Teil)
Schwarzkümmel ist nicht nur in der Bibel, wo er Ketzah heißt, als vielseitig verwendbares Gewürz für Brot und Kuchen erwähnt, sondern auch allen naturheilkundlichen Autoren der griechischen und römischen Antike bekannt. Der griechische Arzt Hippokrates (5. Jh. v. Chr.) verwendet die Namen melánthion („Schwarzblatt“) oder meláspermon („Schwarzsame“) dafür. Die schwarzen Samen haben der Pflanze auch ihren botanischen Namen gegeben, nämlich Nigella (von lat. niger = „schwarz“ bzw. nigellus = „schwärzlich“). Im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung wird er von Plinius Secundus d. Ä. in seiner umfangreichen Naturalis historia („Naturgeschichte“) ausführlich behandelt. Hier taucht als Name übrigens Git oder Gith auf, eine in den antiken lateinischen Schriften oft verwendete Bezeichnung, die sich wahrscheinlich aus dem Arabischen ableitet und der wir später auch in den alten deutschen Quellen noch mehrmals begegnen werden. Eine offenkundig ebenfalls arabisierte Namensform des Schwarzkümmels, nämlich „Salusandriam“, verwendet nur wenig später als Plinius der griechische Arzt Dioskurides in seiner fünfbändigen Arzneimittellehre De materia medica, die weit über das Mittelalter hinaus die Pflanzenheilkunde beeinflussen sollte.
Plinius nennt eine Reihe von Heilanwendungen, von denen uns viele aus der arabischen Welt bereits bekannt sind, so natürlich die verdauungsfördernde Wirkung als Brotgewürz; ferner die schon erwähnte Behandlung von Schlangenbissen und Skorpionstichen, außerdem von Verhärtungen, alten Geschwulsten, Eiterwunden, Hautausschlägen und sogar von Sommersprossen. Eine ganze Reihe von Rezepturen mit Schwarzkümmel gegen Erkältungen und Entzündungen im Kopfbereich werden empfohlen, die noch viele hundert Jahre später fast unverändert in den großen deutschen Heilpflanzen-Enzyklopädien des 16.–18. Jahrhunderts auftauchen werden. Hier einige Kostproben aus der „Naturalis Historia“:
Zerstoßen und zum Riechen in ein leinenes Tüchlein gebunden, vertreibt er Nasenkatarrh, mit Essig aufgestrichen Kopfschmerzen, mit Irisöl in die Nase gestrichen Augenkatarrh und Geschwülste, mit Essig gekocht Zahnschmerzen, zerrieben und gekaut Mundgeschwüre, mit einem Zusatz von Natron getrunken Atembeschwerden …
Der Gebrauch des Schwarzkümmels als wohlschmeckendes und gleichzeitig heilkräftiges Brotgewürz hat sich in der Folgezeit offenbar auch in Deutschland durchsetzen können. Um das Jahr 794 wird sein Anbau im „Capitulare de vilis“ von Karl dem Großen für diesen Verwendungszweck empfohlen. Er wird hier mit den Namen „Römischer Kümmel“ oder „Schwarzer Koriander“ bezeichnet und erhält auch die arabischen und von Plinius überlieferten Heilwirkungen zugeschrieben. Im Jahre 816 wird Schwarzkümmel, der hier Gitto heißt, im „Hortus“ des St. Gallener Klosterplanes aufgeführt. In altdeutschen Glossen wird er als protvurz oder brotchrut bezeichnet. Die Einbürgerung des botanischen Namens Nigella im Mittelalter scheint vor allem auf die Schriften des Albertus Magnus zurückzugehen, er hat sich auch in der Pharmakologie eingebürgert.
Hildegard von Bingen, die im 12. Jahrhundert ihr berühmtes Doppelwerk über Natur- und Heilkunde verfaßt hat, scheint dem Schwarzkümmel dagegen eher mißtrauisch gegenübergestanden zu haben. Sie stuft ihn zwar sehr treffend als „Pflanze von warmer und trockener Qualität“ ein, handelt ihn aber dann auffallend kurz ab. Zu erwähnen ist vor allem die Verwendung von zerstoßenem Schwarzkümmelsamen mit gebratenem Speck als Heilsalbe gegen Kopfgeschwüre. Der Samen, mit Honig vermischt und an die Wand gestrichen, wird außerdem als todsicherer Fliegenfänger empfohlen! Was die Einnahme durch den Menschen betrifft, warnt Hildegard allerdings vor seiner möglicherweise giftigen Wirkung. Dies trifft auf manche Mitglieder dieser recht verzweigten Hahnenfußfamilie sogar zu. Da Hildegard aber den Ackerschwarzkümmel in ihrer „Physica“ mit dem botanischen Namen Githerum ratde benennt, liegt eher die Vermutung nahe, daß bereits hier die später sprichwörtliche Verwechslung mit der Kornrade (Agrostémma githago) passiert ist. Die Samen dieses von den Bauern gefürchteten Getreideunkrauts sind durch Saponine tatsächlich giftig und machen Mehl, Brot und Getreidekaffee nicht nur bitter, sondern sogar gesundheitsschädlich.
Trotzdem muß sich der Ruf des Schwarzkümmels als Heilmittel in der Volksmedizin im Laufe der nächsten Jahrhunderte stabilisiert und auch weiter verbreitet haben, denn als 1539 das „New Kreutterbuch“ des Hieronymus Bock erscheint, wird bereits eine beachtliche Wissensfülle über Nigella oder auch den „Schwartzen Coriander“ ausgebreitet, wie er nun allgemein genannt wird. Da sich unserer Spurensuche aber spätestens ab hier ein oft nur mühsam zu durchdringender Wildwuchs aus unterschiedlichen Pflanzen mit abweichenden Beschreibungen und immer phantasievolleren Namen in den Weg zu stellen scheint, muß an dieser Stelle ein Abstecher in die Welt der Botanik eingeschoben werden.
Botanische und andere Streifzügedurch die wichtigsten Schwarzkümmelarten
Schwarzkümmel ist eine einjährige Pflanze, die durch Aussaat vermehrt wird oder sich selbst vermehrt. Zu unserem Gewürzkümmel, Carum carvi, besteht trotz des Namens und teilweise ähnlicher Verwendung botanisch keine Verwandtschaft, und trotz häufiger Verwechslung gilt dies auch für den indischen Kreuzkümmel mit seinen Arten Cuminum cyminum und Cuminum nigrum. Im Unterschied zu diesen gehört Schwarzkümmel nicht zu den Doldenblütlern, sondern zu den Hahnenfußgewächsen (Ranunculaceae), die nach derzeitigen Erkenntnissen eine der alkaloidreichsten Pflanzenfamilien darstellen.
Die Untergruppe der Schwarzkümmelarten zeichnet sich besonders dadurch aus, daß die fünf Fruchtblätter, die bei den Ranunculaceen sonst getrennt nebeneinanderstehen, je nach Art mehr oder weniger in der Mitte miteinander verwachsen sind. Dadurch entsteht eine radförmige Samenkapsel oder sog. Sammelbalgfrucht, deren Fächer sich erst bei der Reife in der Mitte trennen. Während die Verwachsung bei unauffälligeren wilden Sorten nur bis zur halben Höhe reicht, geht sie bei den beiden bekanntesten Arten, dem Echten Schwarzkümmel und dem Damaszener Schwarzkümmel, bis zur Spitze, so daß die über den Umfang des Rades hinausragenden fünf Griffel die Figur eines Zackenrades bilden. Der volkstümliche Name „Rade/Radel“ (siehe unter Nigella arvensis) sowie auch die englische Bezeichnung Pinwheel („Feuerrad“ oder „Windrädchen“) erklären sich aus dieser zahnradförmigen Gestalt der Blüte.
Dies hat der Pflanze in Deutschland den Namen „St. Katharinenblume“ oder „St. Katharinenrädlein“ eingebracht, da die hl. Katharina in der Ikonographie stets mit einem Zackenrad dargestellt wird. Der Legende nach zerbrach nämlich das Rad, mit dem sie im Jahre 309 den Märtyrertod erleiden sollte, und sie mußte mit dem Schwert hingerichtet werden. Darum hält sie auf den Heiligenbildern auch nur das Bruchstück eines Rades in der Hand. Analog dazu zerbricht das Katharinenrädlein bei der Reife in fünf Teile und läßt die in zwei Reihen an der inneren Naht angewachsenen Samen herausfallen.
Ehe wir noch weiter in den Grenzbereich zwischen volkskundlicher Botanik und Legende abschweifen, sollen nun die drei wichtigsten Schwarzkümmelarten beschrieben werden.
Nigella sativa
Die grassierende Begriffsverwirrung bei der Benennung des Schwarzkümmels fand erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts durch Linnés binäre Nomenklatur ein Ende. Bei der von ihm eingeführten lateinischen Doppelbezeichnung steht der erste Namensteil für die Gattungszugehörigkeit und der zweite für die Art. In unserem Fall bedeutet der Vorname Nigella „schwärzlich“, was sich auf die schwarzen Samen bezieht, und die Übersetzung des Nachnamens sativa lautet „angepflanzt“. Wir haben es hier also mit der zumeist kultivierten Schwarzkümmelart zu tun.
Der Echte oder Gemeine Schwarzkümmel ist eine 30–50 cm hohe, filigran wirkende Pflanze. Sie hat einen aufrechten, wenig verästelten, etwas rauhhaarigen Stengel. Die Blätter sind zwei- oder dreifach fiederschnittig und haben dadurch Ähnlichkeit mit Doldenblütern, wie Kümmel, Fenchel und Koriander, was sich in solchen Namensformen wie „Römischer Kümmel“, „Fennel Flower“ oder „Schwarzer Koriander“ niedergeschlagen hat. Aus den einzeln gipfelständigen Blüten, die milchigweiß sind und zur Spitze hin eine bläulich-grünliche Färbung annehmen, entwickeln sich nach der Blüte die mit rauhen Warzen bedeckten, kugelartigen Fruchtkapseln, die von fünf abstehenden, an Schnäbel erinnernde Spitzen gekrönt werden.
Die verschiedenen Schwarzkümmel-Arten

Nigella sativa, der echte Schwarzkümmel

Nigella damascena, der Gartenschwarzkümmel

Nigella arvensis, der Ackerschwarzkümmel
Die schwarzen Samen der Nigella sind dreikantig und querrunzlig, sie sehen Zwiebelsamen zum Verwechseln ähnlich. Die Ähnlichkeit der Fruchtkapsel mit der Mohnpflanze hat wohl zu dem botanischen Namen Papaver nigrum, also „Schwarzmohn“ beigetragen, und die Samen sind früher sogar mit denen des Stechapfels (Datura) vermischt worden, die im Volk „Schwarzkümmel“ hießen.
Nur die Samen und das aus ihnen gepreßte Öl werden als medizinisch wichtige Bestandteile der Pflanze angesehen; diese Einschätzung schlägt sich beispielsweise auch in dem alten Namen „Nardensamen“ nieder. Sie riechen beim Zerreiben sehr aromatisch – allerdings nicht nach Kümmel, sondern eher nach Fenchel oder Anis und erinnern auch an Muskat. Die englischen Namensformen „Fennel Flower“ oder „Nutmeg Flower“ sind davon inspiriert worden. Der Geruch hat auch schon Assoziationen an Kampfer oder sogar Kajeput geweckt. Vom Geschmack her sind die Samen würzig, leicht bitter und von angenehmer Schärfe, so daß sie früher gerne anstelle von gewöhnlichem Kümmel verwendet wurden und auch als Pfefferersatz dienten. Poivrette (etwa mit „kleiner Pfeffer“ zu übersetzen) heißt in Frankreich denn auch das zu Pulver zerstoßene arabische Gewürz Abésodé.
Aus den Samen läßt sich durch Extraktion, aber auch durch Kaltpressung das fette Öl mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen gewinnen, aus dem die Samen zu ca. 35–45 % bestehen. Dem Schwarzkümmelöl wird eine konzentriertere Wirkung als dem unverarbeiteten Samen nachgesagt. Mittels Destillation kann aus den Samen auch ätherisches Öl gewonnen werden, von dem in Nigella sativa ca. 0,5–1,5 % enthalten sind. Es ist von gelblicher bis brauner Farbe, hat einen etwas strengen Geruch und ist auch daran zu erkennen, daß es nicht fluoreszierend ist.
Die ihr zugeschriebenen Heilwirkungen verdankt die Nigella sativa wohl der Tatsache, daß ihr ein Inhaltsstoff fehlt – nämlich das Alkaloid Damascenin, das beispielsweise in den beiden nachfolgend beschriebenen Arten Nigella damascena und Nigella arvensis enthalten ist, aber nur in hochkonzentrierter Form genossen schädlich sein soll.
Mindestens 20 verschiedene Varietäten und Kreuzungen des Schwarzkümmels sind in den Küstenländern des Mittelmeers und in den angrenzenden Gebieten sowohl wildwachsend als auch kultiviert verbreitet, darunter Nigella aristata und Nigella orientalis, die sich durch auffallend hellgrüne Blätter und rotgepunktete gelbe Blüten hervortut und auch gelbliche Samen hat. Überhaupt können sich die verschiedenen Nigella-Arten in ihrem Aussehen ziemlich voneinander unterscheiden: So hat der syrische Schwarzkümmel gegenüber dem ägyptischen recht große, hellblaue Blüten und längere, feinere Blätter. Wir wollen damit zur nächsten Verwandten der Nigella sativa übergehen – der Nigella damascena.
Nigella damascena
Der Damaszener oder Türkische Schwarzkümmel (engl. „Damask Fennel“), auch als Gartenschwarzkümmel bekannt, ist ebenfalls in den Mittelmeerländern und im Vorderen Orient heimisch. Die Namensgebung verweist hier besonders auf die Türkei und Syrien mit seiner Hauptstadt Damaskus. Diese Nigella-Art wurde aus ihrer ursprünglichen Heimat verpflanzt, wobei sich verschiedene Schmuckformen entwickelten. Sie ist etwa seit dem 16. Jahrhundert zu einer beliebten mitteleuropäischen Gartenzierpflanze geworden. Auch in den Beschreibungen, die man in den alten Kräuterbüchern findet, genießt sie wegen ihrer Attraktivität größere Beliebtheit als die Nigella sativa: Sie wird nicht nur häufiger abgebildet als diese, sondern durch das Himmelsblau ihrer rosenähnlichen Blüten und die auffallende Fülle ihrer haarfein wirkenden Blättchen als „hübscher und lustiger“ beschrieben. Vor allem aber weckt sie die Assoziation an zarte Mädchen, weshalb sie in der Volksbotanik viele poetische Namen erhalten hat und von Sagen und Legenden umrankt ist. „Lieb Kind hat viele Namen“ lautet eine alte Volksweisheit über die Vorzüge der Pflanzenwelt, und gewiß hat die schöne Damaszenerin entscheidend zu den rund 80 Bezeichnungen beigetragen, die es für die Schwarzkümmelarten gibt.
Der Damaszener Schwarzkümmel wird bis zu 75 cm hoch und hat einen aufrechten Stengel mit dunkelgrünen, sehr fein zerschlitzten Blättern mit langen Zipfeln. Diese erinnern nicht nur an Dillkraut, sondern auch an ein zartes Wurzel- oder Haargeflecht. Außerdem werden die Blüten von einem sogenannten Involukrum, einer Hochblatthülle aus fünf ähnlich zerschlitzten Blättern, umgeben, dessen Ähnlichkeit mit einer Spinne in der Schweiz zu der Bezeichnung „Spinnblume“ oder „Spillmugge“ geführt hat. Die Kelchblätter haben einen milchigweißen Grund, sind aber zur Spitze hin lichtblau gefärbt. Auf den ersten Blick könnte man sie für Blütenblätter halten, doch an ihrer etwas derberen adrigen Beschaffenheit und der ins Grünliche gehenden Farbe sind sie als Kelchblätter zu erkennen.
Vor allem ihrem feinen Blattwerk, das Schlüsse auf ihre empfindsame Natur zuläßt, hat die Nigella damascena viele ihrer sehr weiblichen Namen zu verdanken. So ist sie in Deutschland vor allem als die Gartenpflanze „Jungfer im Grünen“ bekannt. Damit verknüpft ist die Sage um den Tod des deutschen Kaisers Friedrich I. durch Ertrinken während eines Feldzugs in Kleinasien:
Auf einem Heereszug in das Heilige Land hatte Kaiser Friedrich Barbarossa sein Lager am Ufer des Flusses Kalikaduus aufgeschlagen. Dort ging er des Nachts spazieren und erfreute sich am Gesang einer verführerischen Nixe. Als er ihrer ansichtigwurde – grüne Locken umwallten ihr wunderschönes Gesicht, und sie trug ein blaues Gewand – und nach ihr griff, um ihren Schleier zu lüften, wurde er von ihr mit in die Tiefe gerissen. An der Stelle, wo er verschwunden war, fand König Richard Löwenherz eine Blume, lieblich wie eine Undine – mit feinem grünem Haar und blauem Blütenkleid.
Der Ursprung des Namens „Gretel im Busch“ (auch „Gretchen im Grünen“ oder „Gretchen in der Heck“) wird durch eine alte österreichische Sage erhellt:
In einem Dorfe lebte einmal ein reicher, aber sehr geiziger Bauer, der eine schöne Tochter namens Grete hatte. Gegenüber wohnte ein leider sehr armer Bauer, der einen Sohn namens Hans hatte. Die beiden jungen Leute liebten sich, doch Gretes Vater wachte streng darüber, daß sie sich nicht näherkamen. Da blickte Grete so lange aus ihrem Garten nach dem Burschen und Hans vom Weg aus so lange nach dem Mädel, bis beide in Blumen verwandelt wurden: nämlich zu „Gretel im Busch“ und zu „Hansel am Weg“ – dies ist der volkstümliche Name für den Vogelknöterich (Polygonum aviculare).
Vielleicht ist auch das englische „Love in a Mist“ eine Reminiszenz an diese traurig-schöne Geschichte?
Ein weiterer, sehr bildhafter Name, „Braut in Haaren“ (frz. auch cheveux de Vénus = „Venushaar“), zeugt davon, daß früher der Übergang vom ledigen zum ehelichen Stand für die Frau mit einem Wechsel der Haartracht verbunden war, z. B. durch eine andere Art des Einflechtens oder der Kopfbedeckung. Bis ins 18. Jahrhundert hinein galt für vornehme Bräute der Brauch, bei der Hochzeit als Zeichen der Jungfräulichkeit „in Haaren“ zu gehen, d. h. in aufgelöst herabwallendem Haarschmuck, wie es die folgende Gedichtstrophe beschreibt:
Zur Zeit, als es die Sitte war,
Daß Jungfrauen gingen mit losem Haar,
Da nannte man das „in Haaren gehen“;
Daraus der Name ist leicht zu verstehen
Der Blume „Braut in Haaren“ …
Aus den recht großen, einfachen oder gefüllten, manchmal weißen, meistens aber hellblauen Blüten, die von ihrer Gestalt her mit Rosenarten wie der „Persian Rose“, „Miss Jekyll“ oder „Double Blue“ Ähnlichkeit haben, entwickelt sich die stark aufgeblasene, bis taubeneigroß werdende Samenkapsel, die durch die bis zur Spitze verwachsenen Fruchtknoten mit waagrecht abstehenden Griffeln fünf Hörner aufgesetzt bekommt. Von dieser auffallenden kapuzenähnlichen Form leitet sich wahrscheinlich die Bezeichnung „Kapuzinerkraut“ ab, und es ließe sich weiter spekulieren, ob sich der volkstümliche englische Name „Devil in the Bush“ aus Angst vor diesen vielen Hörnern erklären läßt …
Die in der Balgfrucht enthaltenen Samen sind ebenfalls schwarz, dreikantig und querrunzlig, sie könnten daher von ihrem Aussehen her leicht mit den Samen der Nigella sativa verwechselt werden. Beim Zerreiben riechen sie jedoch weniger streng wie bei der Nigella sativa nach Muskat oder Kampfer, sondern angenehm nach Erdbeeren oder Ananas, was der Pflanze auch den Namen Erdbeer- oder Ananaskümmel und den Samen die Verwendung als Gewürz in der Konditorei sowie in der Fruchtäther- und Schnupftabakfabrikation eingebracht hat.
Auch das ätherische Öl, dessen Anteil bei 0,37–0,55 liegt, besitzt einen angenehmen Geruch und Geschmack nach Walderdbeeren und erinnert zudem ein wenig an Moschuskörneröl. Das Öl ist gelb und fluoresziert zu einem prachtvollen Blau. Dieses Kennzeichen kann auch zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Schwarzkümmelsamen herangezogen werden, die oft miteinander verwechselt und auch vermischt werden: Bei Untersuchung unter gefiltertem UV-Licht fluoresziert nur das Samenpulver von Nigella damascena stark bläulich.
In späteren Kapiteln, die sich mit den Anbaugebieten sowie den Qualitätsmerkmalen beschäftigen, wird auf die Unterschiede bei den Schwarzkümmelsamen noch näher eingegangen.