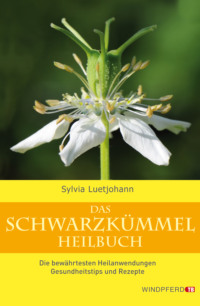Kitabı oku: «Das Schwarzkümmel-Heilbuch», sayfa 3
Nigella arvensis
Der Acker- oder Feldschwarzkümmel, auch Wilder Schwarzkümmel, Haber- oder Roßkümmel genannt, soll hier als eine dritte botanische Sorte etwas ausführlicher erwähnt werden. Diese Varietät erreicht nur eine Größe bis zu 20 cm. Der aufrechte, haarlose Stengel ist von unten an verästelt, so daß sich ein kleiner Busch bildet. Er hat wechselständige gezipfelte Blätter und endständige Blüten mit einem fünfblättrigen Kelch, die hellblau und auf der Außenseite grünlich gestreift sind. Die Verwachsung der 3–5 Fruchtblätter bei der Samenkapsel reicht nur bis zur halben Höhe. Diese ist – im Unterschied zu den beiden anderen Arten – weder rauh noch kugelig aufgebläht, sondern eher länglich mit den schon bekannten Hörnchen, die ihr auch den wissenschaftlichen Namen „Nigella arvensis cornuta“ eingebracht haben.
Die Samen des Ackerschwarzkümmels sind ebenfalls schwarz, etwas rauh und dreikantig. Sie haben beim Zerreiben nicht den lieblichen Geruch der reizvolleren „Jungfer im Grünen“, sondern erinnern mehr an den würzig herben Charakter der Nigella-sativa-Samen. Vermutlich handelt es sich hierbei auch am ehesten um diejenigen Schwarzkümmelsamen, die von den Landleuten zum Räuchern gegen kriechendes Ungeziefer und giftige Tiere eingesetzt wurden – vorzugsweise gegen Spinnen, Skorpione und Schlangen, doch in diesem Zusammenhang werden sogar Hexen erwähnt. Die Blüten überreichten die jungen Mädchen einem ungeliebten Freier, um ihm „durch die Blume“ verstehen zu geben, er könne „abschieben“ – daher der drastische Volksname „Schabab“!
Wir kommen hiermit auch in den Grenzbereich, wo der Ackerschwarzkümmel als „Unkraut“ in den Getreidefeldern wuchert und entsprechend bekämpft wird. Seine Samen galten als bitter- und seifenstoff- sowie alkaloidhaltig und wurden aus dem Getreide ausgesiebt, damit sie nicht ins Mehl gelangten. Der volkstümliche deutsche Name „Radel“, in Zedlers Universallexikon mit dem lateinischen Namen Nigella arvensis gleichgesetzt, führt jedoch auf eine andere Spur: Als Kornnäglein, Nägleinrose oder Marienrose noch anmutig umschrieben, ist die Kornrade ein echtes Ackerunkraut auf Roggen- und Weizenfeldern, das durch die darin enthaltenen Saponine tatsächlich giftig ist und das Mehl bitter macht. Der schon bei Hildegard von Bingen erwähnte Namen Githerum ratde für den Ackerschwarzkümmel ist ein Hinweis auf eine solche Verwechslung mit der Kornrade, deren botanischer Name in tückischer Verwirrung Agrostémma githago lautet. Dieser Name setzt sich aus agros, „Acker“ für den Standort, stemma, „Kranz“ wegen der runden Blütenform, und gith, also dem alten arabischen und antiken Namen für „Nigella“ zusammen. Auch in anderen Sprachen zeigt sich diese Namensverschiebung vom Schwarzen Ackerkümmel zur Kornrade: Der italienische Name für die Kornrade lautet gitto, und im Französischen wird nigelle zu nielle – ein echtes Getreideunkraut, das nielle du blé, die „Gicht des Weizens“, verursacht.
Durch flächendeckende Bekämpfung ist der Ackerschwarzkümmel heutzutage, jedenfalls bei uns, inzwischen fast völlig verschwunden.
Die europäische Überlieferung (2. Teil)
Mit diesem botanischen Rüstzeug versehen, können wir die Spurensuche des Schwarzkümmels seit der Neuzeit und bis in die Gegenwart hinein wieder aufnehmen. Dabei soll an dieser Stelle nur ein allgemeiner Überblick über die Geschichte und Verbreitung dieser Pflanze gegeben werden. Einzelne Rezepturen aus der deutschen Volksmedizin werden später mit den Erfahrungen aus der arabischen und indischen Tradition sowie neueren Einnahmeempfehlungen in das Kapitel über spezielle Heilanwendungen aufgenommen.
Das „New Kreutterbuch“ des Hieronymus Bock aus dem Jahre 1539 und auch die sich rasch anschließenden Kompendien seiner Nachfolger und Epigonen können sich sowohl auf die antiken Quellen, denen wir bereits begegnet sind, als auch auf die inzwischen schon recht verzweigte mündliche Volksüberlieferung stützen.
Nigella sativa, die sich nach und nach zu immer mehr verschiedenen Arten ausmultipliziert, findet sich nun auch als „schwartzer zahmer Coriander“ wieder, so daß wir konstatieren können: Bei den Nigella-Arten wird nun botanisch zwischen „zahmen“ (d. h. kultivierten) und „wilden“ Sorten unterschieden; außerdem hat eine dieser zahmen Sorten aufgrund ihrer offenkundigen Ähnlichkeit mit den schmalen oberen Blättern des Korianders bei dieser Gewürzpflanze eine Anleihe gemacht, und womöglich hat auch der Volksmund berechtigten Einfluß auf die geschmackliche Zuordnung genommen.
Erstmals wird bei Hieronymus Bock erwähnt, daß die „schönst Nigella“, als die wir unschwer die Nigella damascena erkennen, „in die Lustgärten gepflanzet“ wird, wo sich der Geruch und Geschmack der Samen abzuschwächen beginnt, da sie auch zunehmend verwildert. Nigella arvensis dagegen, der eigentlich wilde schwarze Kümmel bzw. Koriander, wird botanisch zwar als „Pseudomelanthium“ entlarvt, in seiner Heilwirkung dem „Melanthium sativum“ jedoch an die Seite gestellt – bis die bereits erwähnte Verwechslung mit der Kornrade ihm zum Verhängnis werden sollte …
Etwa 200 Jahre nach Hieronymus Bock erscheint 1731 mit dem „Neu vollkommen Kräuter-Buch“ von Jacobus Theodorus Tabernaemontanus die letzte große Heilpflanzen-Enzyklopädie. Sie bietet den umfassendsten Wissensstand dieser Zeit auch über das Heil- und Unkraut Nigella, das hier zwar noch Namen mit den Zusätzen „Koriander“ oder „Melanthium“ trägt, vor allem aber „Nardenkraut“ oder „Nardensamen“ genannt wird – als „Narden“ werden von altersher besonders wohlriechende Pflanzen bezeichnet. Auch von einer Nigella hispanica oder Nigella cretica als lokalen Pflanzen ist nun nicht mehr die Rede, sondern man hat die Vorzüge des böhmischen Nardus bohemica erkannt.
Die verschiedenen Varietäten werden nur unter botanischen Gesichtspunkten, nicht aber nach ihrer offizinellen Wirksamkeit unterschieden. Alle kräuterkundigen Autoren erkennen diese Heilkraft an und stimmen auch darin überein, daß die Samen weder grün noch zu viel oder unnötig eingenommen werden sollen, da sie sich sonst sogar schädlich auswirken können. Bisweilen findet sich sogar die Empfehlung, die „hitzigen und trockenen“ Samen nicht trocken einzunehmen, sondern nur in Brot zu backen, wodurch sie eine Wirkung wie Koriander entfalten.
Etwas seltener wird auch Melanthium Oleum erwähnt, also das aus den Schwarzkümmelsamen gepreßte Öl, sowie Oleum Nigellae, das durch die klassische Wasserdampfdestillation gewonnene ätherische Öl; beide sind allerdings noch um einiges vorsichtiger als der Samen zu dosieren. Die Fülle der beschriebenen Anwendungen und Rezepturen entspricht im wesentlichen dem traditionell überlieferten Wissen von der „echten Nigella der Alten“. Zu Beginn seines Kapitels über die „Nardensamen“ schreibt Tabernaemontanus:
Die Alten haben davon nur ein Geschlecht beschrieben; wir kennen sechs unterschiedliche. Sie haben jedoch fast einerlei Kraft und Wirkung, das eine übertrifft das andere höchstens in der Stärke und Güte …
Allerdings ist ihm die Verwechslung zwischen dem wilden Schwarzkümmel und der Kornrade durchaus bekannt, denn er schreibt sogar über die Samen der Nigella sativa:
Anstelle dieses Nardensamens ist von vielen Medicis und Apothekern der Samen der Kornrade gebraucht worden, und obwohl dieser Irrtum durch gelehrte Männer offenbar wurde und nunmehr „so klar wie die helle Sonne um den Mittag“, so sind doch noch viel Unerfahrene in der Erkenntnis der Kräuter so in diesem Irrtum verstockt, daß man sie nicht davon abbringen kann.
Ob dieser verhängnisvolle Irrtum mit dazu beigetragen hat, daß eine derart populäre Heil- und Gewürzpflanze wie der Schwarzkümmel etwa ab dem 18. Jahrhundert bis vor kurzem bei uns fast völlig in Vergessenheit geraten konnte? Diese Entwicklung wird interessanterweise auch mit dem sogenannten „Schabab-Brauch“ in Verbindung gebracht, der ein Sinnbild für verschmähte Liebe ist. Dieser alte Brauch, bei dem der ungeliebte oder verschmähte Verehrer in aller Öffentlichkeit einen Korb mit Schabab-Blumen überreicht bekommt, ist bis heute in den bekannten Redewendungen „etwas durch die Blume sagen“ und „jemandem einen Korb geben“ überliefert. Bei den Schabab-Kräutern spielen die Ranunkeln eine wesentliche Rolle, die Schabab-Blume schlechthin ist die Jungfer im Grünen; andere Pflanzen, die ebenfalls dazugezählt werden, sind beispielsweise Schafgarbe, Kornblume, Augentrost sowie auch die Kornrade, also der Ackerschwarzkümmel. Wie wir schon erfahren haben, wird die dekorativ blau blühende Garten-Nigella nur allzugern mit der optisch weniger spektakulären, dafür aber heilkräftigen Echten Nigella verwechselt.
Es ist auch noch eine weitere interessante Erklärung für die einstmals geringere Popularität des Schwarzkümmels im christlichen Abendland geliefert worden: In der Pflanzensignatur ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Nigella- und Mohngewächsen festzustellen. Von daher wird ihnen unterschiedslos eine leicht narkotisierende Wirkung angehängt, weshalb die Samen in unserem Kulturkreis nicht ins Brot gelangen sollten und vielleicht sogar ein wenig als giftig „verteufelt“ wurden. Übrigens hat selbst das ausgesprochen populäre Bier zumindest zeitweise ein ähnliches Schicksal gehabt: Die Bezeichnung Pils leitet sich offiziell zwar von der Stadt Pilsen ab, wurde aber auch mit dem „Bilsenkraut“ assoziiert.
Wie dem auch sei – im Osten, von Ägypten über Syrien und die Türkei bis nach Indien und China, hat der Schwarzkümmel dagegen nichts von seinem sagenhaften Ruhm eingebüßt. Für diese offensichtlichen Unterschiede gibt es vielleicht aber auch noch eine weitere Erklärung, der wir im folgenden Kapitel nachgehen wollen.
Was passiert, wenn Samen auf die Reise gehen?
Die mutmaßlichen Folgen einer Verpflanzung
Bei dem Bekanntheitsgrad, den Schwarzkümmel in früheren Zeiten auch in unseren Breitengraden als würzige und heilkräftige Pflanze genoß, stellt sich natürlich die Frage, ob die geheimnisvollen Samen denn aus dem Morgenland importiert wurden. Dagegen spricht vieles: der Gebrauch beim einfachen Volk als Brotgewürz und als offenbar stets verfügbares Hausmittel; die Selbstaussaat der Pflanzensamen, die zu immer größerer Vermehrung, aber auch Verwilderung führte; und schließlich auch die notorische Verwechslung der Varietäten miteinander. Wenn man genauer nachforscht, stößt man in mehreren wissenschaftlichen Untersuchungen darauf, daß Nigella damascena nicht nur eine Gartenzierpflanze war und verwildert auf Komposthaufen oder Schutthalden vorkam, sondern ebenso wie Nigella sativa bereits zu Anfang des 16. Jahrhunderts auch in Mitteleuropa kultiviert und auf Feldern angebaut wurde. Die Verwendung des Schwarzkümmels als Gewürz mag hierfür vorrangig gewesen sein, doch die frühere offizinelle Nutzung als Heilmittel aufgrund von Wirkstoffen des ätherischen Öls ist ebenfalls in Studien über Arzneipflanzenkultur und Kräuterhandel belegt. Hinzu kommt die bereits erwähnte Verwendung von deutsch-damaszenischem Erdbeer-Schwarzkümmel zur Aromatisierung von Süßspeisen, leckeren Obsttörtchen, Likören und sogar Schnupftabak.
In Deutschland ist der feldmäßige Anbau beider Sorten vor allem in der Gegend um Erfurt belegt. In einem Fachbuch aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts werden die Anbaumethoden näher beschrieben. Wie es heißt, bevorzugt die Pflanze leichte lehmige Böden ohne frische Düngung. Sie wurde im Frühjahr ab März oder als Nachfrucht im Herbst eingesät. Etwa Ende August waren die Samen reif, was an einer dunklen Färbung der Samenkapseln erkennbar war. Nach der Ernte wurden die Pflanzen noch einige Tage gebündelt liegen gelassen, damit die Samen nachreifen und trocknen konnten. Wenn das Kraut dürr war, wurden sie wie Getreide ausgedroschen und kühl und trocken gelagert.
Im wesentlichen entspricht dies auch den heutigen Anbau- und Verarbeitungsmethoden des Schwarzkümmels in Nordafrika, Westasien und Indien. Wenn man allerdings bedenkt, daß dieses sonnenverwöhnte Gewächs am besten in sehr warmen und niederschlagsarmen Gegenden gedeiht und lockere Sandböden bevorzugt, stellt sich doch die Frage, ob die klimatischen Bedingungen und die Bodenverhältnisse in Mitteldeutschland für eine optimale Entwicklung der kraftvollen Inhaltsstoffe auf Dauer überhaupt geeignet sind bzw. waren. Eigentlich können nur trockene, luftige Umweltwirkungen solche fiederigen, „zerlufteten“ Blätter hervorbringen, wie der Kräuterpfarrer Weidinger es so treffend ausdrückt. Noch mehr von den äußeren Bedingungen betroffen sind allerdings die Samen. Schon in den alten Quellen reicht die Charakterisierung der Pflanze von „warm und trocken im zweiten Grad“ bis zu „hitzig und trocken im dritten Grad“. Wenn in Zedlers Universallexikon (18. Jh.) mehr als ein halbes Dutzend derjenigen Schwarzkümmelarten aufgezählt wird, die medizinisch am meisten verwendet werden, fehlt auch nicht der aufschlußreiche Hinweis:
Den Samen braucht man zur Artzney, und wird selbiger aus Italien verschrieben, weil er viel besser ist als der, so in Deutschland zu wachsen pfleget.
In nördlichen Ländern ist der Samenertrag deutlich geringer, und auch auf salzigen oder sauren Böden gedeiht die Pflanze wesentlich schlechter. Daher ist es nicht verwunderlich, daß sich aus syrischen Schwarzkümmelsamen, die vor einigen Jahren zur Probe in Deutschland ausgesät wurden, weniger kräftige Pflanzen entwickelten; die Samen waren kleiner und runzliger. Bei entsprechenden Versuchen mit ägyptischem Saatgut wurde eine ganz besonders schlechte Keimfähigkeit festgestellt. Damit könnten wir gleichzeitig auch den Schluß ziehen, daß eine deutsche Nigella damascena, die vom Mittelmeer oder aus dem Zweistromland an die Flußauen von Unstrut und Saale oder in rheinische Bauerngärten verpflanzt worden ist, sich von der „echten“ syrischen Urpflanze auch in ihrer Wirksamkeit erheblich unterscheiden muß. Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß sich durch andere Böden, klimatische Verhältnisse und möglicherweise weitere Ursachen insbesondere die Ölqualität erheblich verändern kann. So konnte beispielsweise nachgewiesen werden, daß sich durch eine Kultivierung von Schwarzkümmel unter kühleren Bedingungen das Fettsäurespektrum zugunsten der gesättigten Fettsäuren verschiebt.
Schwarzkümmel blüht und gedeiht nicht nur in Ägypten
An dieser Stelle scheint es angebracht, ein paar Anmerkungen zum Thema „ägyptischer Schwarzkümmel“ einzufügen. Wie aus den bisherigen Darstellungen bereits ersichtlich sein dürfte, hat der Schwarzkümmel nicht nur ein einziges arabisches Ursprungsland, sondern stammt aus einer zwar überschaubaren, aber dennoch ausgedehnten Herkunftsregion. Ebensowenig haltbar scheint die häufig propagierte These, daß ägyptischer Schwarzkümmel die beste Qualität und demnach auch die besten Heilwirkungen habe. In einer Broschüre der Firma Melasan, die sogar selbst ägyptischen Schwarzkümmel anbietet, findet sich ein sehr treffender Kommentar dazu:
„Die Heimat des Schwarzkümmels sind die sonnenreichen warmen Länder rund um das Mittelmeer. Die so oft strapazierte Werbeaussage, daß nur der ägyptische Schwarzkümmel bester Qualität entspricht, ist eine jener Geschichten aus 1001 Nacht!“
In der Tat fällt es auch schwer, die ebenfalls propagierten unterschiedlichen „landesspezifischen Wirkungsschwerpunkte“ festzustellen. Sollte demnach etwa ägyptischer Schwarzkümmel vorzugsweise krampflindernd auf die Bronchien wirken, syrischer Schwarzkümmel die Milchsekretion fördern und türkischer Schwarzkümmel „nur“ gegen Magendrücken helfen? Natürlich spielen unterschiedliche klimatische Bedingungen und die Bodenverhältnisse beim Anbau eine wichtige Rolle. Fast noch wichtiger ist jedoch die sorgfältige Selektion des Saatgutes, das aber nicht länderabhängig ist. Abweichungen bei den Analyse-Ergebnissen, zum Beispiel im Hinblick auf das Fettsäurespektrum oder den Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen, lassen sich zum einen durch unterschiedliche Samenarten und möglicherweise sogar durch eine Fehlbestimmung von Varietäten als vermeintlich echtem Schwarzkümmel erklären; zum anderen sind sie aber auch auf die unterschiedliche Sorgfalt bei den Produktionsmethoden zurückzuführen, wie im folgenden Kapitel noch näher ausgeführt werden wird.
Auch das vom Berliner Arbeitskreis Immunologie (AI) vertretene Argument, wonach nur für den ägyptischen Schwarzkümmel bestätigte Heilwirkungen bekannt seien, kann leicht widerlegt werden. Abgesehen davon, daß solche Wirkungen schon lange aus der Erfahrungsheilkunde bekannt sind, wurde bereits in den Jahren 1991–1995 von den beiden syrischen Ärzten Dr. Refai und Dr. Yahia eine überwachte Studie mit Schwarzkümmel aus syrischem Anbau veranlaßt. Die dafür notwendigen klinischen Studien wurden sowohl in Deutschland als auch parallel dazu in Syrien, die Laboruntersuchungen nur in Deutschland durchgeführt. Hierfür wurde ein besonders schonend hergestelltes und auch entsprechend mildes, fast angenehm schmeckendes Schwarzkümmelöl verwendet. Darin fehlten weder besonders gehalt- oder wertvolle Inhaltsstoffe noch konnten bei den Wirkschwerpunkten irgendwelche gravierenden Abweichungen gegenüber ägyptischem Schwarzkümmelöl festgestellt werden.
Auch in der Türkei sind zahlreiche moderne wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt worden, worüber das Literaturverzeichnis im Anhang des Buches Aufschluß gibt.
Im Vorderen Orient gibt es die Gleichsetzung von Nigella sativa mit ägyptischem Schwarzkümmel nachweislich nicht. Dagegen ist bekannt, daß von Ägypten bei Lieferengpässen Schwarzkümmel aus Syrien und der Türkei bezogen wird. Ebenso wird beispielsweise syrischer Schwarzkümmel in dem fruchtbaren Schwemmland am oberen Nil kultiviert. Nach Ägypten gibt es inzwischen auch in Syrien und Pakistan Schwarzkümmel (Öl) aus kontrolliert biologischem Anbau. Bei der großen Akzeptanz, die dieser wertvolle Helfer aus der Natur inzwischen auch im Westen genießt, wäre es wünschenswert, das Augenmerk zum Wohl der Allgemeinheit mehr auf höhere Qualitätsanforderungen als auf fragwürdige Werbestrategien gegen mißliebige Konkurrenten zu richten.
Tradition und Moderne wirken zusammen
Wissenswertes über Anbau, Samengewinnung und Ölpressung
Schwarzkümmel wird heute vor allem in Ägypten, im Sudan und in Äthiopien, in einigen Mittelmeerländern, in Syrien und der Türkei, im Irak, in Iran, Pakistan und Indien angebaut. Aufgrund der großen Nachfrage im Westen sind neuerdings auch die USA zu einem Anbauland avanciert. In den meisten dieser Länder herrschen ideale Wachstumsbedingungen, nämlich ein warmes, sehr sonniges und trockenes Klima sowie die geeigneten Bodenverhältnisse, damit die Pflanze die kraftvollen Inhaltsstoffe in ihren Samenkapseln optimal entwickeln kann. Schwere, fette Böden oder eine kalte Witterung bekommen der Pflanze nicht, durch zu große Luftfeuchtigkeit erhöht sich die Gefahr von Pilzbefall und anderen Pflanzenschädlingen. Der Anbau erfolgt häufig noch nach traditionellen Bedingungen, was bei den Produktangaben als „konventioneller Anbau“ bezeichnet wird. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und Umstellungsproblemen, als der hiesige „Schwarzkümmel-Boom“ noch in den Kinderschuhen steckte, haben sich inzwischen jedoch auch biologische Methoden etablieren können. Zumindest in Ägypten, Syrien und Pakistan gibt es bereits Schwarzkümmel aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA), zum Teil in Demeter- und Naturland-Qualität und von Ecovert zertifiziert.
Mit zunehmender moderner Erforschung und wissenschaftlicher Untersuchung des Schwarzkümmels, seiner Anwendungsmöglichkeiten und Wirkungen sind auch die Erkenntnisse über geeignete Methoden beim Anbau und in der Ölgewinnung vielfältiger geworden. Schwarzkümmel kann von der Aussaat bis zur Endverarbeitung ohne Chemie auskommen, wenn bestimmte Regeln berücksichtigt werden, und bei der Ölgewinnung ist insbesondere auf Kaltpressung und Schutz vor Oxidation zu achten.
Schwarzkümmel ist eine einjährige Pflanze. Der Zeitpunkt für die Aussaat ist länder- und wärmeabhängig. Meistens erfolgt sie zwischen September und November, kann aber auch in den Winter hineinreichen und z. B. in Syrien bis in den Februar gehen. Regional bedingt, gibt es außerdem Länder mit zwei Ernten, im Frühjahr und im Herbst. Bis zur Blütezeit werden die Pflanzen bewässert, aber nicht mehr von dem Zeitpunkt an, wenn sich die Fruchtkapsel zu bilden beginnt, damit der Samen trocken bleibt. Im Sommer, meistens im Juli, kann nach der Blüte geerntet werden, sobald sich die Kapseln dunkel färben und die Pflanzen zwar noch grün sind, die Blätter aber bereits von unten her abzusterben beginnen – ein sicheres Zeichen dafür, daß die Kraft der Pflanze nun in die Samenkapsel übergeht.
Die Pflanzen werden 5 cm über dem Boden abgesichelt. Wichtig ist, daß sie abends oder vor Sonnenaufgang, wenn die Samenkapseln noch keinen Tau aufgenommen haben, geschnitten werden. Eher selten sind auch Hinweise auf den Zeitpunkt der Ernte zu bestimmten Mondständen zu finden. Die Pflanzen werden dann gebündelt und im Schatten auf großen Tüchern zum Trocknen ausgebreitet. In dieser Zeit sollen die Pflanzenbündel oft hin- und hergewendet werden. Nach etwa einer Woche springen die Samenkapseln von selbst auf, und die Samen können, wie Getreide, ausgedroschen werden. Das weitere Vorgehen hängt davon ab, ob sie als ganze Samen verkauft werden oder entweder direkt vor Ort oder im Verbraucherland zu Öl gepreßt werden.

Samenkapsel (vergr.) der Nigella sativa

Querschnitt der Samenkapsel (Sammelbalgfrucht)

Längsschnitt der Samenkapsel

Schwarzkümmelsamen (dreikantig und querrunzlig)
In Ägypten wird Schwarzkümmel auf großen Ackerflächen im Süden am oberen Nil sowie in ausgesuchten Oasen inmitten der arabischen Wüste angebaut. Das Interesse des gesundheitsbewußten Westens, wo vor allem Schwarzkümmelöl als Nahrungsergänzung Verwendung findet und durch entsprechende Analysen überprüft wird, dürfte eine gute Motivation für den Anbau und die Verarbeitung „nach biologischen Grundsätzen“ bieten. Die uralten Ölmühlen mit Quetschsteinen aus Rosengranit und hölzernen Handpressen (und die damit verbundenen Vorstellungen vom archaisch einfachen, aber dafür ganzheitlichen Leben) dürften mittlerweile – zumindest teilweise – der Vergangenheit angehören, denn zumal die westlichen Handelspartner haben ein Auge auf die hygienischen Verhältnisse, unter denen die hochempfindlichen Schwarzkümmelsamen zu dem für Oxidation sehr anfälligen Öl gepreßt werden. Das gleiche gilt für die Bedingungen beim Filtrieren und Abfüllen, bei der Lagerung und beim Transport.
Tatsächlich sind aus den traditionellen Erfahrungen mit Anbau und Weiterverarbeitung wertvolle Impulse zu übernehmen. Dazu gehört beispielsweise der natürliche chemiefreie Anbau von Schwarzkümmel im Fruchtwechsel mit Leguminosen, das heißt nicht als Monokultur, sowie die Verwendung von eigenem, sehr keimfähigem und ungebeiztem Saatgut. Erstrebenswert wäre hier die Verbindung von traditionell orientalischer Kultur mit dem westlichen Standard bestimmter Qualitätsanforderungen, die durch Laboruntersuchungen gestützt werden.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.