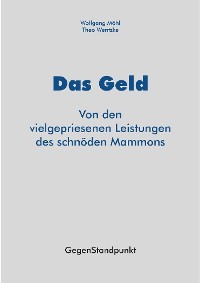Kitabı oku: «Das Geld», sayfa 2
Das Geld bringt’s
Dass man nicht viel zu bestellen hat, wenn man in der Marktwirtschaft, einmal in den Besitz einiger Kreuzer gelangt, sein Geld ausgibt und die erstandene Ware verbraucht, ist schon dem Geizkragen eingefallen, der als Charakter die schöne Literatur bevölkert. Der Schatzbildner zieht jene Form des Sparens vor, die im Verkaufen und im Behalten des Geldes besteht. Dass er auf die in der Warenwelt gebotenen Genüsse verzichtet, weil er mit dem Geld die Macht über sämtliche Bedürfnisse an Land zieht, macht ihn komisch. Freilich belacht niemand das verständliche Ansinnen, Geld anzuhäufen: Wegen der Entsagung wird sein Bedürfnis nach dem universellen Kaufmittel schiere Habgier, der arme Reiche eine lächerliche Figur.
Vernünftiger sieht der Hang zum Geld schon aus, wenn geborgt wird. Wo es um die Versilberung von Waren geht, wird oft geliefert, ohne dass gezahlt werden kann. Momentane Zahlungsunfähigkeit darf kein Hindernis sein für Kauf und Verkauf, lautet der Beschluss. Und wenn es sich nicht gerade um einen Akt des Pumpens handelt, in dem arme Leute ein gegenwärtiges Bedürfnis befriedigen, um es mit künftigem Verzicht zu bezahlen, ist jedem klar, dass Kredit eine seriöse und unerlässliche Geschäftstechnik darstellt. Er beruht nämlich darauf, dass „der Markt“ Überschüsse hergibt. Wer Zahlungsaufschub gewährt, gesteht ja ein, dass für die Fortführung seiner Marktbeteiligung genug Geld da ist; für die fällige Begleichung der Schuld nach vereinbarter Frist steht der Staat, als Wächter über alle Verträge, zur Verfügung. Wo Schuldenkonten zur Regel werden und die Geldforderungen wie Geld behandelt werden und funktionieren, hat die Akkumulation von abstraktem Reichtum eben schon ihre Fortschritte gemacht – irgendwie hat der Tausch da zur Anhäufung von Geld geführt...
Dasselbe gilt für den Staat, der über sein Bankwesen den Austausch seines lokal begrenzten Marktes bzw. seiner Geschäftsbürger mit dem Ausland saldiert – und Geldguthaben genauso schätzt wie einen Schatz aus Gold. Den Weltmarkt sehen Staaten von vornherein als Mittel für die gute Ausgestaltung ihrer Bilanzen an, und das „Hungerproblem“ erübrigt jeden Verdacht, dass es beim internationalen Austausch um die allseitige Versorgung mit Gütern ginge. Der Markt ist da von vornherein ein Mittel zur Gewinnung von ökonomischer Macht, und die beziffert sich in Geld, der Form universellen Reichtums...
Kapital – die Kunst der Geldvermehrung
Das Geld ist nicht der Knecht der Güter und schon gar kein Hilfsmittel für ihre termingerechte Verteilung. Mit Geld macht man sich den Markt dienstbar, wenn man es versteht, es so auszugeben, dass man es behält und immer mehr übrig hat. Die alten Techniken, aus dem Kaufen und Verkaufen einen Beruf zu machen oder das Geld zu verleihen, gegen einen Preis natürlich, haben sich da als wegweisend erwiesen. Diese frühen Erfindungen, welche sich bis heute gehalten haben, beruhen auf dem Prinzip, dass andere für die Erhaltung und Vermehrung des eigenen Vermögens mit aufkommen. Und sie haben – im Verein mit staatlichen Verpflichtungen aller Art – den Blick für die Notlage freigemacht, welche das Dasein der gewöhnlichen Statisten des Marktes bestimmt. Diese Menschen müssen beständig darauf sinnen, an Geld zu kommen, um sich auf dem Markt wieder einzudecken. Da sie zwar bereit sind, ihrerseits etwas Verkäufliches herzustellen, aber die dafür notwendigen Mittel nicht finanzieren können, lag es für potente Geldgeber nahe, ihnen die Gelegenheit zur Arbeit zu verschaffen. So wäscht eine Hand die andere, ein Zug von Humanität streift die kalte Welt des berechnenden Tausches, und der Nachschub an Waren für den Markt ist auch sichergestellt.
Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist mit andern Worten der einzig senkrechte Umgang mit Geld. Oder andersherum: Das Geld diktiert ein ganzes Produktionsverhältnis. Allen, die über so wenig Mittel verfügen, dass sie das Geld einfach für ihren Lebensunterhalt ausgeben und nach dem Verzehr der erstandenen Sachen wieder an Geld kommen müssen, wird mit der segensreichen Einrichtung einer „abhängigen Beschäftigung“ die Möglichkeit eröffnet, mit den Tücken des Zirkulationsmittels zurechtzukommen. Vorausgesetzt, ihre Arbeit ist rentabel für das Eigentum, das die kostspieligen Arbeitsplätze bereitstellt und die Produkte preiswert an den Mann bringt, kriegen sie ein Entgelt, das sie sich einteilen können. Dabei hilft ihnen der Staat, dessen Gewalt die Scheidung der Arbeit vom Eigentum bewerkstelligt und überwacht, mit seiner Abteilung „Soziales“. Zwangssparen für Notfälle ist u.a. schon deshalb angezeigt, weil aufgrund der Kalkulation mit den Arbeitsplätzen der Lebensunterhalt von Lohnabhängigen bisweilen gar nicht lohnend ist und neben der gewöhnlichen Armut derer, die sich als Mittel der Vermehrung fremden Eigentums bewähren dürfen und da mit dauernden Veränderungen von Lohn und Leistung konfrontiert sind, immer auch einiges an Verelendung fällig ist. Entscheidend in all diesen Fragen bleibt das Wachstum – wessen: das ist keine Frage –, ohne das gleich alle aufgeschmissen sind, weil alles und alle von ihm abhängen.
Insofern ist das Geld, von dem niemand genau sagen kann, wer es erfunden hat, eine sehr fortschrittliche Sache. Es bildet gewissermaßen das einigende Band zwischen denen, die es haben und als ihr Mittel verwenden, und denen, die ihm dienen, wenn sie die Produktionsmittel anderer bedienen: Beide Seiten verdienen Geld mit Arbeit. Die einen so viel Geld, wie sie rentabel arbeiten lassen. Die andern können – zumindest wenn es ihnen gelingt, sich auf dem Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz zu kaufen – frei und gleich die kleine Zirkulation in Schwung halten: Arbeitskraft verkaufen, Arbeit abliefern, das Verdiente auf den Markt werfen. Ihre Behandlung als Kostenfaktor, noch so ein Sachzwang des Geldes, garantiert, dass sie nicht übermütig werden – und öfter mal arbeitslos dazu.
1) Aus: MSZ – Gegen die Kosten der Freiheit, Marxistische Streit- und Zeitschrift, 9-84.
© 2017 GegenStandpunkt Verlag
Was jedermann geläufige Erfahrungen durchaus lehren könnten: Einige ökonomische Wahrheiten, Ware und Geld betreffend1)
In der freien Marktwirtschaft hat alles seinen Preis, vom Badewasser über die Kinokarte bis zum Krankenhausaufenthalt. Die Freiheit, die jedermann zuteil wird, besteht darin, dass man mit Geld prinzipiell zu allen Notwendigkeiten und Genüssen Zugang hat, die der Markt bereithält; ihre Schranke hat diese Freiheit freilich an der Menge Geldes, über die einer verfügt. Arm und reich scheiden sich danach, wie viel sie von jenem Stoff ihr eigen nennen, der Reichtum schlechthin darstellt und auch dann zur Bezifferung ihres Vermögens herangezogen wird, wenn dieses in Gestalt von sachlichen Gütern aller Art existiert. So bedeutsam die Eigenschaften eines Hauses für seine Bewohner, einer Maschine für ihren Benutzer, eines Nahrungsmittels für seinen Konsumenten sein mögen, so gleich-gültig wird diese Beschaffenheit, wenn sämtliche Gegenstände daraufhin geschätzt werden, was sie zum Reichtum einer Privatperson oder einer Institution beitragen. Dann gerät ihre Brauchbarkeit zu einer selbstverständlichen Voraussetzung des Preises, den sie auf dem Markt erzielen würden, stünde ihr Verkauf an.
1. Die Lehre der VWL: Von der Unverzichtbarkeit des Geldes für die Marktwirtschaft
Dieses Phänomen, dass sämtliche Güter ihren Preis haben und dieser seinen Maßstab im Gelde, wird in der ökonomischen Wissenschaft einer eigenartigen Würdigung unterzogen. In seltener Einmütigkeit bemühen die Theoretiker den Vergleich mit dem Naturaltausch, um das Geld als eine Möglichkeit zu besprechen, die Schwierigkeiten bei der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zu lösen. Die Konfrontation mit dem „umständlichen“ Verfahren, im direkten Austausch von Gut gegen Gut der Sachen habhaft zu werden, die einer braucht oder benützen will, bemüht die Vorstellung einer arbeitsteiligen Produktion, die auf den Tausch angewiesen ist, aber dessen Mittel gerade nicht bereithält. Statt einer Bestimmung von Geld und Preis will diese Vorstellung sehr umstandslos auf eine plausible Darlegung der Vorzüge hinaus, die das Geld für „wirtschaftende“ Menschen aufweist – unter der Bedingung, dass jedermann auf den Tausch angewiesen ist, wird er sich den Diensten des Geldes kaum verschließen können, lautet die schlichte Botschaft. „Geld vereinfacht das Wirtschaften“, verkündet Samuelson in seinem Bestseller,2) und sämtliche Lehrbuchautoren eifern ihm nach, wenn sie sich „eine arbeitsteilige Wirtschaft mit hohem Niveau‘‘, „das Funktionieren des sozialökonomischen Gesamtprozesses“ oder ganz einfach „Märkte und Preise“ ohne Geld nicht denken können. Wenn sie sich zusätzlich noch den am Gegenbild des Realen Sozialismus der Sowjetunion und ihres Staatenblocks orientierten Vergleich mit einer „autoritär gelenkten Wirtschaft“ zueigen machen, die sich des wirtschaftlichen „Grundproblems“ der „Verteilung knapper Güter“ mit einer anderen „Möglichkeit“ angenommen hat, fällt ihnen keineswegs auf, dass es mit dem erklärenden Charakter ihrer Erörterungen nicht weit her sein kann, wenn dasselbe Problem, in dem sie den Grund des Geldes erblickt haben wollen, ebenso gut für jene unsympathische Zwangsbewirtschaftung der menschlichen Individualität verantwortlich zeichnet. Eher verleihen sie bei der Betrachtung der gewiss nicht besinnlichen Materie Geld ganz offiziell ihren weltanschaulichen Vorlieben Ausdruck und interpretieren die Wahl der einen oder anderen „Möglichkeit“ als Konsequenz individualistischer oder kollektivistischer Menschenbilder.
Wenn Nationalökonomen das Kunststück hinter sich gebracht haben, von Märkten, Preisen und Tausch zu reden und dabei zielstrebig das Geld beiseite zu lassen, damit sie den „Schluss“ ziehen können, dass ohne dieses Mittel manches „unmöglich“ wäre, steht ihnen die Frage offen, wie es dem Geld gelingt, seinen Auftrag als Tauschmittel und Recheneinheit zu erfüllen. Auskünfte der folgenden Art sind dann gute wissenschaftliche Sitte: „Geld wird genommen, weil andere es nehmen.“ „Wird ein Gut so ausgestattet, dass es allgemeine Annahmebereitschaft findet, bezeichnet man es als Geld.“ Das ist auch gar nicht verwunderlich: Wer die Dienste des Geldes damit identifiziert, dass es dem Bedürfnis entspricht, durch ein allgemeines Tauschmittel vom Naturaltausch loszukommen und Marktwirtschaft zu treiben, der ist auch der psychologischen Fortsetzung seiner Deduktion mächtig. Die Bereitschaft, ein Gut als Geld zu behandeln, klärt dann alles auf; und der kundigen „Definition des Geldes“, die ein deutscher Nationalökonom von Ruf, Erich Preiser, wie Samuelson beherrscht – „Geld ist alles, womit man zahlen kann“ –, kann sich der „Große Meyer“ getrost anschließen: „Geld ist alles, was wie Geld funktioniert.“ Preiser ist sich des Verfahrens, das seine Disziplin hier anwendet – der „Ableitung“ des Geldes aus der Leerstelle, die sein Fehlen in der Marktwirtschaft hinterlassen würde –, durchaus bewusst und belehrt seine Leser über die Legitimität eines derart zirkulären Denkens mit dem offenherzigen Hinweis, dass moderne Wissenschaft selbst aus der Tatsache, dass es ihren Gegenstand gibt, eine Annahme macht:
„Wir haben ganz einfach stillschweigend angenommen, dass es da ist. Diese Annahme ist nötig, aber (!) sie genügt auch. Sie ist nötig, weil die Marktwirtschaft ohne ein allgemeines Tauschmittel natürlich nicht funktionieren könnte.“ 3)
Da in solchen Mitteilungen nur explizit ausgedrückt wird, was in der Logik der (Un-)Möglichkeit enthalten ist – das Tauschmittel muss es geben –, pflegen die Sachverständigen der VWL die Leistung von Preisen, die mit Geld bezahlt werden, dauernd hervorzuheben, um außer dem schieren Vorhandensein ihres Gegenstandes noch einen respektablen Dienst anzugeben:
„Die Preise haben in der Marktwirtschaft die wichtige Funktion, die Güterströme in ihrer Stärke und Richtung zu regulieren.“ 4)
So kündigt die VWL noch lange vor ihrer Ausgestaltung zur Nutzen- oder Haushaltstheorie an, dass sie den „Marktmechanismus“ oder die „Wettbewerbsordnung“ schätzt; und zwar für das bekannte Gesetz der Wechselwirkung, nach dem die Höhe der Preise das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bestimmt und umgekehrt dieses Verhältnis auf die Preise einwirkt. In diesem Gesetz spricht die Wissenschaft jenseits und bar einer Bestimmung des Preises dem Markt das Kompliment aus, dass er durch die Unterwerfung des Bedarfs an Gütern unter die Zahlungsfähigkeit seiner Träger zu einer Verteilung des Reichtums führt; ganz so, als sei die wirtschaftende Menschheit auf das Problem gestoßen, ihre Güterströme zu regulieren, und auf das Geld verfallen, um die Güter mit Hilfe eines Preises gleichwertig zu verteilen, gestattet sich die Wirtschaftstheorie die Annahme eines Gleichgewichtspreises. Eine hypothetische Kategorie dieser Art fasst den Wechselwirkungsgedanken in einem Terminus zusammen und gibt weniger Aufschluss über die Natur des Marktes als über das Interesse einer ganzen wissenschaftlichen Disziplin an seinem Funktionieren. Auf der Grundlage des Idealismus, der im Kauf und Verkauf von Gütern – deren Preise durch das glücklicherweise vorhandene Geld gemessen werden können – das Interesse am Werk sieht, sämtliche Elemente des sachlichen Reichtums dahin zu verfrachten, wo sie hingehören, stellt sich dann der Realismus der VWL ein: Auf der einen Seite widmen sich ihre Vertreter den Entscheidungen der Haushalte als Faktoren der Preisbildung, wobei sie das „Konsumverhalten“ in getreuer Fortschreibung des Dogmas der Wechselwirkung zwischen Angebot/Nachfrage und Preis einmal als Bestimmungsgrund des Preises (bzw. seiner Höhe), einmal als Reaktion auf die Preisgrößen darlegen. Auf der anderen Seite stellen sie sich die Frage nach den Bedingungen, die in der Welt der Wirtschaft erfüllt sein müssten, um das Gelingen des Marktes entsprechend der ihm zugedachten Aufgabe zu gewährleisten. Und zu einer solchen Bedingung wird – und zwar deswegen, weil es von vornherein als für die Ermöglichung des Tausches zuständiges Mittel und sonst nichts in Betracht gekommen ist – auch das Geld. Die Frage: „Was ist Geld?“ übersetzen Ökonomen deshalb immer in eine ganz andere: „Wie muss das Geld beschaffen sein, um seine Dienste zu verrichten?“ – und mit den Funktionen des Geldes meinen sie stets diejenigen, die sie für das Kaufmittel in der Marktwirtschaft vorgesehen haben. Realistisch geben sie sich in ihren Fragen und Antworten insofern, als sie auf allgemein bekannte Erscheinungen des Wirtschaftslebens verweisen – Inflation, Krisen mit unverkäuflichen Waren, Preissteigerungen, „Ungleichgewichte“ eben –, in denen ihren Idealen offenbar zuwiderlaufende und die schönen Wirkungen des Preismechanismus in Frage stellende „Probleme“ zutage treten. Preiser bringt es fertig, die „Bedingung“ dafür, dass das Geld als Mittel des Kaufs taugt, zunächst ganz rational zu erörtern, nämlich mit dem Hinweis auf den Charakter des Geldes, der es überhaupt zum Mittel macht:
„Wenn es als Zahlungsmittel, insbesondere zum Kauf von Gütern dienen soll, so muss es offenbar selbst Wert haben. Denn sonst wäre niemand bereit, ein Gut gegen Geld herzugeben – wir haben solche Zeiten erlebt.“
Hier wird tatsächlich einmal die „Bereitschaft“, Geld anzunehmen gegen ein anderes Gut, nicht mit der Definition des Geldes verwechselt. Und noch mehr: Preiser kennt auch den Begriff des Maßes, der Einheit von Qualität und Quantität:
„Dazu kommt aber ein zweites. Die Einheit des Zahlungsmittels ist ja zugleich die unentbehrliche Recheneinheit, in der die Preise ausgedrückt, die Kosten berechnet und die Einkommen bemessen werden. Der Wert wirtschaftlicher Güter aber kann nur in einem Maßstab ausgedrückt werden, der selbst die Dimension ,Wert‘ hat...“
Allerdings fährt auch dieser Theoretiker nicht in der Weise fort, dass er die in Anführungszeichen gesetzte Dimension „Wert“, das Waren und Geld gemeinsame Maß, seiner Qualität nach bestimmt. Kaum hat er festgestellt, „dass Geld Wert haben muss“, besinnt er sich darauf, dass es ihm ebenfalls nur auf die praktische Leistung des Geldes ankommt, seine „Kaufkraft“, die auch ganz jenseits theoretischer Bemühungen die Gemüter beunruhigt; deshalb schließt er sich den praktischen Erwägungen eines Geldbesitzers an, dem der „Wert“ des Geldes herzlich gleichgültig ist, seine Macht, Güter zu kaufen, dagegen alles bedeutet. Er identifiziert den Erfolg des Kaufs kurzerhand mit dem „Wert“:
„... es ist auch klar, dass dieser Wert nicht am Geld selbst haftet, sondern sich von den Gütern herleitet, die man mit dem Geld kaufen kann. Mit anderen Worten, das Geld hat einen abgeleiteten, einen mittelbaren Nutzen.“
Und von dieser „Einsicht“ beflügelt, fallen ihm erneut die Zeiten ein, die er schon erlebt hat, in denen es mit der Kaufkraft des Geldes nicht weit her war; woraus sich der „Schluss“ ziehen lässt, dass damals das Verhältnis von Gütern und Geld, auf dessen Gelingen er sinnt, ziemlich durcheinander geraten war:
„Ob man überhaupt für das Geld etwas bekommt und wieviele Güter man kaufen kann, hängt von der Menge des Geldes ab, die den Gütern gegenübertritt. Eine Vermehrung der Geldmenge bei gleichbleibender Gütermenge, wir können auch sagen: eine Zunahme der monetären Nachfrage bei gleichbleibendem Angebot wird die Preise steigen, d.h. den Wert des Geldes sinken lassen. Das ist der Inhalt der sog. Quantitätstheorie, die auf die Menge des Geldes abhebt, und die nur ein anderer Ausdruck dafür ist, dass über den Wert des Geldes seine relative Seltenheit entscheidet.“
Die Bedingung, die hier für das Funktionieren des Geldes als Tauschmittel angegeben wird, lautet schlicht: Es muss in rechtem Maße vorhanden sein! Dies ist ein sehr offenherziger Abschied von der Bühne der Geldtheorie, die mit dem Anspruch auftritt, Auskunft über den Begriff des Geldes zu geben, durch den auch der Grund und Zweck dieses ökonomischen Mittels erfasst wäre. Denn das rechte Maß ist genau so relativ wie die Definition des Geldwerts, die sich die Quantitätstheorie erlaubt – im Funktionieren nicht nur des Marktes, sondern der gesamten Marktwirtschaft mit ihren mannigfaltigen Bedingungen, Faktoren und Zielen erst stellt sich heraus, ob das Geld die Leistungen vollführt, zu denen ihm die VWL ständig gratuliert:
„... die Schaffung des Geldes ist ein Teil der laufenden Wirtschaftspolitik. Daher kann der Theoretiker auch gar nicht angeben, welches das ,richtige Maß‘ ist... Was das richtige Maß ist, kann daher nur im Zusammenhang mit der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung und allen von der Wirtschaftspolitik angesteuerten Zielen entschieden werden, nicht aber im Rahmen einer für sich betriebenen Geldtheorie. Mit Sicherheit läßt sich nur sagen, dass jedes Abweichen von der Politik stabiler Preise gefährlich ist.“
So unterstellt die Nationalökonomie einen Preismechanismus, der gerade über die Veränderung der Preise funktioniert und die Güterströme reguliert – und bezweifelt diese Leistung des Preises, wenn sie vom Staat im Umgang mit dem Geld „Preisstabilität“ verlangt. Sie attestiert dem Geld, dass es die preisbestimmten Güter frei von allen zeitlichen und lokalen Schranken, die am Naturaltausch beklagt werden, zirkuliert und kommensurabel macht – bestreitet aber, dass Waren untereinander und mit dem Geld kommensurabel sind, ein gemeinsames Maß haben. Dass Geld Zirkulationsmittel ist, hat diese Wissenschaft bemerkt; auf die Frage, wodurch es als solches taugt, erteilt sie die Antwort: dadurch, dass es die Recheneinheit für die Preise liefert und den Austausch vermittelt. Aus der Tatsache, dass die Wirtschaftssubjekte mit dem Markt, mit preisbestimmten Gütern und Geld konfrontiert sind, deduziert sie ihre Bestimmung des Geldes. Es wird gebraucht für den Austausch – „also“ ermöglicht es ihn, und darin besteht seine Leistung. Der Grund und Zweck von Preis und Geld liegt dieser Logik zufolge darin, dass sie den Notwendigkeiten eines Austausches entsprechen, den man sich unabhängig von ihnen als Bedürfnis vorstellt. Und sooft dem Geld dieser erfundene Vorzug als sein Zweck zugesprochen wird, fällt den Urhebern dieses Gedankens der eine oder andere Fall ein, in dem dieser Vorzug nicht in Kraft tritt bzw. in dem sich „Gefahren“ und „Nachteile des Geldes“ bemerkbar machen – bisweilen ermöglichen Preise und Geld den Austausch gerade nicht, verhindern ihn –, so dass die Nationalökonomen sich vor die Entscheidung gestellt sehen, das negative Urteil, das in ihrer Logik der Möglichkeit von vornherein eingeschlossen ist, entweder als Argument gegen ihre positive Deduktion des Geldes zu begreifen oder den Befund, dass der eine oder andere Kauf auch mal unterlassen wird, für eine dem Geld äußerliche Sache anzusehen. Sie entscheiden sich für die zweite Alternative und schieben den Wirtschaftssubjekten, meist gleich dem Staat, einen verkehrten Umgang mit dem Mittel des Austausches in die Schuhe. Das Gelingen wie das Misslingen des Geschäfts, das ihren Theorien zufolge dem Geld und den Preisen zukommt, ist dann doch keine Angelegenheit des Geldes, sondern eine Frage seiner Handhabung – und die wird entschieden: auf der einen Seite durch die Bedürfnisse und das Verhältnis, das die Subjekte zwischen ihnen aufmachen (Nutzentheorie und Lehre vom „Konsumverhalten“), durch das quantitative Verhältnis zwischen Geld und Gütern andererseits (Quantitätstheorie). So lässt sich noch wider alle Erfahrung und trotz der Bekundung des Gegenteils die Behauptung retten, Geld und Preis seien sinnreiche Erfindungen zur Befriedigung der Bedürfnisse, denen der Austausch in einer arbeitsteiligen Gesellschaft dient.5)