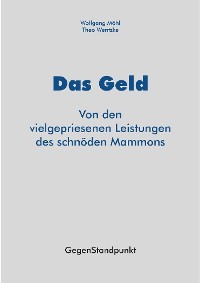Kitabı oku: «Das Geld», sayfa 3
2. Vom Nutzen des Preises und von der „Kaufkraft des Geldes“
Die Wirtschaftswissenschaft erzählt von einem homo oeconomicus, der das Geld schätzt, weil es den Austausch ermöglicht. Der leibhaftige Wirtschaftsbürger lernt das Geld erst einmal ganz anders kennen. An den staatlich ausgegebenen Münzen und Banknoten dürfte er kaum die „Versorgung mit Liquidität“ bemerken. Niemand wird mit Rücksicht darauf, dass alles seinen Preis hat, mit Geldgeschenken bedacht, damit er tauschen kann – nicht einmal die bekannte Sozialleistung im Zuge der Eröffnung der BRD, die 40 neuen Deutschen Mark Kopfgeld, waren in dieser Hinsicht misszuverstehen. Für jedermann war klar, dass es ab sofort darauf ankam, an möglichst viel Geld heranzukommen, also sich mit „Kaufkraft“ zu versorgen. Wie das nicht zu gehen hatte, war ganz nebenbei vom Staat durch den Gesetzestext klargestellt worden, den er auf die Banknoten drucken ließ: „Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht ...“ Dergleichen passt kaum zum Gerücht über jene Zettel, das ihnen die Unschuld eines begrüßenswerten Hilfsmittels nachsagt. Wenn ein Staat mit seiner Gewalt das Geld als Tauschmittel tauglich macht, dann erhebt er ganz bestimmt nicht die individuellen Bedürfnisse zum Zweck des Wirtschaftslebens – er unterwirft deren Befriedigung vielmehr der Zahlungsfähigkeit ihrer Träger. Vom Quantum des öffentlich-rechtlich beaufsichtigten Stoffes, das einer besitzt, hängt seine Betätigung in der Welt der Genüsse ab – und insofern darf man an der wirtschaftswissenschaftlichen Weisheit, das Geld ermögliche das muntere Kaufen auf den Basaren der Marktwirtschaft, eine kleine Korrektur anbringen: Dieses Maß des Reichtums stellt die Verfügung über ihn auch ein wenig in Frage. Schließlich trennt das gewaltsam in Kraft gesetzte Tauschmittel erst einmal sämtliche Bedürfnisse von den ihnen entsprechenden Gegenständen und lässt sie nur unter der Bedingung zum Zug kommen, dass der Preis an den entrichtet wird, dem die Sachen gehören. Freilich übersieht ein Theoretiker, der in das „Gesetz“ von Angebot und Nachfrage verliebt ist und sich viel auf die Weisheit zugute hält, die da lautet „Wenn Preis hoch, nix kaufen!“, sehr souverän das harte Gesetz des Privateigentums, das mit Preis und Geld in Kraft gesetzt wird.
Dieses Gesetz ist einem gewöhnlichen Sterblichen, der die Ausnützung seiner Zahlungsfähigkeit zu spüren bekommt, sehr vertraut. In seiner Erfahrung gibt es nicht den Trost, dass ein „Preismechanismus“ lehrbuchgerecht dem unverschämten Verkäufer einer Ware die Senkung des Preises aufzwingt, sobald die Nachfrage zu wünschen übrig lässt. Die nationalökonomische Harmonielehre mit ihrem Ideal ausgleichender Wechselwirkungen jedenfalls vermag ihm über seine beschränkte Zahlungsfähigkeit nicht hinwegzuhelfen, ebenso wenig wie die Werbung mit ihrer immergleichen Botschaft von der preiswerten Ware: Er muss sich beim Erwerb nützlicher Güter und Dienste einteilen, und er kann nicht darauf bauen, dass seine erzwungene Sparsamkeit deswegen ein Ende nimmt, weil sich die Anbieter von Geschäftsartikeln um sein Budget streiten. Dass zwischen dem Interesse des Verkäufers und denen des Käufers ein Gegensatz besteht, gewahrt gerade die Mehrheit der Wirtschaftssubjekte, die Geld immer nur als Tauschmittel verwendet. Selbst in den Fällen, wo es sich auch beim Käufer um einen Geschäftsmann handelt und bei der zum Verkauf anstehenden Ware nicht um ein Konsumtionsmittel, kommt keine Freude über den „Gleichgewichtspreis“ auf. Das „Resultat“ von Angebot und Nachfrage, der Preis der gehandelten Ware, erfüllt nämlich keineswegs automatisch den ökonomischen Zweck derer, die als Anbieter und Käufer auftreten. Als „zentrales Steuerungsinstrument“ der gelungenen Distribution von Gütern mögen sie den „Preismechanismus“ schon deshalb nicht ansehen, weil der jeweilige Preis einerseits einen Erlös über bereits verausgabte Kosten hinaus garantieren soll, andererseits als Kost in die Kalkulation eingeht, die auf künftigen Überschuss berechnet ist. Hier hat die praktische Frage der Beteiligten danach, ob sie sich den Preis leisten können, der da zustande kommt, von vornherein nichts damit zu tun, ob denn die schönen Maschinen und Rohstoffe auch dort landen, wo man sie brauchen kann. Umgekehrt gelten sie als brauchbar nur, wenn sie dem Geschäftsinteresse durch ihren Preis entsprechen – also sich als Mittel rentabler Investition bewähren.
Solange die Warenpreise diesem Kriterium genügen, ist „der Markt“ auch für seine Nutznießer wie für die ihn idealisierenden Theoretiker in Ordnung – und Bedenken bezüglich der geschwundenen „Kaufkraft des Geldes“ werden nicht laut. Da geht so manches Jahr gedeihlicher Konjunktur ins Land, ohne dass von nationaler und ökonomischer Warte aus Klagen erhoben werden gegen die Vermehrung der Umlaufsmittel, welche sich in der Aufwärtsbewegung der Preise bemerkbar macht. Solche „bloß nominelle“ Erhöhungen werden als selbstverständliche Folge davon registriert, dass lokale und zeitliche Beschränkungen der Zahlungsfähigkeit über das unter staatlichen Direktiven betriebene Bankwesen durch Kredit für unerheblich erklärt werden; dasselbe gilt für die „Geldschöpfung“, welche über die Verschuldung des Staats zustande kommt: Niemand mag so einfach und grundsätzlich die Verwandlung von zirkulierenden Schuldtiteln in Geld und Kapital für etwas Verwerfliches ansehen. Im Gegenteil: Die interessierte Geschäftswelt heißt – wie die nationalökonomische Sachverständigengilde – die Zuständigkeit des Staates für Expansion und Kontraktion des Kredits gut. Der Gebrauch der hoheitlichen Gewalt, welche die „freie Marktwirtschaft“ mit ihren Regeln in Kraft setzt und hält, erstreckt sich ganz natürlich auch auf die „Beeinflussung“ der verfügbaren Menge an Kredit. Dass der Staat auch seinen Geldbedarf deckt, indem er seine Schuldscheine in Geschäftsmittel von Banken und Privatleuten verwandelt, will ebenfalls niemand unterbinden. Die fiktive Alternative – „Eingriffe“ in die „Wirtschaft“ contra „Freiheit“ von „ungesunder staatlicher Lenkung“ – ist zwar im Streit der (wirtschafts)politischen Lager ein Dauerbrenner, tangiert aber nie die „elementaren“ Dienste der Gewalt für das Geschäft. Die Kontroversen über das für „die Wirtschaft“ verträgliche Maß hoheitlicher „Einmischung“ und über staatliches „Fehlverhalten“ gehen ja im Gegenteil davon aus, dass Wirtschaftspolitik – also staatliches Wirken per Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, Nationalbank etc. – zur Betreuung des Geschäfts dauernd stattfindet und vonnöten ist.
Die Klagen über die Inflation, welche urplötzlich ein „Gleichgewicht“ zerstört haben soll, das in der Kalkulation keines einzigen Wirtschaftssubjekts als Zwecksetzung auftaucht, bestreiten denn auch nicht das Recht der Instanzen, die für „Geldschöpfung“ ausgiebig Sorge tragen – sondern die Brauchbarkeit der von ihnen auf den Markt geworfenen Mittel. Dieser Anlass wird allerdings in einer Weise gewürdigt, die keinen Zweifel darüber aufkommen lässt, wofür das liebe Geld seinen Dienst versagt. Zwar zitieren die Anwälte des „Kampfes gegen die Inflation“ gerne den Geldbeutel des kleinen Mannes, unterlassen aber konsequent den naheliegenden Ruf nach Lohnerhöhungen. Vornehm sehen sie über die vollzogene Verwendung des gemäß staatlichem Bedarf immerzu erweiterten Kredits hinweg; dass die Inflation, die sie so verdammen, nur zustande kam, weil sich die Geschäftswelt rücksichtslos bedient hat an der „Liquidität“, die das staatlich erlaubte, gebotene und kontrollierte Kreditwesen gewährt, wird keiner Erwähnung für wert befunden. Das praktische Interesse am Markt legt den Streitern wider das Erzübel „Inflation“ eher die Warnung in den Mund, dass um Gottes und der Marktwirtschaft willen ein Ausgleich der verlorenen Kaufkraft von „unteren Einkommen“ unterbleiben solle. Dergleichen, so lautet ihre Begründung, würde der Verwendung bereits inflationierten Geldes für rentable Investitionen entscheidend entgegenstehen. In ihren Predigten über die „Sachgesetzlichkeit“ namens „Lohn-Preis-Spirale“ nehmen die Aktivisten der marktwirtschaftlichen Preisgestaltung offen die „Reaktion“ vorweg, welche sie zu praktizieren befugt sind – und dies ganz ohne Angst davor, dass ihnen die Theoretiker der Marktwirtschaft die Unglaubwürdigkeit ihrer geheuchelten Sorge um die Inflation vorhalten. Das mag keiner von den nationalökonomischen Lehrern behaupten, dass weder staatliche Instanzen noch Banken oder Unternehmer jene konjunkturgemäß beschworene Rücksicht auf eine konstante Kaufkraft des Geldes üben, dass sie im Gegenteil die Inflation bewirken, auf die sie sich so gerne berufen, wenn in ihrer geliebten Marktwirtschaft die viel gerühmten „Funktionen“ von Preis und Geld anders ausfallen als ihre idealistischen Bilder. Umso lieber hält sich die Volkswirtschaftslehre bei einem „Begriff“ von Inflation auf, der überhaupt nicht geeignet ist, Befürchtungen zu begründen. Jedenfalls stört die aus einer Vermehrung der Umlaufsmittel erwachsende Veränderung des Maßstabs der Preise, die schiere Vergrößerung der Ziffern, die auf der handgreiflichen „Kaufkraft“ stehen, welche für eine Ware bezahlt werden muss, von sich aus keinen einzigen Tauschakt. Dennoch, die quantitätstheoretische Anklage der Inflation entdeckt in der veränderten „Kaufkraft“ der Maßeinheit nicht die gerechte Korrektur für die vermehrte Anzahl der zirkulierenden Tauschmittel, sondern eine Gefahr: ein Missverhältnis zwischen einem „Güterberg“ und einer ihm gegenüberstehenden, zum Kaufen verfügbaren Geldmenge. Die Inflation, quantitätstheoretisch plausibel gemacht als Ausgleich zwischen Anzahl und Einheit am Tauschmittel, findet andererseits so plausibel und unschuldig doch nicht statt: Unsachgemäße Ausnützung und ungleichmäßige Durchsetzung bewirken eine Störung in jenem „Mechanismus“ der „Recheneinheit“, den die Theorie postuliert und „in der Praxis“ zugleich vermisst. Mit diesem „Realismus“ wollen die Theoretiker der Marktwirtschaft allerdings weniger einen Offenbarungseid bezüglich ihrer das Geld betreffenden „Gesetzesaussagen“ leisten als vielmehr unterstreichen, dass sie sich den praktischen Anliegen verpflichtet wissen, die sich für die maßgeblichen Akteure des Marktes ergeben. Mit dem Ideal des Lenkungsmechanismus brechen Wissenschaftler jedenfalls nicht, wenn sie sich dem Konkurrenzgebaren zuwenden und feststellen, dass geschäftstüchtige Unternehmer mit etwas anderem kalkulieren als mit einer „gesunden“ Geldmenge, die ein ebenso „gesundes“ Preisniveau garantiert:
„Das Heimtückische an Veränderungen des Preisniveaus ist, dass sie den marktwirtschaftlichen Lenkungsmechanismus selbst auf unkontrollierbare Weise zerrütten. So helfen z.B. Inflationen Bereichen, die von ihnen als erste erfaßt werden, zu vorübergehenden Vorteilen und lassen Gewinne entstehen, die keine Lenkungsfunktion haben. Immer nämlich bricht die Inflationsflut in noch nicht abgeschlossene Produktionsperioden ein. Dann sind die Erlöse höher als die Kosten, die zu Beginn der Produktionsperiode aufzuwenden waren. Natürlich registrieren die Unternehmer diese Differenz als Gewinne. Erst in der folgenden Periode, wenn nun auch höhere Kosten aufzubringen sind, offenbaren sich diese ,Gewinne‘ als Scheingewinne. Inzwischen aber können die unerwarteten Erlösüberschüsse längst verbraucht oder – was wahrscheinlich ist – für Erweiterungsinvestitionen mitverwandt worden sein, die sich spätestens dann als Fehlinvestitionen erweisen, wenn die Preissteigerungswelle verebbt: An den ursprünglichen Nachfragerelationen hat sich ja nichts geändert. Man müßte blind sein, sähe man nicht, dass Inflationen verschiedenen Leuten echte Gewinne zuschanzen ...“ 6)
Das stimmt einen Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts bedenklich, wenn sein hochgeschätzter Lenkungsmechanismus zuschanden wird. Umso unbekümmerter vermeldet er eine Entdeckung, die ein ganz anderes Licht auf den Markt wirft, von dem er sich ein so stimmiges Bild entworfen hatte. Plötzlich taucht da ein Maßstab des ökonomischen Erfolgs auf, der mit der Zufriedenheit über den gelungenen „Güteraustausch“ und die wundersamen Dienste des Geldes nichts mehr zu tun hat. Dass Kauf und Verkauf stattgefunden haben und brauchbares Zeug unter die Leute gekommen ist, erscheint da ganz selbstverständlich als Voraussetzung und Mittel dafür, dass gewisse Leute ihr Geld nachzählen. Dabei fällt die Kleinigkeit auf, dass sie ihr Geld zählen – also nicht im Traum daran denken, es unter das Volk zu verteilen, damit es seine Aufgabe als bequemes Transportmittel von Gütern erfüllt. Behalten wollen sie es schon, weil das Geld nämlich ihren Reichtum ausmacht. Wenn sie es zur Teilnahme am Marktgeschehen verwenden, so nicht, um es loszuwerden und solange dem Konsum zu frönen, bis sie nichts mehr haben von dem edlen Stoff. Vielmehr, um mehr davon zu verdienen. Und weil dafür das allgemeine Kaufen und Verkaufen von Gütern aller Art genau das richtige Mittel ist, sind die ehrbaren Geschäftsleute auch den Nationalökonomen nicht böse, wenn die mit lauter haltlosen Argumenten den Markt loben, ohne vom Privateigentum etwas verlauten zu lassen. Sie lassen sich die Geschichten vom Geld als Knecht der Warenwelt, der jedermann gestattet, sich kaufend am Güterberg zu schaffen zu machen, gerne gefallen. Und demokratisch gesehen macht es sich auch ganz gut, wenn der Umgang mit Ware und Geld, den die meisten pflegen, auch als der bestimmende Zweck des Marktes hingestellt wird. Wenn erst einmal allgemein, wissenschaftlich wie populär, klargestellt ist, wie nützlich das Geld für den Händewechsel von Gütern ist, die „man“ braucht, aber nicht hat; wenn der ökonomische Sachverstand erst einmal sein Sorgerecht um den tollen Lenkungsmechanismus dargelegt hat und die Probleme seines Funktionierens auftischt; dann fällt den theoretischen Anwälten der Marktwirtschaft ganz nebenbei auch noch ein, dass es aufs Geld ganz anders ankommt als in ihren Lobeshymnen auf das Tauschmittel. Bei Störungen des Marktes, anlässlich von Beschwerden bezüglich mangelnder Kaufkraft in dem einen oder anderen Haushalt wissen sie stets ein „Problem“ zu benennen, dessen Lösung aller Welt als die Bedingung schlechthin am Herzen zu liegen hat. Das Wachstum der Wirtschaft muss gelingen, der in Geld bezifferte Erfolg des Geschäfts muss stimmen, wenn das gewöhnliche Tauschen klappen soll. Als ein Dementi der unbegrenzten Möglichkeiten, die durch das Geld wirklich geworden wären, wollen die Ökonomen derlei Weisheiten freilich nicht verstehen. Ihr Übergang von einer verkehrten, weil an Waren- und Geldmenge plausibel gemachten Theorie der Inflation zum gestörten Geschäftsgang war ja auch nicht als Abschied von den Vorstellungen gemeint, mit denen sie dem Tauschmittel ihr Kompliment machen. Statt der Wahrheit, dass mit dem Geld andere Zwecke in die Welt der Wirtschaft Einzug halten als die regelmäßige Versorgung des Menschen mit Gutem, wollen sie etwas an Belehrung verkünden, was an Verpflichtung gemahnt: Wenn der an sich brauchbare Lenkungsmechanismus samt der durch ihn an sich organisierten Güterverteilung vom Zuwachs privat verfügbaren und fürs Wachstum wiederverwendbaren Geldes abhängt – dann liegt es auch im allgemeinen und ökonomischen Interesse, diese Sorte Wachstum zu befördern.
Was Volkswirtschaftler dem Tausch, dem Preis der Waren, dem Geld nicht entnehmen, ist ihnen also dennoch bekannt. Das, worauf es ankommt in ihrer geliebten Welt von Angebot und Nachfrage, führen sie als Bedingung und Hilfsmittel an – für den reibungslosen Umsatz von Geld und Gut. Den Gedanken, dass es sich womöglich umgekehrt verhält, verwerfen sie, sooft sie ihn aussprechen. Es ist so, als käme es ihnen verwerflich vor zuzugeben, was jedermann weiß: dass das Geld nicht der Knecht des Güterumschlags, sondern der Herr der Warenwelt ist, und dass der Markt für den Nutzen des Geldes geradezustehen hat.
3. Der Wert – weder Metaphysik noch Hypothese
Die moderne ökonomische Theorie hat sich in ihren allgemeinen Betrachtungen des Marktes einen seltsamen Leitfaden zurechtgelegt. Ihr Entschluss, das Geld als eine rundum taugliche Einrichtung darzustellen, nimmt die Aufgabe, etwas zu erklären, von vorneherein wie den Auftrag, dem Gegenstand der Theorie seine Funktionalität zu bescheinigen. Ein solches Denken gefällt sich in der Frage danach, was ohne die besprochene Sache nicht ginge, hält den Tausch, wie er universell in der Marktwirtschaft stattfindet, ohne den Einsatz des Geldes für unmöglich – und meint, mit dieser „Beweisführung“ schon einmal etwas zu wissen. Es kommt sich dabei sogar sehr „realistisch“ vor, hat es doch auf eine „praktische“ Bedeutung des Geldes verweisen können, ein plausibles „Wozu“ angegeben, das jedermann einleuchtet. Zumindest jedermann, der beim Nachdenken ebenso am Funktionieren des Tausches interessiert ist, wie er sich praktisch auf ihn angewiesen weiß. Die Fortsetzung dieser Methode, theoretische Ökonomie zu treiben, geschieht sehr konsequent. Die ganze Wirtschaft besteht wie der Austausch mit seiner „Preisbildung“ aus lauter Bedingungen, unter denen sie funktioniert. Darunter verstehen Ökonomen „theoretische“ – und das meint in diesem Zusammenhang, ganz wie der Volksmund: „nur ausgedachte“ – Verhältnisse zwischen ökonomischen Größen, die eintreten müssten, um das Gelingen von Austausch, Kreislauf und Wachstum sicherzustellen. Dass die mathematisch durchkonstruierten Modelle nicht der Realität entsprechen, wird ebenso deutlich klargestellt, wie darauf bestanden wird, dass dieser Idealismus den praktischen Notwendigkeiten der Marktwirtschaft auf der Spur ist. Das matte Unternehmen, ökonomischen Gegebenheiten einen „funktionalen“ Sinn zuzusprechen, zeugt mit seinen mannigfaltigen „Problemen“ der Theoriebildung zwar stets vom Bekenntnis zu Notwendigkeiten; solche liegen nämlich mit jeder Funktion vor für jemanden, der das Erklären mit der Bestätigung einer Zweckmäßigkeit seines Gegenstandes verwechselt. Eine Auskunft über das „Warum“ der Sache, über ihre Notwendigkeit und damit über den ihr eigentümlichen Zweck kommt so allerdings nicht zustande. Dergleichen erübrigt sich von vorneherein, da auf die Entdeckung nützlicher Dienste bedachte Geister eben jeden wirklichen oder eingebildeten Nutzen für einen Begriff halten.7) So kennen Ökonomen eben auch bei der Beantwortung der Frage, ob es sich beim Geld um eine harmlose Recheneinheit handelt oder nicht eher um den Gegenstand privater, ausschließender Bereicherung, keinen Unterschied zwischen Schönfärberei und Erklärung und verwerfen als metaphysische Hypothese, was sie bei der Untersuchung des Tausches zielstrebig übergehen.
Der Einfall, dem Geld die „Funktion“ einer hilfreichen Recheneinheit zuzuschreiben, die die diversen Güter über ihre Preise vergleichbar, gegeneinander verrechenbar macht, ist schon für sich keine Glanzleistung. Immerhin bemüht er die Notwendigkeit einer Kommensurabilität, ohne ein Argument auf sie zu verschwenden. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie angeführt wird, beruht auf nichts anderem als der Anerkennung der praktischen Erfordernisse des Austausches. Und das gelegentlich geschätzte Verfahren, mit „Arbeitsteilung“ doch noch eine Begründung anzuführen, soll zwar die über das Geld vollstreckten Maßverhältnisse plausibel machen, würde ernstgenommen jedoch nur als Argument für ein gescheites Transport- und Kommunikationswesen im Rahmen eines Plans taugen. Am tatsächlich vollzogenen Tausch, wo nicht nur ein Geldname die Summe vorstellig macht, die im Fall seines Händewechsels ein Gut erzielen soll, sondern gekauft und verkauft wird, blamiert sich die Idee mit der Recheneinheit erneut: Der Verkäufer will sein Angebot versilbern, und dabei ist er schlecht bedient mit der tröstlichen Auskunft, dass die Einheit, in welcher er wie andere den Preis seines Zeugs angibt, auch schon gefunden und festgelegt ist. Vielmehr muss diese Einheit in ausreichender Anzahl im Besitz dessen sein, der sich für den Gebrauchswert der angebotenen Güter interessiert. Umgekehrt gilt die Freude eines Käufers im Unterschied zu einem ökonomischen Theoretiker nicht der Tatsache, dass Warenpreise im Geld ihre Größe messen; für ihn ist der Umstand entscheidend, ob die Kaufkraft, die er im Geldbeutel hat, für den Erwerb der Güter seiner Wahl reicht.
Diese im gewöhnlichen Austausch, bei den tausendfach stattfindenden Käufen und Verkäufen, die „den Markt“ ausmachen, praktizierten Interessen und ihre Gegensätze hat Marx ebenso wie seine klassischen Vorläufer in der Wissenschaft von der politischen Ökonomie nicht übersehen – und zwei Dogmen der politökonomischen Tradition richtiggestellt.
Zwei Überlegungen kehren in der wissenschaftlichen Befassung mit der „Marktwirtschaft“ seit dem Entstehen der Disziplin immer wieder, allerdings stets im Gewand von Hinweisen, welche den Markt als äußerst sinnvolle Einrichtung und die Leistungen des Geldes als unverzichtbar für ein flottes Wirtschaften schätzen. Beide Überlegungen – die Rede von der „unsichtbaren Hand“, die den Markt lenkt, wie das Stichwort „Arbeitsteilung“ – haben auch Marx beschäftigt, nur etwas anders. Als Rechtfertigungsargumente ließ er sie nicht gelten. Von dem Kompliment, das schon Adam Smith dem Markt entboten hat, ist Marx nicht so begeistert gewesen wie sein Urheber und dessen Nacheiferer. Dass eine „invisible hand“ im Treiben von Angebot und Nachfrage Regie führen und dabei ohne bewusstes Zutun der Beteiligten die gesellschaftliche Arbeitsteilung zu einem insgesamt befriedigenden Ergebnis bringen sollte, leuchtete ihm überhaupt nicht ein. Einerseits stand es „sozial“ mit den famosen Resultaten des Marktes schon damals nicht zum Besten. Andererseits gefiel ihm die Kür eines nun wahrlich metaphysisch zu nennenden Subjekts rein wissenschaftlich nicht. Dem Hin und Her des Marktes hatte er entnehmen können, dass sich die Subjekte des Austausches bemühen, so billig wie möglich zu kaufen und so teuer wie möglich zu verkaufen; auch hatte er gemerkt, dass sie sich dabei – mit wechselndem Erfolg – darauf verlegen, möglichst viel Geld zu behalten und einzunehmen. Das ist ihm weder bewunderungswürdig noch verwunderlich erschienen, zeichnet sich doch das Geld gegenüber den übrigen Tauschobjekten durch seine unmittelbare und universelle Austauschbarkeit aus. Und diese vorzügliche Eigenschaft lässt es allemal ratsam erscheinen, dem Zwang zum Tausch in einer Welt, wo alles Privateigentum ist und seinen Preis hat, mit dem Bedürfnis nach Geld zu begegnen. Dass das Geld kein einziges Bedürfnis befriedigt außer dem nach Austausch, war Marx ebenso klar wie jenen modernen Bürgern, die mit der sinnigen Parole aufwarten, die besagt, dass man Geld nicht essen kann. Dafür sichert es dem, der es hat, den Zugang zu jedem Bedarfsartikel und Genussmittel, und deswegen ist es der Gegenstand der Bereicherung. Ihm gilt der geballte Materialismus des Privateigentums, weil es den Reichtum in schlagfertiger Gestalt darstellt.
Das alles freilich war und ist kein Grund, die Vermutung – und sei es auch nur bildlich – in die Welt zu setzen, in dem Mit- und Gegeneinander des Tausches, in dem das Geldmachen den Erfolg ausmacht, müsse ein ziemlich unbekanntes Subjekt am Werk sein, welches den Laden verlässlich regelt; und auch kein Anlass zu dem Schluss, dass dem Verhältnis der wechselseitigen Benutzung, wie es im Austausch gepflegt wird, ein rundum allseitiger Nutzen entspringt. Marx jedenfalls hat eher Anlass zu der Frage gefunden, was es mit dem Reichtum der Güterwelt auf sich hat, dessen Herstellung aufs Geld berechnet ist und dessen Verteilung übers Geld stattfindet, so dass ihm in dieser allgemeinen Form des Reichtums sein eigenes Maß abstrakt gegenübertritt, getrennt vom jeweils speziellen Nutzen, von den brauchbaren Gegenständen der Bedürfnisse. Er betrachtete es als ziemlich entscheidend für die ökonomische Wissenschaft zu wissen, was da eigentlich gemessen wird und nach welchen Regeln, wenn Warenquanta der verschiedensten Art über die Vermittlung des Geldes einander gleich gelten. Dabei hatte er zwei Probleme von vorneherein nicht. Das eine wurde von modernen Wissenschaftlern erfunden. Es besteht in dem Zweifel daran, dass ein Tausch – der Ersatz eines Quantums brauchbaren Zeugs durch eine bestimmte Menge anderer Güter – eine praktizierte Gleichsetzung darstellt, in welcher ein Maß – die Einheit von Qualität und Quantität – zur Anwendung gelangt. Das andere betrifft den Namen der zu begreifenden Sache. Den gab es nämlich schon, obwohl er gar nichts zur Sache tut. Die Vorstellung von dem in einer Anzahl von Geldeinheiten präsenten oder in Gestalt von Gebrauchsdingen vorhandenen und in Geld gemessenen Reichtum hieß Wert.
Bei der Untersuchung des Werts konnte Marx nicht übersehen, welcher Beobachtung sich die Idee einer „unsichtbaren Hand“, des im Stillen wirkenden, aber ansonsten nicht so recht wahrnehmbaren Subjekts, verdankte. Die Liebhaber des Marktes hatten ja nur bemerkt, dass beim Tausch Gott und die Welt, auf ihren Vorteil bedacht, ständig bestimmte Austauschverhältnisse zustande bringen und sich an ihnen orientieren; dass aber keine Instanz auszumachen ist, die die jeweilig gültigen Proportionen festsetzt. In ihren Aktionen machen sich die Subjekte des Kaufs und Verkaufs ständig abhängig von den Entscheidungen und Mitteln einer Unzahl von anderen Leuten, aber jedes von ihnen verfährt bei seinen „Geschäften“ ohne jede Rücksicht auf die Bedürfnisse und Erwartungen der übrigen. Dass er auf deren „Kaufkraft“ und ihre Angebote angewiesen ist, weiß ein Teilnehmer des Marktes durchaus – aber wie und mit welchen Konsequenzen, das überlassen moderne und unabhängige Privatpersonen, die sich viel darauf zugute halten, so frei zu sein, dem Markt. Der ist nicht ganz zufällig im modernen Sprachgebrauch zu einer maßgeblichen Autorität geworden, der man stets einiges überlassen kann und muss.
Wo die Idealisten des großen Ganzen das Funktionieren „der Wirtschaft“ bestaunten, gelangte Marx erst einmal zu dem schlichten Befund, dass die Unabhängigkeit, mit der sich Käufer und Verkäufer ans Nachfragen und Anbieten machen, auf einer sachlichen Abhängigkeit beruht. Sachlich insofern, als nicht Vereinbarungen über Bedürfnisse und ihre Gegenstände, geschweige denn über die Proportionen, in welchen sie vorliegen oder notwendig sind, den Verkehr auf dem Markt bestimmen; vielmehr ermitteln die Tauschenden durch die Konfrontation von Geld und Gut, ob und in welchem Maße ihrer Entscheidung zum Kauf bzw. Verkauf Erfolg beschieden ist. Ein diesen Prozess steuerndes Subjekt ist gerade nicht auszumachen, obgleich die Resultate der Konfrontation alles andere sind als willkürliche Festsetzungen der Beteiligten. In den Warenpreisen macht sich ein gesellschaftlicher Zwang geltend, der den ökonomischen Interessen der Austauschenden ein Maß setzt. Sie erfahren durch den Markt, über wie viel Reichtum sie verfügen; das Geld, an das sie gelangen und das ihnen den Zugang zu beliebigen Gegenständen ihrer Bedürfnisse sichert, gerät ihnen zum Inhalt und Maßstab ihres Erfolgs.
Neben der Geschichte von der „unsichtbaren Hand“ hat Marx auch dem Argument „Arbeitsteilung“ die Beachtung geschenkt, die ihm gebührt. Ihm wollte im Unterschied zu seinen späteren Kritikern nicht recht einleuchten, warum eine Erklärung des Geldes in dessen Lob dafür gipfeln soll, dass es in „einer“ arbeitsteilig verfahrenden Wirtschaft die fällige Verteilung bemeistern hilft. Schließlich bestimmt in der bisweilen auch „Geldwirtschaft“ genannten Sorte Ökonomie die Notwendigkeit der Geldbeschaffung die Art und Weise, in der sich die Leute einer ,Teilarbeit‘ annehmen. Wo der Tausch die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums vermittelt, wo die Zahlung nicht den Transport, sehr wohl aber den Eigentumswechsel bewerkstelligt, trägt jeder möglichst die Waren zu Markte, die ein zahlungsfähiges Bedürfnis mobilisieren. Von einer Arbeitsteilung, die nach mehr oder minder reiflicher Beratung aufgemacht wurde und dann nach dem Geld als Rechenhilfe für die Regelung der Distribution verlangt, war in den Tagen von Ricardo und Marx so wenig etwas zu sehen wie heute.
Seltsamerweise unterschlägt aber gerade die moderne Mikroökonomie ihren eigenen Hinweis auf den Zusammenhang von Arbeitsteilung und „Geldwirtschaft“. Für sie genügt die Vorstellung von der unübersehbaren Spezialisierung der Gewerbe, von den daraus entstehenden „Problemen“, die durch das Geld dankenswerterweise gelöst werden. Eine andere Notwendigkeit, die in der von ihr besichtigten „Marktwirtschaft“ die Teilung der Arbeit und das Geld zusammenschließt, ist ihr nicht bekannt; schon deshalb nicht, weil sie sich bei der Arbeitsteilung, die sie vorstellig macht, Geld und Markt wegdenkt, um anschließend bei der Analyse des Austauschs die Arbeit für unerheblich zu halten, auch wenn der Markt mit nichts anderem bestückt ist als mit Arbeitsprodukten.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.