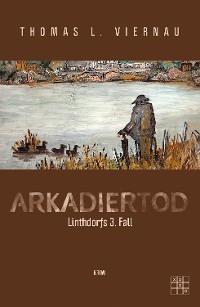Kitabı oku: «Arkadiertod», sayfa 6
Eigentlich war Luise bisher nicht gerade durch geistreiche Ideen aufgefallen. Ihr Temperament hatte es stets geschafft, sich gegen ihren Geist durchzusetzen. Sie liebte glänzende Bälle, schöne Kleider, die Gärten und Parks und mochte Scherze und nette Bonmots. Aber doch nichts mit Tiefgang oder einer gewissen Ernsthaftigkeit.
Jedenfalls saß sie nun hier und schien mit Hardenberg und Knesebeck etwas wirklich Wichtiges erörtern zu wollen.
Dann traute die Voß ihren Ohren nicht, was sie aus Luisens Munde zu hören bekam.
Was wäre, wenn der Franzosenkaiser einem Attentat zum Opfer fiele? Würde das die Situation nicht grundlegend verändern? Ganz Frankreich stehe und falle doch mit diesem Manne und damit auch dessen Armee. Ein gezielter Schuss würde das Schicksal Preußens nachhaltig entscheiden. Und es müsste doch noch ein paar beherzte Männer geben, die so etwas zuwege brächten.
Stille herrschte im Raum. Sowohl Hardenberg als auch Knesebeck schauten sich an und wechselten vielsagende Blicke mit der Gräfin von Voß.
War das eine ernst zu nehmende Option?
Wenn ja, würde sie überhaupt durchführbar sein?
Und wenn sie durchführbar wäre, wer käme dafür in Betracht, sie erfolgreich zu Ende zu bringen?
Knesebeck räusperte sich. In Berlin jemanden zu finden, der in der Nähe Napoleons weilte und einen tödlichen Schuss auf ihn abzugeben, sei außerordentlich schwierig. Alle fähigen Offiziere wären entweder gefallen oder in Gefangenschaft. Das restliche Offizierskorps sei mit auf der Flucht und im Moment verfüge man einfach nicht über Leute, die genügend Herz und kühlen Kopf hätten, um so ein Vorhaben umzusetzen.
Hardenberg schien bei der Idee weniger pessimistisch zu sein. Auch er habe so etwas bereits in Erwägung gezogen. Allerdings habe er es aus demselben Grunde, wie Knesebeck erörtert habe, auch wieder verworfen. Dennoch, er glaube da gäbe es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Morgen erwarte er die Ankunft seines Geheimen Kuriers aus Berlin. Ein ausgesprochen zuverlässiger Mann, der über recht brauchbare Kontakte verfüge und ihn stets auf dem Laufenden halte, was in der Residenz gerade so vor sich gehe.
Luise horchte gespannt auf Hardenbergs Ausführungen. Wer das denn sei, vielleicht kenne sie ihn ja auch?
Hardenberg schüttelte nur den Kopf. Im Interesse der Sicherheit des Kuriers und natürlich auch im Interesse des Königshauses wäre es ausgesprochen unratsam, zu viele Details eines solchen Plans zu wissen. Zum einen könne das Attentat ja auch schiefgehen und es wäre nicht auszudenken, wenn dann eine Verbindung der Attentäter zum Königshaus aufgedeckt würde. Es gezieme sich einfach nicht für das Haus Hohenzollern zu solchen Mitteln zu greifen. Darüber sei man sich wohl einig, dass eine solche Aktion die Auslöschung der Dynastie nach sich zöge und dass Napoleon da wohl kein Pardon mehr kennen würde.
Luise nickte. Was hier besprochen würde, bliebe in diesem kleinen Rahmen, nicht mal der König dürfe davon erfahren.
Dann wechselte die Königin abrupt das Thema und unterhielt sich mit Hardenberg über dessen leider viel zu früh verstorbenen Neffen, der einer von Luises Lieblingsautoren war.
Getrost das Leben schreitet
Zum ew’gen Leben hin;
Von innrer Glut geweitet
Verklärt sich unser Sinn.
Die Sternwelt wird zerfließen
Zum goldnen Lebenswein,
wir werden sie genießen
und lichte Sterne sein.
Novalis, aus »Hymnen an die Nacht«
IV
Liebemühl bei Osterode in Ostpreußen
Donnerstag, 6. November 1806

Das kleine Städtchen Liebemühl lag im dichten Nebel verborgen, der vom Eylingsee heraufgezogen war und wie ein dichtes weißes Tuch alles unter sich verbarg. Der Prinzenwald, ein dunkler Tannenforst, der sich um das Städtchen zog, war vom Nebel verschont geblieben. Von weitem konnte ein zufälliger Besucher denken, dass Liebemühl verschwunden sei. Da, wo es eigentlich sein sollte, war ein weißes Nichts.
Bogislav von Hummel ritt durch den Prinzenwald und hielt Ausschau. Er war es gewohnt, dass er nicht immer auf Anhieb die vereinbarten Orte fand, die er als Treffpunkte genannt bekam. In den letzten Wochen war von Hummel fast nur unterwegs zwischen Berlin und den diversen Orten der Flucht des königlichen Kabinetts. Seine Falten auf der Stirn waren noch tiefer geworden seit der Niederlage der preußischen Armeen. Er hatte genug gesehen, um von der Hoffnungslosigkeit seines gegenwärtigen Tuns überzeugt zu sein.
Aber Bogislav von Hummel war kein Mann, der so schnell aufgab. Seit über zehn Jahren war er schon im Dienste des Königs und hatte sich in vielerlei brenzligen Situationen bewährt.
Er war mit dabei, als der junge König mit der Cliquenwirtschaft seines Vorgängers aufräumte und die bis dato uneingeschränkt herrschenden Minister von Bischoffswerder und von Woellner in Ungnade davonjagte. Er hatte ebenfalls bei dem Prozess gegen die verruchte Maitresse des Vaters von Friedrich-Wilhelm, die Gräfin von Lichtenau, wichtige Beweise sichern können, die ihre Position bei Hofe zu Fall gebracht hatten.
Und er war zugegen, als Prinz Louis Ferdinand fiel. Er berichtete dem Königspaar über den Tod des Generals, der ein besonderer Freund Luises und ein Vertrauter des Königs gewesen war. Auf ihm ruhten die Hoffnungen Preußens. Er sollte den Eroberer Napoleon stoppen, ja vielleicht sogar in die Flucht schlagen. Doch schon im allerersten Gefecht fiel der Prinz.
Bogislav von Hummel war dabei. Er konnte es nicht verhindern.
Der Prinz floh vor einer Übermacht französischer Husaren. Als sein Pferd strauchelte, hatte ein hitzköpfiger Franzose, vielleicht ein Leutnant, so genau kannte sich Hummel nicht mit den Dienstgraden der Franzosen aus, ihm nachgesetzt und dem Prinzen mit seinem Säbel einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt. Der Prinz stürzte und drei oder vier Franzosen stürzten sich auf ihn und bohrten ihre Degen in seine Brust.
Dann rissen sie ihm die Schulterstücke von der Uniform, stritten sich noch, wer welche Beutestücke bekommen sollte und brüsteten sich mit ihrer schändlichen Tat. Ohnmächtig musste von Hummel dieses Trauerspiel beobachten. Jede Hilfe wäre einem Selbstmord gleichgekommen. Es waren einfach zu viele Franzosen.
Seit diesem Tag war eine Wut in ihm, die er nur schwer unterdrücken konnte. Er hatte sich Rache geschworen für dieses schändliche Niedermetzeln seines Prinzen. Daher nahm er auch jede Schwierigkeit auf sich, um etwas zu tun gegen die verhassten Invasoren. Diese beschwerlichen Kurierdienste waren das Mindeste, was er machen konnte.
In Liebemühl sollte er auf den Vertrauten von Hardenbergs treffen, der ihm neue Orders geben würde und dem er die wichtigen Briefe mit den Informationen aus Berlin auszuhändigen hatte.
Es waren nur noch ein paar Meilen bis er endlich in Liebemühl eintreffen sollte.
Dort hatte bereits Major von dem Knesebeck Stellung bezogen. Er war Hardenbergs Vertrauter und kümmerte sich um alles, was man vage als Geheime Angelegenheiten umreißen konnte.
Knesebeck kannte von Hummel bereits seit geraumer Zeit. Er schätzte die Dienste dieses stillen und unauffälligen Mannes sehr. Hummel war stets loyal und erwies sich als überaus trickreich, wenn es darum ging, ein Ziel zu verfolgen, das nicht so leicht zu erreichen war. Böse Zungen behaupteten, dass Hummel ein Spion sei und daher nicht in einem Atemzug mit den ehrbaren Offizieren genannt werden dürfe. Aber Knesebeck machte sich aus diesen Gerüchten nichts und verkehrte mit Hummel ausgesprochen vertraulich.
Er blickte zu der kleinen Kirchturmuhr, konnte aber im dichten Nebel nichts erkennen. Vereinbart war der späte Nachmittag. Nun ja, es gab viele Dinge, die eine Verspätung des Kuriers entschuldigen würden. Aber bisher hatte von Hummel stets pünktlich die vereinbarten Treffpunkte erreicht.
Die Dämmerung setzte schon ein, als endlich der Hummels schwarze Rappe in Liebemühl zu hören war. Knesebeck lauschte erleichtert in den Nebel. Ein dunkler Schatten zeichnete sich ab. Der Zweispitz von Hummels war Knesebeck vertraut. Mit einem kurzen Nicken begrüßte er seinen Verbindungsmann.
Bogislav von Hummel berichtete knapp und sachlich über die Situation in Berlin. Er erzählte, dass Napoleon die Quadriga vom Brandenburger Tor abmontieren wollte, um sie nach Paris zu schicken. Als Beute, für seine neue Sammlung!
Das Sagen habe jetzt ein von ihm eingesetzter Verwaltungsausschuss, das »Comité administratif«, darinnen auch Berliner Bürger, die offen zu Napoleon übergetreten seien. Außerdem gäbe es noch eine neue Bürgergarde, die »Garde Bourgeoise de Berlin«. Über zweitausend Mann stark sei diese neue Polizei. Auch hier wären viele Kollaborateure am Werk.
Knesebeck nickte zerstreut. Er hatte im Moment nicht den Nerv für solche Neuigkeiten. Der Major zog den Kurier zur Seite. »Was ich Ihnen jetzt sage, ist brisant. Ich hoffe, dass ich mich hier auf Ihn verlassen kann.«
Bogislav von Hummel nickte. Dann traten die beiden Männer in das kleine Gasthaus direkt an der Wassermühle ein.
Hummel lauschte dem leise vorgebrachten Anliegen des Majors. Nach einem kurzen Zögern berichtete er ihm von einer Gruppe aufrechter Patrioten, die ein ähnliches Ziel verfolge und die natürlich auf eine Unterstützung seitens des Hofes …
Knesebeck hob die Hand.
Von einer offiziellen Unterstützung könne hier nicht die Rede sein. Dazu wäre das Ganze doch zu brisant. Aber es wäre hilfreich, diese Leute zu fördern. Damit holte er ein Säckchen mit Silbertalern hervor. Hummel überschlug kurz, wieviel Taler in diesem Säckchen sein konnten. Knesebeck unterbrach ihn. »Es sind 250 Reichstaler. Davon kann man einige brauchbare Dinge erwerben, die dem Unternehmen nützen können. Ich hoffe doch, Ihr geht sorgsam mit dem anvertrautem Gelde um und wisst es richtig einzusetzen.«
Bogislav von Hummel nickte. Er würde schon am nächsten Morgen zurück nach Berlin reiten.
Scholetzkis Fundsachen
Der Schwielowsee und das Dörfchen Petzow
Vom Wasser kann man manchmal nicht genug bekommen. Rings um Potsdam ist wohl die wasserreichste Gegend der Mark zu finden. Die Havel bildet ein weitverzweigtes Netz von Seitenarmen, die sich in zahlreiche Seen ergießen. Der größte und schönste dieser
Havelseen ist der Schwielowsee, an dessen Ufern viele Dörfer und das Städtchen Werder liegen. Ein Kanalnetz, das in den letzten beiden Jahrhunderten von Menschenhand geschaffen wurde, verbindet die Seenwelt untereinander und führt auch Spree- und Dahmewasser herbei. Entsprechend viel Schiffsverkehr ist auf dem Wassernetz unterwegs. Hier treffen alle Wasserwege zusammen, um den Moloch Berlin mit allem, was zu Wasser transportiert werden kann, zu versorgen.
Im Dörfchen Petzow sind ein paar Ausflugsrestaurants und Cafés geöffnet. Direkt am Schloss gibt es eine kleine Straße mit diversen Lokalen.
Schloss Petzow ist umgeben von einer zauberhaften Parklandschaft, die der preußische Gartenbaumeister Peter Joseph Lenné anlegen ließ. Das neugotische Schloss und das Kirchlein auf dem Hügel wurden vom großen Karl Friedrich Schinkel entworfen. Vor dem Schloss verkaufen die Bauern ihre selbstgemachten Konfitüren und Imkerhonig, dazu frisches Obst aus den umliegenden Gärten.
Kein Mensch denkt dabei zurück an die alten Zeiten, als auf dem Petzower Herrensitz ein unbarmherziger Patron residierte. Die Barone von Kähne waren berüchtigt für ihre Ruppigkeit und Fortschrittsfeindlichkeit.
Der alte Kähne, ein dem Großbauernstand entstammender Neureicher, hatte sich erfolgreich gegen eine Elektrifizierung seines Gutes und des Dorfes gewehrt. Sogar die Anbindung Petzows ans Eisenbahnnetz wurde von ihm verhindert. Die Leute aus dem Dorf machten einen großen Bogen um den alten Kähne. Man musste mit allem rechnen. Mal hetzte er die Hundemeute auf die Menschen, mal ballerte er mit seiner Schrotflinte wahllos herum.
Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Friedlich liegen Schloss und Park am Schwielowsee. Im kleinen Lenné-Park von Petzow gibt es einen noch kleineren See. Ein Stichkanal versorgt den Parksee mit Havelwasser. Im Sommer schimmert er satt türkis. Die Havel fließt dahinter als breites blaues Band.
Petzow ist eine Idylle. Das Dörfchen mit der Schinkelschen Klinkersteinkirche auf dem Hügel und das Gründerzeitschloss gehören mit zu den oft besuchten Orten am Schwielowsee. Leider ist das schöne Gebäude nach einem hoffnungsvollen Neubeginn als Hotel wieder mal verwaist. Ein neuer Investor muss her. Aber seriöse Anbieter sind rar ... Brüchig ist die Petzower Idylle.
I
Petzow am Schwielowsee
Samstag, 23. Dezember 2006

Dr. Ingolf Anton Scholetzki, seines Zeichens Archivar und promovierter Historiker im Archiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Außenstelle Schloss Lindstedt, lebte als Privatmensch in dem kleinen Dörfchen Petzow.
Petzow am Schwielowsee galt als stilles und ruhiges Dorf. Genau das wollte Scholetzki auch. Ein Rückzugsgebiet, welches ihm genügend Freiraum für Kontemplation und Müßiggang gestattete.
Petzow hatte ein Schloss mit zugehörigem Park, eine romantische Kirche auf einem bewaldeten Hügel, und eine große Gärtnerei mit Glashäusern und Grünflächen. Orte, die Scholetzki zu schätzen wusste. Jeden Abend ging er mit seinem großen, blauschwarz bepelzten Rassekater, den er aus einem Spleen heraus Fürst Oblomow nannte, einen kleinen Rundweg entlang. Erstaunlicherweise folgte der große Kater ihm wie ein kleiner Hund direkt bei Fuß.
Scholetzki lief langsam und bedächtig seine Runde, brauchte für die knapp zwei Kilometer meist eine Stunde. Oft blieb er stehen, schaute auf den Schwielowsee, der in den Abendstunden silbern schimmernd vor ihm lag, saß ein paar Minuten auf der kleinen Bank unterhalb der Alten Schmiede direkt am kleinen Schlossteich, zählte die Enten, die darauf herum paddelten und erklomm mit bedächtigen Schritten den kleinen Hügel hinauf zur Petzower Schinkelkirche.
Gleich hinter der Kirche gab es eine kleine Stelle, die einen Blick auf die Grellbucht zuließ. Die Grellbucht war schon dem Glindower See zugehörig. Die alte Ziegeleikolonie Glindow konnte er von hier oben ebenfalls beobachten. Scholetzki mochte die Tour. Drei verschiedene Seen am Weg, das gab es nicht so oft …
Scholetzkis Bank war in den Abendstunden nie besetzt. Sicherheitshalber hatte er aber stets ein kleines Kissen mit. Wenn er es nicht selber nutzte, war es für Fürst Oblomow ein willkommenes Ruhekissen.
In der dunklen Jahreszeit war der Ausblick nicht so spektakulär. Glindow machte sich nur durch seine Lichter bemerkbar. Die kleine Bank war nass und kalt. Scholetzkis Kissen kam zum Einsatz.
Er hatte den ganzen Tag damit verbracht, die drei Folianten, die er gestern geschenkt bekommen hatte, zu sichten und zu sortieren. Es war für ihn ein wirkliches Abenteuer, in die Vergangenheit einzutauchen und längst vergangenen Personen wieder Leben einzuhauchen. Vor seinem geistigen Auge begann ein Theaterstück, dass schon lange nicht mehr gespielt worden war.
Mit jedem neuen Dokument kam eine Szene hinzu, brachte etwas mehr Licht in das langsam verblassende Szenario, das mit jedem neuen Jahr weiter in der Vergangenheit verschwand.
Die von ihm als Kieselblatt-Akten benannten Folianten enthielten eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Dokumente. Der Geheimrat Kieselblatt war ein pedantischer Mensch, jedes Zettelchen schien er aufgehoben zu haben. Scholetzki war dem Namen Kieselblatt nur marginal begegnet. Er gehörte zu der kaiserlichen Beamtenriege, die berühmt dafür war, alles akribisch zu notieren und im Paragraphenwald des Deutschen Kaiserreichs zu versenken. Als Geheimrat am Tegeler Amtsgericht hatte er eine nicht sofort erkennbare Stellung bekleidet. Was genau ein Mann wie Kieselblatt machte, konnte sich Scholetzki schon vorstellen.
In den Folianten waren jede Menge Briefe, die das kaiserliche Wappen im Kopfbogen führten. Korrespondenz zwischen dem Kaiserhaus und diversen Dienststellen in Potsdam und anderen preußischen Städten. Es ging um Gelder, die wohl dem Kaiserhaus zugesagt worden waren und noch nicht bei den zugehörigen Amtsstellen eingetroffen waren.
Kieselblatt oblag die Koordinierung der Finanzen dieser großangelegten Geldsammlung. Wozu das Kaiserhaus die Gelder benötigte, ging aus der Korrespondenz nicht hervor.
Neben den Briefen waren in den Folianten noch zahlreiche Rechnungen aufgelistet. Verwirrende Ausgaben, die getätigt wurden: Kupferblech, Bandstahl, zahlreiche Werkzeuge, Transportrechnungen für diverse Güterwagenladungen, Lohnabrechnungen für Handwerker, alles in schönster Sütterlin-Schrift fein säuberlich aufgelistet.
Am interessantesten waren jedoch die Papiere im dritten Folianten. Die waren deutlich älter, stammten wahrscheinlich aus der Zeit der französischen Okkupation während der Napoleonischen Kriege vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Dicke Kladden, eng beschrieben mit einer schwungvollen Schreibschrift, alles jedoch in Französisch. Scholetzki war sichtlich elektrisiert von diesen schwarzen Kladden. Es handelte sich offenbar um Gerichtsakten eines französischen Militärgerichts, das kurz nach der Eroberung Preußens durch Napoleon tagte.
Der Historiker ärgerte sich wieder einmal, während seiner Schulzeit kein Französisch gelernt zu haben. Er hatte die Möglichkeit, diese Sprache fakultativ zu erlernen, aber das war ihm damals zu anstrengend, zumal er mit Russisch und Englisch schon genug ausgelastet war.
Aber er wusste, dass seine Assistentin, Fräulein Seidelbast vorzüglich Französisch sprach. Sie hatte sich in ihrem Studium intensiv mit der Sprache beschäftigen müssen. Die Brüder Grimm pflegten vielseitige Kontakte zu französischen Gelehrten. Um ihren Schriftwechsel zu lesen, brauchte sie eben auch Französisch.
Scholetzki klaubte sein Handy aus der Jackentasche. Leider ging nur der Anrufbeantworter an. Ärgerlich schnaufend sprach er einen kurzen Text aufs Band.
Dann kraulte er dem Kater Oblomow noch ein bisschen das Fell hinter den Ohren. Der fing auch sofort zu schnurren an. Ein Geräusch, das Scholetzki zutiefst mochte. Sofort entspannte er sich und genoss die vorweihnachtliche Stille. Die Häuser waren mit Lichterketten, Leuchtsternen und illuminierten Weihnachtsbäumen festlich geschmückt. Am Vorabend zum Weihnachtsfest war vom Verkehr kaum noch etwas zu spüren.
Der Himmel klarte auf. Die dunkelgrauen Wolken verzogen sich und am Firmament leuchteten ein paar Sterne. Scholetzki blickte nach oben, nickte dem Kater zu und setzte sich nach ziemlich genau fünf Minuten Sternegucken in Bewegung.
Der Abstieg vom Hügel war im Dunkeln nicht ganz so einfach. Glitschig war der Weg und Unebenheiten konnten zu bösen Stolperfallen werden. Oblomow schnürte neben seinem Herrchen den Hügel hinab. Ihm war kalt und in seinem Fressnapf wartete ein zartes Lammragout mit feinem Gelee.
Noch bevor der Morgen dem Heut‘ reicht die Hand,
wirst du betrauern deiner Krone welke Blüte.
Qi Bai Xi 1930
II
Petzow am Schwielowsee
Sonntag, 24. Dezember 2006
Heiligabend! Scholetzki schlief sich aus. Gestern war er erst spät nach Mitternacht ins Bett getorkelt. Die Kieselblatt-Akten beschäftigten ihn. Er war auf ein erstaunliches Dokument gestoßen. Es ging um den Ankauf einer Statue für den Park Sanssouci.
Scholetzki kannte dieses Kunstwerk, alle kannten dieses Kunstwerk, es stand an exponierter Stelle im Park, direkt auf der großen Wiese vor der Orangerie. Der Grüne Bogenschütze war von der Kaiserfamilie als Großstatue in Auftrag gegeben worden.
Kieselblatt oblag es, den ganzen Kauf von Auftragserteilung bis zur Aufstellung der Statue im Park zu überwachen und zu organisieren. Was nun die eng beschriebenen Kladden aus der Napoleonschen Besatzungszeit mit der Aufstellung der Statue zu tun hatten, war ihm rätselhaft. Aber es musste da wohl einen Zusammenhang geben, denn Kieselblatt hatte die Kladden aufbewahrt.
Scholetzkis Kater Oblomow machte sich bemerkbar. Er hatte Hunger. Eine kleine Assiette mit feinstem Kaninchenragout wanderte aus Scholetzkis Küchenschrank in Oblomows Fressnapf. Dazu gab es noch Streicheleinheiten, die von dem Prachtstück gnädig akzeptiert wurden.
Gerade als Scholetzki darüber nachdachte, einen Morgentee zu sich zu nehmen, meldete sich sein Handy.
Fräulein Seidelbast hatte die Nachricht auf dem Anrufbeantworter abgehört und meldete sich.
Ja, natürlich würde sie helfen, gern sogar. Wann? Ja, eigentlich …
Also heute wäre zwar Heiligabend, aber so richtig hätte sie ja nichts vor. Ihre Nichten würden erst am ersten Feiertag, also, wenn er nichts dagegen hätte …
Scholetzki hatte nichts dagegen.
Ob sie so gegen Mittag …? Er würde auch ein kleines Menü vorbereiten, also, immerhin, es wäre ja schließlich Heiligabend …
In seiner Tiefkühltruhe hatte er noch ein paar Entenkeulen. Rotkohl und Grünkohl waren in seinem wohlgefüllten Konservenlager und Klöße traute er sich ebenfalls zu. Scholetzki schaute auf die Uhr. Beruhigend. Es war erst Neun Uhr. Genug Zeit zum Zaubern.
Scholetzkis Wohnung war in einer Doppelhaushälfte untergebracht. Alle Wände waren mit Bücherregalen vollgestellt. Seine Leidenschaft fürs Papier war auch im Privaten unverkennbar.
Allerdings waren die Schätze seiner Privatsammlung klassische Romane und moderne Erzählungen. Scholetzki war ein Literaturbesessener. Er mochte die russischen Klassiker, Tolstoi, Lermontow, Dostojewski; hatte ein Faible für moderne Amerikaner, Fitzgerald, Steinbeck, Baldwin, sammelte mit Leidenschaft Erstausgaben der Weimaraner Klassik und der schwarzen Romantik. Zu den Raritäten seiner Sammlung gehörten chinesische Tuschmalereien. Gleich nach der Wende hatte er sich einen Traum erfüllt und war auf eine vierwöchige Studienreise durch das Reich der Mitte aufgebrochen. Diese Reise beeindruckte ihn tief. Nachdem er wieder zurückgekommen war, begann er sich für chinesische Holzschnitte und Tuschmalereien zu interessieren. Er begann anfangs wahllos alles zu sammeln, was er bekommen konnte.
Je mehr er sich mit dieser so fremden, eleganten Kunst beschäftigte, desto mehr entdeckte er seine Leidenschaft für die filigranen Meisterwerke des Altmeisters der chinesischen Moderne, Qi Bai Xi.
Scholetzki griff ein dünnes Büchlein mit den für den Meister so typischen Bildern der kleinen, alltäglichen Dinge: Küken, Libellen, Garnelen, Krabben, Früchte … Jedes ein perfekt komponiertes Bild, der Pinselstrich dennoch federleicht, fast zufällig, um in flüchtigen Schwüngen und Linien zu einer solchen Meisterschaft zu führen, die nur ihm eigen war.
Lächelnd blätterte er in dem dünnen Büchlein. Jede Seite ein Fest für die Augen. Sorgsam packte er das Büchlein in Weihnachtspapier, holte eine schöne grüne Teedose hervor, die mit einem großen chinesischen Schriftzeichen verziert war. Beides verstaute er in einer bunten Weihnachtstüte.
Dann wandte er sich dem Festessen zu.
III
Petzow am Schwielowsee
Sonntagnachmittag, 24. Dezember 2006

Fräulein Seidelbast lehnte sich satt und zufrieden zurück. Sie war überrascht von den Kochkünsten ihres Chefs. Vor ihr stand die Weihnachtstüte. Eigentlich hatte er ihr gestern schon etwas geschenkt. Aber diese Tüte schien persönlicher zu sein. Scholetzki war ihr sehr dankbar, dass sie so schnell und unkompliziert zu ihm gekommen war. Immerhin, es war Heiligabend.
Auf dem Tisch stand noch das Geschirr vom Mittagessen. Bachs Weihnachtsoratorium erklang mit dem so typischen Knistern einer Vinylplatte – Scholetzki war altmodisch und besaß einen Plattenspieler.
Verlegen zupfte die Frau an dem goldenen Geschenkband herum. Sie war natürlich neugierig. Zuerst entdeckte sie die zylindrische Dose. Vorsichtig öffnete sie den Deckel. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Wow, Silver Needles! Eine Rarität! Wo haben sie denn die her?«
Scholetzki wusste um die Leidenschaft seiner Assistentin für die subtilen Weißtees. Selten konnte man echte Weißtees im Handel bekommen. Aber seit seiner Chinareise verfügte er über ein paar Kontakte zu Freaks, die es schafften, solche Raritäten heranzuholen. Diese Silver Needles wollte er seiner Assistentin eigentlich schon in den Nikolausstiefel stecken, aber irgendwie hatte er die Gelegenheit verpasst.
Dann griff sie das schmale Bildbändchen mit den Tuschmalereien des Qi Bai Xi. Scholetzki konnte in den langen Jahren ihrer Zusammenarbeit zum ersten Mal zwei Tränen in ihren großen, blauen Augen erblicken. Er holte einen bunten Teller mit Mandarinen, Äpfeln und Pfefferkuchen aus der Küche, bot seiner Assistentin ein Gläschen Punschlikör an und genoss die Atmosphäre völliger weihnachtlicher Harmonie.
Ganze zwei Minuten dauerte das Idyll, dann hielt er es nicht mehr aus. Geschäftig räumte er den Tisch ab, lief erstaunlich schnell in seinen Pantoffeln Richtung Lesezimmer, einem kleinen Raum direkt neben dem geräumigen Wohnzimmer. Dort hatte er die drei Folianten deponiert. Die vier Kladden aus dem dritten Folianten hatte er obenauf gelegt.
»Fräulein Seidelbast, das sind sie. Alles in Französisch. Ich brauche ihre Hilfe … Mein Französisch ist rudimentär, aber Sie können doch … Es ist etwas Brisantes. Ein Militärgericht, wahrscheinlich aus der Zeit der Französischen Okkupation Preußens.«
Die Angesprochene hatte sich die erste Kladde gegriffen und blätterte darin herum.
»Es ist schwierig. Eine Schreibschrift, die sich schwer lesen lässt. Ich werde ziemlich viel Zeit dafür brauchen… Aber ich probiere es.«
Scholetzki atmete durch. »Können sie mir schon sagen, wann ich die ersten Seiten…?«
Schulterzucken, Schweigen, schließlich ein Seufzen. »Naja, mit etwas Glück, nach den Feiertagen. Ich nehme mir die Kladden mit nach Hause. Das habe ich nun davon. Man sollte eben keine Geschenke vom Trödelmarkt machen.«
Scholetzki lächelte. Er hatte nichts Anderes erwartet. Fräulein Seidelbast war eben eine gute Seele.
»Sie ahnen es sicherlich, aber möglicherweise sind die drei Folianten des Geheimrats Kieselblatt eine kleine Sensation. Es geht um den Ankauf einer der großen Skulpturen im Park Sanssouci, um den Grünen Bogenschützen.«
Mit einem leicht spöttischen Lächeln quittierte sie die Ankündigung.
»Nun, Herr Scholetzki, das habe ich mir auch gedacht beim oberflächlichen Überblättern. Da sind Sie als studierter Historiker doch wohl eher geeignet, die Akten auszuwerten und zu würdigen. Aber nun wird es langsam Zeit, es ist immerhin Heiligabend. Ich werde mal losgehen.«
Scholetzki schnaufte und wischte sich mit einem karierten Taschentuch über die schwitzende Stirn, die bei ihm inzwischen bis auf die Rückseite des Schädels reichte. Der Punschlikör zeigt Wirkung.
»Ja, nein, also, natürlich … Sie haben sicherlich … Nein, es war schon toll, dass Sie vorbeigekommen sind. Wirklich! Sie sind mir immer eine große Hilfe, wissen Sie, also, ja … Das wollte ich Ihnen auf alle Fälle noch sagen.«
Fräulein Seidelbast spürte für einen Augenblick eine kurze Irritation. Nicht dass es ihr peinlich wäre, nein, nein, der Altersunterschied zwischen ihr und Scholetzki war groß genug, etwaige Gefühlsduseleien ad absurdum zu führen.
Nein, es war auch …, da war so viel, was Fräulein Seidelbast spürte, was nicht zueinander passte. Scholetzki war ein Gemütsmensch, dem Genuss nicht abgeneigt. Fräulein Seidelbast war genau das Gegenteil. Diszipliniert, spartanisch, arbeitsam.
Viel zu lang war sie schon hier bei Scholetzki. Eigentlich hatte sie für Heiligabend ganz andere Pläne. Sie musste los, schnell und sofort.
Fünf Minuten dauerte es dennoch, bis sie es endlich geschafft hatte aus der Petzower Idylle zu entfliehen. Ihr war das alles immer noch suspekt. Sie gönnte sich selbst keine wirklich schönen Momente mehr.
Zu viele Enttäuschungen hatte sie erlebt. Jede Hoffnung auf eine eigene Familie hatte sich bei ihr nach kurzer Zeit zerschlagen. Ein passender Kandidat war nicht in Sicht. Sie verkroch sich im Archiv in Lindstedt, widmete sich voll und ganz den Büchern. Jetzt war sie Ende dreißig, fühlte sich aber wie Mitte sechzig. Mit niemanden konnte sie über ihren Zustand sprechen. Am allerwenigsten mit Scholetzki, der als permanente Frohnatur überhaupt nicht auf die Idee kam, einmal nachzufragen, wie es wirklich in ihr aussah.
Seit drei Jahren besuchte sie eine Selbsthilfegruppe, die von einem Psychologen geleitet wurde. Wirklich geholfen hatte ihr die Gruppe bisher noch nicht. Eine gewisse Genugtuung war für sie, dass es Menschen gab, denen es noch schlechter ging.
Aber das war kein Thema für die Öffentlichkeit. In der Gruppe sprachen sich alle mit Vornamen an. Sie war für alle Ina Maria, Nachnamen wurden gar nicht genannt. Sie kannte von ihren Mitstreitern nur die Vornamen. Komisch, normalerweise hörte sie ihren Vornamen im normalen Leben nirgends. Sie war für die meisten Menschen eben Frau Seidelbast und für ihren Chef das Fräulein Seidelbast. Als ob ihr Nachname ihre einzige Identität wäre. Ina Maria war irgendwann abhandengekommen.
Ina Maria war ein fröhliches Mädchen mit schweren Zöpfen, das es liebte herumzutollen und sich zu verstecken. Im Garten ihrer Großeltern lag das Paradies, bestehend aus Obstbäumen, Blumenbeeten, dazwischen ein kleines Zelt mit Decken, Körbchen für ihre Püppchen und eine Hängematte zwischen zwei alten Kirschbäumen.
Ina Maria war auch ein kichernder Backfisch, die mit hochrotem Kopf herumlief, wenn sie spürte, dass die Jungs ihr auf den ausgeprägt runden Hintern schauten. Immerhin war sie Sprinterin, Leistungssportlerin, ein Muskelpaket, nervös und hochsensibel.