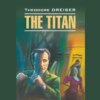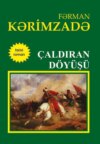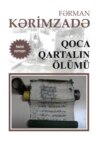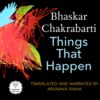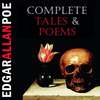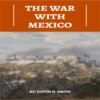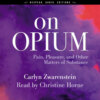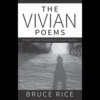Kitabı oku: «Geschichte der Schweiz», sayfa 8
Humanisten entdecken Helvetien
Die Konfliktlinie des Kriegs von 1499 war trotz der humanistischen Polemik denn auch eine innerdeutsche, eben ein Schwabenkrieg, aus dem die Eidgenossen gleichsam als Stammesherzogtum wie früher Bayern oder Sachsen hervorgingen – ohne Herzog zwar, aber mit einem «Volk», was dieser Bund bisher nicht gewesen war. Diese Ethnisierung und auch Territorialisierung der Eidgenossenschaft verdankte Entscheidendes den Humanisten. In einem europaweiten Kampf um – im vormodernen Sinn von Abstammungsgemeinschaft – «nationale» Ehre, bei dem es nicht mehr um erdichtete adlige Stammbäume, sondern um antike Wurzeln ging, entdeckten sie bei Caesar die Helvetii und leiteten daraus ein Land Helvetia ab, das es nie gegeben hatte. Der Name passte aber gut zu dem Gebiet, das 1479 der Humanist Albrecht von Bonstetten auf der ersten Karte der Eidgenossenschaft erfasst hatte, mit noch acht Orten um die Rigi als Zentrum und klaren natürlichen Grenzen. Aegidius Tschudi schuf 1538 nicht nur eine umfassende Karte des Landes, sondern benutzte erstmals überhaupt in der Geschichte der Kartografie gepunktete Linien, um Helvetia vom Umland abzugrenzen. Das war keine Gelehrtentaktik: Ein Schulser, also nicht einmal ein Bürger der 13 Orte, schrie 1524 provokativ vor dem (bis 1803) zu Habsburg gehörenden Schloss Tarasp: «Hie Sweitz Grund und Boden.» Unter Berufung auf die Helvetier als Vorfahren konnte man nicht nur die Herrschaft in einem Land rechtfertigen, das sich ab 1536 vom Bodensee zum Genfersee erstreckte, also das einst burgundische Welschland einschloss. Für Autoren wie Tschudi war selbstverständlich, dass diese antiken Helvetier frei gewesen waren, bevor sie freiwillig unter die Herrschaft der Kaiser und unfreiwillig unter die habsburgischen Vögte gelangt waren. In dieser Deutung hatte der Rütlischwur der Eidgenossen, den er mit vorschützender Genauigkeit auf Mittwoch, den 8. November 1307 datierte, bloss dieses «land Helvetia (jetz Switzerland genant) wider in sin uralten stand und frijheit gebracht». Damit erwiesen sich die Eidgenossen als Stamm von deutschsprachigen Galliern, die von jeher, wenn auch unter anderem Namen, im selben, eigenen Land gelebt hatten. Johannes Stumpf, ein Korrespondent Tschudis in Zürich, machte daraus als Erster ein «Alpenvolck» im «Alpenland».
Insofern kann man sagen, dass nicht historische Taten die Schweiz als politische Einheit begründet haben, sondern die um 1470 einsetzende Geschichtsschreibung darüber. Sie schuf aus vielfältigen lokalen Überlieferungen eine auf den Innerschweizer Kern zentrierte Erinnerungsgemeinschaft und exportierte diese. In der ersten gedruckten Schweizerchronik, die der Luzerner Petermann Etterlin 1507 vorlegte, konnte man die Befreiungssage nicht nur nachlesen, sondern auf Druckgrafiken auch etwa den Apfelschuss bestaunen. Der Tellenstoff floss bald auch in Lieder und Schauspiele ein. Tschudis Chronicon, die geniale Summe der bisherigen Historiografie, blieb zwar vorerst ungedruckt, wirkte aber durch Abschriften, Auszüge und über zwei Zürcher Druckwerke: Stumpfs erwähnte Chronik (1548) und Josias Simlers Regiment gemeiner loblicher Eydgnoschafft (1576), das dank zahlreichen Auflagen und Übersetzungen auf Lateinisch und Französisch die sagenhafte wie die reale Landesgeschichte einem internationalen Publikum eröffnete. Es entsprach dieser Leserschaft und dem Selbstverständnis der Autoren, wenn die Polemik konkret nur noch auf die Habsburger zielte, während der «gute» Adel im Land die gerechte Sache unterstützt habe. Gerade in und dank den fremden Diensten orientierten sich Potentatengeschlechter wie die Glarner Tschudi bis hin zum Ritterschlag und Erwerb von Adelsbriefen ebenso an der Nobilität wie das «Verwaltungspatriziat», das in Zürich und anderen Städten seit dem 15. Jahrhundert dominierte.
Allerdings hatten nur wenige Schweizer das Geld und die Lesefähigkeit, um sich Bücher zu leisten. Für viele Männer unter ihnen war die Eidgenossenschaft dennoch eine erfahrbare Realität geworden, als sie in den Kriegen oder in fremden Diensten gemeinsam Lager bezogen und kämpften. Trotz allen Differenzen zwischen den Orten zeigte sich dabei Zusammenhalt und Verlässlichkeit in Lebensgefahr. So war es auch kein Zufall, dass das weisse Kreuz im 15. Jahrhundert als gemeinsames Feldzeichen auftauchte, bei offiziellen Truppen wie Reisläufern, die es sich als Amulett an das Wams hefteten, in die Hellebarden stanzten und damit die Ecken der kantonalen Fahnen schmückten. Den Kriegsdiensten für Papst Julius II. verdankten die Orte eigene und gemeinsame Banner und den gemeinsamen Ehrentitel als «Beschützer der Freiheit der Kirche». In Verhandlungen und (Sold-)Verträgen verwendeten die ausländischen Partner ausserdem nicht nur Kollektivbezeichnungen wie «Svizzeri», sondern sie nahmen diese als Einheit in die Pflicht, um die stets drohenden Sondertouren zu vermeiden. Ebenfalls auf gemeinsame Militärdienste gingen die Schlachtjahrzeiten zurück, an denen man der gefallenen Angehörigen oder Vorfahren gedachte. Die Luzerner und Glarner feierten (und feiern bis heute) ihre unerwarteten Siege von 1386 und 1388 mit Dankgottesdiensten für die Gottesurteile jeweils jährlich in der Sempacher Schlachtfeier und der «Näfelser Fahrt». Bei «der eidgnossen jarzit» konnten sie – offizielle wie individuelle – Besucher aus den anderen Orten empfangen. Diese trafen auch zur Fasnacht, bei Kirchweihen (Chilbi) oder Prozessionen ein, aber auch bei rein weltlichen Veranstaltungen wie den Schützenfesten, an denen die Gastgeber und Tausende von Besuchern aus den verbündeten Orten sich dem Wettkampf und dem gemeinsamen Trinken widmeten.
Der Glaube an einen besonderen göttlichen Schutz kam auch in einer eigentümlichen und vom Adel heftig angefeindeten Form des Betens zum Ausdruck, nämlich mit «zertanen» (ausgebreiteten) Armen. Auch die Erneuerung der Bundesbriefe, die gemeinsam mit Abgesandten der anderen Orte beschworen wurden, gehörte zu den (religiösen) Riten, deren gemeinsame Feier über die zwischenörtischen Grenzen hinweg ein Zusammengehörigkeitsgefühl schuf. Im Zürcherbrief 1351 erstmals festgelegt, geschah dies anfangs in unregelmässigen Jahresabständen, nach dem Zürichkrieg regelmässiger und ab 1481 in einem Fünfjahresturnus. Die Erinnerung an gemeinsame und erfolgreiche Kämpfe unter himmlischem Schutz hielt also dieses uneinheitliche Defensivbündnis ebenso zusammen wie Herrschaftsinteressen über eigene und gemeinsame Untertanen. Um 1515 mussten aber viele Eidgenossen feststellen, dass sie ihren in alle Himmelsrichtungen wirkenden Eroberungsdrang überdehnt hatten. Bei Marignano gesiegt hatte der dynastische Herrscher eines grossen Territoriums, das zusehends zentral, mithilfe von speziell ausgebildeten Verwaltungsbeamten und einer einheitlichen Nationalkirche regiert wurde und wachsende Steuererträge abwarf, um eine Armee aufzurüsten und in einem Verdrängungskampf die Ausbildung der europäischen Staatenwelt voranzutreiben. Alle diese Elemente fehlten in der Eidgenossenschaft. Wie konnte sie Bestand haben, wenn zudem diejenigen Bande rissen, die gemeinsame Kriegszüge, Schwörakte und geteilte Glaubenspraxis für Gottes «volks usserkorn» geschaffen hatten?

Aegidius Tschudi schrieb Geschichte im doppelten Sinn. Er verfasste nicht nur ein Werk, das die schweizerischen Gemeinsamkeiten bis in die Antike zurückentwickelte. Als Landammann gab er einem Glaubenskonflikt den Namen: Der «Tschudikrieg» brachte den Stand Glarus, ja die Eidgenossenschaft zwischen 1559 und 1564 an den Rand eines echten Kriegs, denn Tschudi suchte die Innerschweizer Orte für eine Intervention zu gewinnen, um seinen Heimatkanton wieder dem alten, katholischen Glauben zuzuführen. «Wir wüssind in zweyen Glauben nitt husszehallten»: Unterschiedliche Bekenntnisse bedeuteten unterschiedliche Grundüberzeugungen und Werte, die das vertrauensvolle Zusammenleben in einer politischen Gemeinschaft unmöglich machten. Darin wenigstens stimmte Tschudi mit seinem berühmten und ebenfalls stark humanistisch geprägten Lehrer überein, dem Toggenburger Notabelnsohn Ulrich Zwingli, der nach Studien in Wien und Basel 1506 Pfarrer in Glarus wurde. Zwingli befürwortete die Soldallianz mit dem Papst und begleitete die Glarner Truppen nach Novara und Marignano, weshalb er 1516, von der französischen Partei gezwungen, Glarus verlassen musste.
Zwingli in Zürich
Der Kampf gegen Reislaufen, Pensionenwesen und die Abhängigkeit von fremden Fürsten wurde fortan ein Hauptanliegen Zwinglis und seiner Anhänger. Das traf sich in mancher Hinsicht mit den pazifistischen Positionen, die ihr berühmtes Vorbild vertrat: Erasmus von Rotterdam. Er lebte jahrelang in Basel, das seit 1460 Universitätsstadt war, ihn aber vor allem wegen der guten Druckereien anzog. Dort gab er 1516 das griechische Neue Testament mit seiner lateinischen Neuübersetzung kritisch heraus, die Grundlage für die volkssprachlichen Bibelübersetzungen der Reformatoren. Auch mit der Kritik an ungebildeten und lasterhaften Geistlichen, etwa im Lob der Torheit, war er ein Wegbereiter der Reformation. Um den Niederländer sammelte sich ein Kreis von jungen humanistischen Gelehrten, darunter Heinrich Loriti aus Mollis, der sich nach seiner Glarner Herkunft zu Glarean latinisierte, der Schlettstädter Beatus Rhenanus, der Basler Bonifacius Amerbach oder die ersten Führer der reformierten Kirche in Basel, die Württemberger Johannes Oekolampad und Simon Grynaeus sowie Oswald Myconius aus Luzern. Zwingli stand wie viele andere in regelmässigem Briefkontakt mit dem bewunderten Lehrer, bis dieser 1523 sich erschrocken vom immer radikaleren Toggenburger abwandte. Den Reformatoren ging es darum, aus der Bibel die richtige Lehre herzuleiten, um die Gnade Gottes und damit die Erlösung zu erlangen. Wer ihren neuen Einsichten nicht folgen mochte, mit dem brachen sie, und darob zerbrach auch die Einheit der Kirche. Erasmus dagegen las die Bibel als philosophia Christi, als moralphilosophische Hinführung zur Nächstenliebe im Diesseits. Dogmatische Spekulation und die sich daraus ergebenden Streitigkeiten schreckten dagegen den friedliebenden Humanistenfürsten ab. Folgerichtig verliess er 1529, nach der Abschaffung der Messe, Basel. Nur wenige Humanistenfreunde folgten ihm dabei. Doch die schweizerische Entwicklung bewahrte dank Erasmus einen gegenüber Luther, aber auch Calvin besonderen Charakter: Die Humanisten wurden reformiert, die schweizerische Reformation blieb humanistisch geprägt.
Zwingli wirkte unterdessen, seit 1519, in Zürich als Leutpriester am Grossmünster. Obwohl er in mancher Hinsicht eigenständig war und dies gerne betonte, wurde auch er durch Luthers ab 1517 formulierte Leitsätze zur evangelischen Lehre gebracht: Nur durch Gottes Gnade (sola gratia) erlangt der Mensch Rechtfertigung und Heil, wozu er ausser seinem Glauben (sola fide) nichts beitragen kann, auch nicht gute Werke oder gar gekaufte Ablässe. Die Papstkirche habe diese Botschaft verfälscht und sich eine Mittlerrolle zu Gott angemasst, zu dem man aber allein durch die Schrift (sola scriptura) hingeführt werde. Dieses Schriftprinzip wurde auch beim Wurstessen bei Froschauer geltend gemacht, das die Zürcher Reformation 1522 in Gang brachte: Demonstrativ verzehrten Zwinglis Freunde in der Fastenzeit die Speise, um die kirchlichen Speiseverbote zu verhöhnen. Auch sonst wurde, was sich in der Heiligen Schrift nicht belegt fand, in Zürich zumeist schon bis 1525 abgeschafft: Klöster und Mönchsorden sowie das Zölibat, die Autorität der Kirche und die päpstliche Vorrangstellung, Heiligenverehrung und Bilderkult, Prozessionen, Orgelspiel und Gemeindegesang. Unter Berufung auf das Schriftprinzip reduzierte man die sieben Sakramente auf Taufe und Abendmahl, das nur noch an vier Sonntagen im Jahr stattfand, als Gedächtnismahl mit Brot und Laienkelch, nicht mehr als Messe mit Hostie. Auch die Zahl der übrigen Feiertage wurde radikal beschnitten. Durch Säkularisation übernahm der Zürcher Rat von den aufgehobenen Klöstern und kirchlichen Einrichtungen Eigentum und Rechtstitel, insbesondere den Zehnt, bezahlte damit die Pfarrer und gründete ein Almosenamt und eine Hohe Schule. Das waren typisch reformatorische Einrichtungen: Die Geistlichen waren nicht länger ein abgehobener Stand, sondern wurden gleichsam zu «Staatsangestellten» mit ähnlichen Rechten und Pflichten wie andere Bürger. Arme wurden nicht mehr – wie etwa in den Bettelorden – in der Nachfolge Christi bewundert, sondern obrigkeitlich kontrolliert und zur Arbeit angehalten. Dank dem Unterricht in den drei Sprachen Hebräisch, Griechisch und Latein konnte auf philologisch solider Grundlage schon 1531 die Zürcher Bibel als Gemeinschaftsübersetzung vorgelegt und langfristig ein neuer Pfarrerstand für Zürich und die Ostschweiz ausgebildet werden. Noch viel weiter wirkte das neuartige Modell des «Ehegerichts», in dem nun, anstelle des bischöflichen Gerichts, je zwei Mitglieder von Rat und Kirche nicht nur über Eheangelegenheiten, sondern in einem weiten Sinn über die Sitten der Zürcher wachten. Mit all diesen und weiteren Massnahmen veränderte die Reformation das Innenleben der Christen ebenso radikal wie ihre äussere Umwelt. Prozessionen und Pilgerwege verschwanden, mit ihnen eine Vielzahl der Kleriker und vor allem Mönche, die in den mittelalterlichen Städten etwa zehn Prozent der Bevölkerung ausgemacht hatten. Aus den Kirchen entfernte man nicht nur Bilder und Altäre, sondern mit den Seelenmessen auch ein wichtiges Bindeglied zu den verehrten Vorfahren. Diese gerieten zudem in den Verdacht, sie hätten durch falsche Glaubenspraxis ihr Heil verspielt.
Bauernkrieg und Täufer
Angesichts so weitreichender Konsequenzen war Zwingli unabdingbar darauf angewiesen, dass die Zürcher Obrigkeit ihn unterstützte. Der Rat tat dies, indem er 1523 zwei Disputationen veranstaltete, öffentliche Streitgespräche auf Deutsch zwischen Altgläubigen und Anhängern der neuen Lehre. Zu Hunderten lauschten die Bürger im Rathaus den Ausführungen Zwinglis und seiner Gegner. Nicht die Lehrtradition der römischen Kirche oder die Autorität des zuständigen Bischofs von Konstanz oder das akademische Gespräch von Universitätstheologen entschied hier. Unter Führung der Räte und der Handwerkerzünfte mutete sich die weltliche Gemeinde zu, in Fragen des Seelenheils Grundsatzentscheidungen zu fällen und sich Pfarrer ihrer Wahl auszusuchen.Nach dem Schriftprinzip gestand man Zwingli deshalb zu, das Evangelium auf seine Weise weiterzupredigen, «bis er eins besseren bericht werde».
Zwingli bedankte sich, indem er in den folgenden Jahren eng mit dem Rat zusammenarbeitete, dem im Sinn von Römer 13 gegeben werden sollte, was der von Gott eingesetzten Obrigkeit geschuldet war. Das zeigte sich im Vorfeld des deutschen Bauernkriegs, als 1524 mit dem Ittinger Klostersturm auch im Zürcher Umfeld die Bauern unruhig wurden und Luthers Freiheit eines Christenmenschen nicht theologisch, sondern politisch und rechtlich interpretierten. Es blieb nicht bei reformatorischen Postulaten wie der freien Pfarrerwahl auch in Landgemeinden. Die berühmten Zwölf Artikel, die im nahen Oberschwaben verfasst wurden, forderten unter Berufung auf das Evangelium und göttliches Recht, die Leibeigenschaft gehöre abgeschafft und die feudalen Abgaben müssten stark eingeschränkt werden. Bereits vor den Unruhen hatten Flugschriften und Stiche die reformatorische Botschaft mit dem «Schwitzer Baur» als gescheitem und bibelkundigem Glaubensstreiter in Verbindung gebracht. Ein Autor stellte Bauern dem Adel und dem römischen Klerus gegenüber und fragte: «Was mehret Schwyz? der Herren Gyz». Zwingli lehnte allerdings Rebellion gegen eine rechtmässige Herrschaft ab, zumal sich diese in Zürich ja der Reformation zuwandte. Aber in konkreten Streitfragen wie beim Zehnten, auf dessen Einkünfte der Rat nicht verzichten wollte, suchte er den Ausgleich zwischen den Fronten. Auch wenn die Zürcher Landschaft 1525 etwa den Staatsakt der Zürcher Kirchweihe boykottierte und alles in allem kaum besser gestellt wurde, hielt sie der Stadt letztlich die Treue. Im selben Jahr machte dagegen der Schwäbische Bund im angrenzenden süddeutschen Raum Zehntausende von Bauern nieder, wobei ihn Luther mit seiner Schrift Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern unterstützte. Der Traum vom «sweytzer werden» war für diese Bauern vorüber; südlich des Rheins hatten sie weder bei den evangelischen Städtern noch bei den altgläubigen Landkantonen Rückhalt gefunden.
Vor Gewalt schreckten auch die Zürcher nicht zurück, wenn das Schriftprinzip weiter getrieben wurde, als sie es verstanden. Es waren frühere Anhänger Zwinglis, die am 21. Januar 1525 in Zürich anstelle der biblisch nicht belegten Kindstaufe erstmals eine Erwachsenentaufe vornahmen. Wie Luther lehnte Zwingli die Täufer ab, die als Wiedertäufer (Anabaptisten) abgetan wurden, obwohl sie die Gläubigen nicht erneut, sondern erstmals, bewusst und freiwillig tauften, wenn sie sich für mündig hielten. Ihre ersten Märtyrer bewiesen schon bald, dass die Reformierten mit Falschgläubigen ähnlich verfuhren wie die römische Kirche: Der Zürcher Rat liess den Täufer Felix Manz 1527 in der Limmat ertränken. Das lag nicht nur an den theologischen Differenzen. In ihrem Streben nach sichtbarer «Besserung des Lebens» gingen die Täufer zur weltlichen Obrigkeit, zu weltlichen Dingen überhaupt auf klare Distanz. Sie leisteten aus Prinzip keine Eide, weil dies in der Schrift verboten war; also auch keinen Untertaneneid. Den Militärdienst verweigerten sie ebenso, weil er der Nächstenliebe widersprach. Beides verstiess gegen Grundkonsense in der Schweiz, die ja eine Eidgenossenschaft war, in der das individuelle Gemeindebürgerrecht auf der Bereitschaft und Fähigkeit zum Kriegsdienst beruhte. Im Zeitalter des Bauernkriegs war die täuferische Botschaft dennoch populär, vor allem in ländlichen Gebieten, die sich von der städtisch-obrigkeitlichen Reformation abwandten. Vor allem im Zürcher Oberland und im Berner Emmental konnten sich die Täufer während Jahrhunderten halten, obwohl sie immer wieder verfolgt und auch vertrieben wurden.
Auch in Bern hatte Anfang 1528 eine öffentliche Disputation dazu geführt, dass das grösste eidgenössische Territorium zur Reformation überging und den bisher isolierten Zürchern einen entscheidenden und für weitere Städte wegweisenden Rückhalt gewährte. Die Säkularisation insbesondere des Klosters Interlaken, das allerdings schon seit langem unter Berner Schirmherrschaft stand, erweiterte das Territorium beträchtlich. Auch abgesehen davon nutzte die Stadt die neu erlangten, bisher kirchlichen Herrschaftsrechte, um den Zugriff auf die Landgemeinden zu verstärken. Im Oberhasli führte dies zu bewaffnetem Widerstand und zur Forderung, ein eigener eidgenössischer Ort zu werden – die Erinnerung an die einstige Reichsfreiheit wog mindestens ebenso schwer wie die Verteidigung der Messe.
Weshalb blieben die Innerschweizer katholisch?
Die rasch unterdrückte Revolte der Oberhasler konnte auf aktive Unterstützung der benachbarten Unterwaldner zählen. Weshalb hielten sie wie alle Innerschweizer mit ihren Landsgemeinden und langen Erfahrungen kommunaler Selbstverwaltung an der Papstkirche fest? Wenn man von einer «Gemeindereformation» (Peter Blickle) sprechen kann, dann bedeutet das nicht eine unvermeidliche Abkehr von der römischen Kirchenhierarchie, wohl aber, dass die Entscheidung, selbst wenn sie altgläubig ausfiel, auf kommunaler Ebene erfolgte. Ausschlaggebend war damit die Überzeugung nicht der geistlichen, sondern von weltlichen Instanzen. In der Innerschweiz hatten diese es aber nicht mehr nötig, die Kirche durch die reformatorische Lehre einer politischen Lenkung zu unterwerfen. Die starken Dorfgemeinden kontrollierten bereits seit dem Spätmittelalter die lokale Geistlichkeit, und Päpste wie Julius II. hatten ihnen die entsprechenden Rechte zum Dank für Militärdienste bestätigt. In dieser Tradition beanspruchten die Inneren Orte im Glaubensmandat von 1525 für sich «als der weltlichen Obrigkeit» zumindest in ausserordentlichen Situationen die gerichtlichen und finanziellen Rechte des Bischofs; Ähnliches geschah in Freiburg. Dieses staatskirchliche Handeln konnte, wie bei den Reformierten, auch die Entscheidung in Glaubensfragen durch ein volkssprachliches Religionsgespräch beinhalten. Auf Vorschlag der Innerschweizer Orte veranstaltete man 1526 in Baden eine gesamteidgenössische Disputation. Oekolampad vertrat die Neugläubigen anstelle von Zwingli, der wegen des Ketzereivorwurfs nicht teilzunehmen wagte. Oekolampad scheiterte aber an einem langjährigen und entsprechend bewanderten Gegenspieler Luthers, dem Dominikaner Johannes Eck, der vor allem in der Abendmahlsfrage die Mehrheit der Tagsatzung hinter sich scharte.
Gerade im Umfeld des Bauernkriegs hatten die Länderorte auch gute politische Gründe gegen die Reformation. Weshalb sollten sie ihre ohnehin umstrittenen «Bauern»-Regierungen weiter durch unnötige Probleme mit den beiden Universalmächten belasten, in denen ihre Herrschaft begründet lag – mit dem Papst, dem sie den Ehrentitel als Beschützer der Kirche verdankten, und mit dem Kaiser, dem Habsburger Karl V., der trotz zeitweise grossen politischen Konflikten mit der Kurie stets entschieden am alten Glauben festhielt und seine militärischen Drohungen gegen die Protestanten im Reich letztlich auch wahrmachen sollte? Vor diesem Hintergrund lag es nahe, dass die Waldstätte, Luzern und Zug, die fortan als «Fünf Orte» einen konfessionspolitischen Block bildeten, mit Karls Bruder und späterem Nachfolger Ferdinand I. ein Defensivbündnis eingingen, die «Christliche Vereinigung» von 1529. Das Sonderbündnis mit dem früheren Erzfeind Österreich bewies, wie ernsthaft die Innerschweizer die Religion ihrer Väter bedroht sahen.
Bedroht war aber auch, durch Zwinglis Kampf gegen Reislaufen und Pensionen, der vielleicht wichtigste Erwerbszweig sowohl von Bauernfamilien als auch von Notabeln, und dies nicht nur in den armen Länderorten. Auch Zug, Luzern, Freiburg und, nach einigem Zögern, Solothurn blieben beim alten Glauben. Diese Städte waren weniger zünftisch als patrizisch geprägt und mochten ihrem Stadtadel das Auskommen als Offiziere in fremden Diensten nicht versagen. Zürich verweigerte sich dagegen bereits 1521 dem französischen Bündnis und übernahm damit das Resultat einer Ämterbefragung in den Landgemeinden, wie sie die Städte seit dem 15. Jahrhundert veranstalteten und damit die Untertanen bei schwerwiegenden Entscheidungen unverbindlich einbezogen. Unter dem Einfluss der Prediger ging Zürich danach für fast ein Jahrhundert, bis 1612, keine anderen Kapitulationen ein; Bern folgte ihm darin 1529, nach der Reformation, allerdings nur bis 1582. Ein solcher Schritt musste den überbevölkerten landwirtschaftlichen Regionen im kargen Alpenraum viel schwerer fallen als einer vergleichsweise wohlhabenden Händler- und Zunftstadt, die durch die Säkularisation wohlhabender Klöster auch einen Ersatz für die Pensionengelder gefunden hatte.