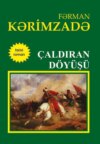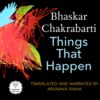Kitabı oku: «Geschichte der Schweiz», sayfa 9
Das Verhältnis zu den Protestanten im Norden
Nicht nur die Säkularisation von Kirchengut machte die Reformation für viele Städte interessant. Sie schafften die rechtliche Sonderstellung von Klerikern und die Rechtsprechung des Bischofs ab und vertrieben diesen, wo er – wie in Basel – noch Stadtherr war. Ähnlich übergab die Fraumünsteräbtissin als frühere Stadtherrin 1524 das altehrwürdige Kloster mit seinem Vermögen der Bürgerschaft von Zürich. Aus der Bischofskirche wurde so eine Staatskirche, nachdem der städtische Rat sich auch in geistlichen Fragen für zuständig erklärt hatte. Aus solchen Gründen wurde die evangelische Botschaft im ganzen Reich in den Städten besonders gut aufgenommen. Damit konnte Zürich schon bald mit verschiedenen Bündnissen die vorher im eidgenössischen Rahmen erlebte Isolation durchbrechen. Sogenannte «Burgrechte» wurden abgeschlossen mit Konstanz (1527), Bern, St. Gallen (1528), Basel, Schaffhausen, Biel, Mülhausen (1529) und Strassburg (1530), das wie Konstanz nicht einmal ein Zugewandter Ort war; später reichten die Fäden bis Ulm und Augsburg. Die protestantischen Städte bemühten sich um eine gemeinsame Verteidigungsund Aussenpolitik, wobei der Glaubenskampf und die Abgrenzung gegen fürstliche Herren zusammenkamen – in diesem Gebiet vor allem gegen die Habsburger, die ihrerseits mit der «Christlichen Vereinigung» an Einfluss in der Eidgenossenschaft gewannen.
Dieser Frontenverlauf zeigt, dass im süddeutschen Raum zumindest bis zum Schmalkaldischen Krieg die Grenzen nicht am Rhein verliefen, sondern in den Köpfen entlang den Bekenntnissen. Dennoch vergrösserte die Reformation langfristig die Distanz der Eidgenossenschaft zum Reich, und zwar durch die Spaltung innerhalb des Protestantismus. Luther trennte klar zwischen Gesetz und Evangelium, zwischen der diesseitigen Ordnung als einem notwendigen Übel und der Verheissung für das Jenseits. Politische Wirksamkeit war ihm kein Anliegen, vielmehr sah er darin, wie der Bauernkrieg zeigte, eine Gefährdung der Reformation selbst. Zwinglis Haltung zu Politik und Gesellschaft war in ihrer erasmianischen Prägung eine ganz andere: Frommes Leben sollte sich als tätige Liebe zu Gott und den Nächsten, als Wirken in der Gemeinschaft bestätigen. Kirche und politische Gemeinschaft waren ihm, anders als für Luther, nicht zwei grundverschiedene Reiche: Ein guter Christ sei nichts anderes als ein guter und treuer Bürger, eine christliche Stadt nichts anderes als eine christliche Kirche. Dem entsprach die Überzeugung, dass die Bibel verbindliche Normen auch für das soziale Verhalten der Christen enthalte. Rat und Kirchenlehrer zusammen mussten also das göttliche Gesetz im Diesseits umsetzen und die Stadt verchristlichen. Auf dieser Grundlage entstand das reformierte Staatskirchentum der Schweizer, das der Obrigkeit durchaus eine starke Stellung zugestand, sie aber auch viel stärker auf eine gestaltende Rolle in der Gemeinde verpflichtete als die lutherische Fürstenreformation.
Ungeachtet solch politischer, sozialer und kultureller Differenzen führte schliesslich doch ein Streit im ureigenen, theologischen Kern des reformatorischen Wirkens zum Bruch zwischen Luther und Zwingli. Luther hielt an der Realpräsenz von Christi Fleisch und Blut beim Abendmahl fest. Zwingli dagegen deutete Brot und Wein als blosses Symbol, mit dem die Gläubigen des Opfers Christi gedachten. Im hessischen Marburg kam es im Oktober 1529 zu einem Religionsgespräch, an dem ausser Zwingli und Luther zahlreiche andere Theologen teilnahmen, so Oekolampad und Philipp Melanchthon, der die Zürcher Lehre als «Bauerntheologie» abtat. Das Treffen fand in Hessen statt, weil der dortige Landgraf Philipp die verschiedenen protestantischen Gruppen einigen wollte, um der altgläubigen Übermacht am Reichstag besser widerstehen zu können. Stattdessen wurden die Gegensätze in der persönlichen Begegnung der Theologen verfestigt. Luther sagte zu Zwingli, er habe einen «anderen Geist», und knurrte den in humanistischer Philologie ausgebildeten Zürcher an, als er den Philipperbrief im Originaltext zitierte: «Leset teutsch oder latein, nit griechisch.» Am Augsburger Reichstag wurden Karl V. 1530 denn auch zwei abweichende Bekenntnisschriften vorgelegt, die lutherische Confessio augustana und die zwinglianische Fidei ratio.
Zerreissprobe in der Eidgenossenschaft
Die wichtigste Auseinandersetzung für Zwingli war aber nicht diejenige mit Wittenberg oder Rom, sondern diejenige in der Eidgenossenschaft, auf die sein reformatorisches Wirken stets ausgerichtet blieb. Der bereits mit Tschudis Worten skizzierte Grundkonflikt bestand darin, dass politische Gemeinschaft, soweit sie nicht Zwangsgewalt war, als Wertegemeinschaft verstanden wurde und Religion diese Werte stiftete. Wenn zudem, wie es im eidgenössischen Bundessystem anders als in einer Monarchie der Fall war, diese Zwangsgewalt kaum existierte, wie konnte die Gemeinschaft denn ohne einen gemeinsamen Glauben Bestand haben? Dieses Problem beurteilten sowohl die Anhänger der Papstkirche als auch die «Neuerer» grundsätzlich gleich und mussten daher unvermeidlich nach religiöser Einheit in ihrem Sinn streben. «Toleranz» war, aus politischen wie auch aus religiösen Gründen, kaum vorstellbar: Es gab den einen christlichen Gott, dem man es nicht auf zwei Arten recht machen konnte, schon gar nicht, wenn man sich als auserwähltes Volk verstand; und wer seinen Nächsten in heilsentscheidenden Fragen gleichgültig im falschen Glauben beliess, den würde der zürnende Allmächtige ebenso strafen wie den Irrenden selbst.
Es war durchaus traditionell und insofern bezeichnend, dass Zwingli in dieser Situation historisch seine Freundschaftliche und ernste Ermahnung der Eidgenossen (1524) formulierte, zu den reinen Sitten der Vorväter zurückzukehren, die den übermütigen Adel besiegt hatten. Naheliegend war aber auch die Entgegnung der Altgläubigen, dass die Protestanten sich von der Religion derselben Vorväter abgewendet hätten. Symptomatisch für diese Auseinandersetzung war 1526 die Weigerung der Zürcher, die alten Bundeseide so zu beschwören, wie das im 15. Jahrhundert jeweils geschehen war: mit einem Appell an die Heiligen. Damit fiel die metaphysische und rechtliche Basis für das weg, was eine Eidgenossenschaft war und jetzt eben diesen Eid nicht mehr leisten konnte. Zwinglis zuletzt kriegerische Offensive gegen die altgläubigen Kantone war so betrachtet zwingend. Sie war die Suche nach einem Gottesurteil in einem unauflösbaren inneren Konflikt, so wie die Siege gegen Habsburg und Burgund als Gottesurteil für die Legitimität der Eidgenossenschaft verstanden worden waren und Zwingli auch Marignano als göttliche Strafe für Solddienst und Luxus ansah. Seine Pläne für eine Neuordnung zielten denn auch auf eine für schweizerische Verhältnisse radikale Lösung: die Vorherrschaft der evangelischen Städte einschliesslich Konstanz, die auch die Gemeinen Herrschaften übernommen hätten.
Nach der Bildung des «Christlichen Burgrechts» und der folgenden protestantischen Bündnisse sowie der katholischen «Christlichen Vereinigung» drohte 1529 ein Krieg. Umstritten waren das Bekenntnis in den Gemeinen Herrschaften, vor allem im Thurgau, und das benachbarte Territorium des Fürstabts, dem die Säkularisation und Unterstellung unter die Stadt St. Gallen drohte. In diesen Raum drängten die Zürcher Geistlichen mit dem Ruf nach freier Predigt, womit sie Freiheit (nur) für ihre Predigt meinten. Ergänzend wollten sie den einzelnen Gemeinden die Entscheidung in Glaubenssachen überlassen. Auch das war eine Form der Gemeindereformation, mit dem Ziel, die katholische Mehrheit der regierenden Orte zu umgehen, die den Neugläubigen die weitere Ausbreitung im Thurgau mit wenig Erfolg zu verwehren suchten. Nach Zürcher und Schwyzer Provokationen, indem sie je einen Vertreter der Gegenpartei verurteilten und hinrichteten, standen die Truppen der Fünf Orte am Albis bei Kappel den zahlenmässig überlegenen von Zürich und Bern gegenüber. Anders als der kämpferische Zwingli setzten die Berner aber auf die Vermittlung der Kantone Glarus, Basel, Solothurn und Schaffhausen, die auch erfolgreich war. Der Erste Landfriede besiegelte Ende Juni 1529 den Status quo mit Vorteilen für die Protestanten, nachdem die Soldaten im Feld mit der gemeinsam verzehrten Kappeler Milchsuppe ihre Erleichterung über den ausgebliebenen Bürgerkrieg zum Ausdruck gebracht haben sollen.
Doch die symbolträchtige Versöhnung dauerte nicht lange. Zwingli trieb zur Eskalation, indem er zuerst forderte, dass die Fünf Orte die freie Predigt in ihren Territorien erlaubten. Als sich diese gegen den Eingriff in die inneren Angelegenheiten verwahrten, verfügte Zürich mit dem zögernden Bern eine Blockade der Getreide- und Salzlieferungen, um die Innerschweizer Viehzüchter in die Knie zu zwingen. Darob kam es zum ersten Bürgerkrieg überhaupt im konfessionellen Zeitalter: Am 11. Oktober 1531 verlor Zürich bei Kappel die Schlacht, Zwingli das Leben, und zwei Wochen danach folgte eine weitere, entscheidende Niederlage am Gubel bei Zug.
Religiöse Koexistenz wird möglich
Die unerwarteten Niederlagen bewiesen, dass die an sich überlegenen Reformierten ihre katholischen Miteidgenossen nicht mit Waffengewalt zum neuen Glauben zwingen konnten. Umgekehrt waren die kleinen katholischen Kantone mit ihren beschränkten Ressourcen unfähig, die grossen reformierten Gebiete von Zürich, Bern und Basel zu unterwerfen. Man musste also entweder die Eidgenossenschaft auflösen oder das scheinbar Unmögliche versuchen: in einer politischen Gemeinschaft zwei verschiedene Bekenntnisse leben. Der Zweite Kappeler Landfriede schuf die formalen Voraussetzungen dafür. Fortan blieb es jedem eidgenössischen Stand überlassen, die Konfession auf seinem Territorium selbst zu bestimmen. Dies war das Prinzip cuius regio, eius religio, wie es mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 auch im Reich eingeführt werden sollte: wessen Herrschaft, dessen Religion. Das überliess im schweizerischen Kontext den städtischen Räten und Landsgemeindeversammlungen die Entscheidungen in Glaubenssachen, die schon weitgehend erfolgt waren. Durch eine Friedensregelung wurde aber erstmals die Existenz zweier konkurrierender und gleichberechtigter Konfessionen in ein und demselben politischen Verband grundsätzlich akzeptiert, wie das bei späteren Religionsfrieden nicht nur im Reich, sondern auch in Frankreich, den Niederlanden, Polen und im übrigen Osteuropa möglich wurde.
Zürich musste ausserdem seine christlichen Burgrechte aufgeben, die Sonderbündnisse mit Städten, die zum Teil ausserhalb der Eidgenossenschaft lagen. In gewisser Hinsicht wiederholte sich so das Ergebnis des Alten Zürichkriegs, jetzt allerdings mit konfessionellen Motiven: Die Innerschweizer verhinderten, dass Zürich den eidgenössischen Bund durch auswärtige Verträge sprengte. Auch seine Hegemonie im Bodenseeraum war gebrochen. Der Abt von St. Gallen konnte seine Herrschaft selbst im vorübergehend unabhängigen Toggenburg wieder festigen, während die reformierte Stadt St. Gallen sich wieder auf das Gebiet innerhalb der Mauern beschränkt sah, die ihrerseits aber wiederum den Stiftsbezirk einschlossen. Die Katholiken in den Gemeinen Herrschaften wurden durch die Vögte aus den katholischen Kantonen effizient geschützt, die Reformierten zum Teil rekatholisiert. Vereinzelt konnten gemischtkonfessionelle Gemeinden bestehen bleiben. Zürich war nicht nur durch Zwinglis Tod, sondern durch daran anschliessende Unruhen auf der Landschaft nachhaltig geschwächt, sodass Bern im protestantischen Lager zur Führungsmacht aufsteigen konnte.
Bern und Freiburg erobern die Waadt
Berns Interesse lag nicht in der Inner-, sondern in der Westschweiz, die grösstenteils zum Herzogtum Savoyen gehörte. Formal ein Reichsglied, beherrschte es den südwestlichen Alpenkamm. Unter Berner Schutz wirkten in der Waadt zwei Reformatoren französischer Zunge, der frühe Zwingli-Anhänger Guillaume Farel aus der Dauphiné und Pierre Viret aus dem waadtländischen Orbe. Beide predigten auch in Genf, einer Bischofsstadt fast ohne Territorium, aber an strategisch wichtiger Stelle beim engen Durchgang zwischen Jura und Genfersee, der die Rhonestadt ihre vergangene Blüte als Messestadt im Einzugsbereich von Lyon verdankte. Den Bischof hatte oft das Haus Savoyen gestellt, dessen Besitzungen Genf völlig umgaben. Die Reformation war hier ähnlich wie in Basel der juristische und ideologische Schlusspunkt eines langfristigen Prozesses, in dem die Bürgerschaft die Herrschaftsrechte übernahm und 1533 den Bischof zwang, die Stadt endgültig zu verlassen. Das verstärkte aber bloss die anhaltenden Nadelstiche des Herzogs von Savoyen und seines Adels, worauf die notleidenden Genfer Hilfe von Frankreich erbitten wollten. Dies rief das forsche Bern und das aus konfessionspolitischen Gründen eher zögerliche Freiburg auf den Plan, mit denen die Genfer Bürger sich bereits 1526 verburgrechtet hatten. Die beiden Schutzmächte eroberten beinahe kampflos das savoyische Waadtland; Bern ausserdem (vorübergehend, bis 1564) das Pays de Gex westlich und das Chablais südlich des Genfersees, dessen östlicher Teil (bis zur Morge bei Saint-Gingolph) an die ebenfalls vorstossenden Walliser fiel. Dazu kam das – seit 1525 – verburgrechtete Fürstbistum Lausanne, dessen Territorium ausserhalb der Stadt allerdings nur einen kleinen Teil der Diözese ausmachte. Dieses blieb katholisch, soweit es an Freiburg fiel, das die kontinuierlichen Erwerbungen der vergangenen Jahrzehnte abschloss. Der Löwenanteil der Eroberungen ging jedoch an Bern, das seine neuen, französischsprachigen Untertanenlande in Landvogteien einteilte und die Reformation einführte, aber die alten Rechte oft respektierte, insbesondere die Selbstverwaltung der «bonnes villes».
Mit dem Jahr 1536 erreichte die Eidgenossenschaft weitgehend ihre räumliche Ausdehnung von heute, der Jura wurde zur Westgrenze und der Genfersee wenig später von einem savoyischen Binnensee zu einem Grenzgewässer. Das Herzogtum Savoyen, ein Verbündeter Habsburgs, verlor 1536 auch seine restlichen Gebiete fast alle an Frankreich und wurde erst 1559 wiederhergestellt. Gleichzeitig verlegten die Savoyer ihre Residenz von Chambéry nach Turin und damit auch, ähnlich wie einst die Habsburger, ihren Einflussbereich weg vom Mittelland, das der Eidgenossenschaft überlassen wurde. In diesem oberdeutschen Bund wurden nun, da Bern die frühmittelalterliche Grenze zwischen Burgund und Alemannen in beide Richtungen überbrückt hatte, das französischsprachige und das aristokratische Element verstärkt. Zwar waren die Waadtländer nur Untertanen, aber die höfischen, savoyischen Manieren des dortigen, zum Teil eingewanderten Adels sollten die ohnehin sehr standesbewusst auftretenden Berner langfristig stark prägen.
Calvin dominiert in Genf
Das Standesbewusstsein des Berner Patriziats lag auch am verstärkten Austausch mit den zwei weltlichen Fürstentümern, die es im eidgenössischen Umfeld neben den geistlichen Territorien der Fürstbischöfe und Fürstäbte noch gab: Greyerz und Neuenburg (Neuchâtel). Der stark verschuldete Graf von Greyerz überliess 1555 seine Besitzungen den beiden Hauptgläubigern, die sie bereits umklammerten und nun aufteilten: Freiburg erhielt Gruyère und Bern das Saanenland sowie Château d’Oex. Der Sitz der im späten 14. Jahrhundert ausgestorbenen hochadligen Grafen von Neuenburg war dagegen in verschiedenen Etappen 1504 an die französische Familie Orléans-Longueville gelangt, eine Seitenlinie der herrschenden Valois-Könige, die in der Normandie residierte und sich nie in der Grafschaft aufhielt. Die räumliche Distanz und Finanzschwierigkeiten des Herzogshauses sowie das Selbstbewusstsein der wohlhabenden Bürger von Neuenburg erklären, weshalb Guillaume Farel mit Berner Rückendeckung 1530 die Reformation einführen konnte. Ähnlich wie in St. Gallen träumten die Bürger vom «cantonnement», von der Selbstständigkeit als eidgenössischer «Kanton», welche Bezeichnung sich auch im Deutschen allmählich neben «Ort» oder «Stand» ausbreitete. Die Stadt hätte so das fürstliche Territorium geerbt und als Untertanenland beherrscht. Doch die katholischen Grafen (und ab 1618 Fürsten) von Neuenburg hielten an ihrem Besitz fest, den sie im 16. Jahrhundert um Colombier und Valangin erweiterten. Verwalten liessen sie ihn durch Gouverneure, zumeist Patrizier aus den ebenfalls katholischen und – wie Bern und Luzern – mit der Stadt verburgrechteten Orten Solothurn und Freiburg, denen ein Staatsrat mit Neuenburger Bürgern zur Seite stand.
Anders als Neuenburg wollte Genf fürstliche Herrschaft nicht gegen Berner Dominanz eintauschen und verteidigte 1536 nicht konfliktfrei seine Selbstständigkeit gegen die anmassenden Befreier, die es der eroberten Waadt einfügen wollten. Auch bei der Reformation gingen die Genfer ihre eigenen, vor 1536 erst ansatzweise eingeleiteten Wege. In diesem Jahr rief Farel Jean Calvin in die Stadt. 1509 in der Picardie geboren, hatte der Notarsohn Calvin ein Rechtsstudium in Orléans und Bourges absolviert. In dieser Zeit fand er vermutlich zum Protestantismus. Jedenfalls musste er Paris Ende 1533 aus Glaubensgründen verlassen. Über Strassburg gelangte er nach Basel, wo er 1536 die Institutio Religionis Christianae druckte, eine Unterweisung in der christlichen Religion; in überarbeiteten und auf Französisch übersetzten Fassungen ist dies bis heute der grundlegende Text der calvinistischen Lehre geblieben. Zu ihren Besonderheiten gehört die grosse Distanz zwischen einem souveränen, erhabenen Gott und dem gefallenen Menschen. Daraus ergab sich mit einer gewissen Konsequenz die Lehre von der doppelten Prädestination: Gott hat nicht nur festgelegt, welche Menschen Erwählte sind (als Ausdruck der göttlichen Barmherzigkeit), sondern auch, wer auf ewig verdammt bleiben wird (als Ausdruck der göttlichen Gerechtigkeit). Aus der Allmacht Gottes folgte also für die Calvinisten, dass Christus doch nicht für alle Menschen gestorben war.
Diese strenge Lehre entsprach denen, die sich zu den Auserwählten zählten, stiess aber auch in Genf nicht überall auf Gegenliebe. Calvin musste vorübergehend seinen Gegnern nach Strassburg ausweichen und etablierte sich nach der Rückkehr erst nach längeren Auseinandersetzungen mit den führenden städtischen Familien, die er auch durch Verbannungen und Todesurteile für sich entschied. Die Hinrichtung drohte auch Auswärtigen: Miguel Servet, der die Trinitätslehre bestritt und damit von Katholiken wie Protestanten als Ketzer verfolgt wurde, landete 1553 mit dem Einverständnis auch der reformierten Kantone auf dem Scheiterhaufen. Die anderen Fremden, die das «reformierte Rom» anlockte, empfing Calvin dagegen grosszügig, wogegen die alteingesessenen Bürger erlebten, wie ihnen die Herrschaft über ihre Stadt weitgehend entglitt. Sie verdoppelte ihre Einwohnerzahl in wenigen Jahren von 10 000 auf 23 000 Einwohner, wovon ein Drittel Flüchtlinge aus Italien und den Niederlanden waren, vor allem aber aus Frankreich. «Huguenots» (Hugenotten), die dortige Bezeichnung für die Calvinisten, dürfte auf «Eidguenots», Eidgenossen, zurückgehen, der Parteiname für die Anhänger Berns in Genf schon um 1530. Genfer Familiennamen wie Turrettini, Burlamaqui oder Micheli (du Crest) verweisen auf den Zustrom italienischer, oft aus Lucca stammender Refugianten, die auch den Basler Späthumanismus prägten, so Pietro Perna, Celio Secondo Curione und der Savoyarde Sebastian Castellio, der Gegenspieler Calvins im Streit, ob man Ketzer – wie Servet – verfolgen solle.
Die internationale und vor allem langfristig anhaltende Bedeutung Calvins – auch und gerade in Osteuropa, auf den britischen Inseln, in Nordamerika – übertraf diejenige der Deutschschweizer Reformatoren in Basel, Bern und selbst Zürich erheblich. Die juristische Genauigkeit und Systematik seines Denkens sprachen bürgerliche und kaufmännische Schichten an, die es gewohnt waren, Rechenschaft über ihr Wirken abzulegen. Die 1559 gegründete Genfer Akademie und die neu angesiedelten, humanistisch geprägten Druckereien zogen Professoren und Studenten aus ganz Europa an, welche die reformierte Botschaft danach wieder in die Heimat trugen. Selbst wenn ihnen dort die Obrigkeit – wie zumeist die französischen Könige oder der Spanier Philipp II. als Herrscher der Niederlande – feindlich gegenüberstand, konnten sie Gemeindestrukturen aufbauen, weil Calvin auch wegen seiner Genfer Erfahrungen der Kirche deutlich mehr Autonomie gegenüber dem Staat zugestand als Luther oder Zwingli. In den Ordonnances ecclésiastiques (1541) unterschied er vier Gruppen, die es der Kirchgemeinde erlaubten, die wesentlichen Aufgaben ohne herrschaftliche Eingriffe zu bewältigen: Pfarrer, theologisch gebildete Lehrer, Presbyter («Älteste») und Diakone, denen das Spital- und Almosenwesen oblag. Das Konsistorium, dem die Pfarrer und die aus dem Stadtrat gewählten Ältesten angehörten, wachte darüber, dass die Sitten- und Glaubensregeln eingehalten wurden, und verfügte in schweren Fällen auch die Exkommunikation als Ausschluss vom Abendmahl. Es waren also geistliche Institutionen, die einen grossen Teil der öffentlichen Ordnung kontrollierten; deshalb hat man Genf auch – nicht ganz zutreffend – als Theokratie bezeichnet. Jedenfalls war Calvin wie Zwingli der Überzeugung, dass trotz der Erbsünde eine Verchristlichung des Alltags und auch der Politik möglich sei. Daher hatte für sie das Alte Testament als Buch des Gesetzes mehr Bedeutung denn bei den Lutheranern, und die weltliche Obrigkeit sollte sich dem geistlichen Ratschlag unterordnen. Entsprechend engagiert nahmen Calvinisten vor allem in Frankreich immer wieder Stellung zu politischen Fragen, selbst auf heiklen Feldern wie Widerstandsrecht und Tyrannenmord.
Die Gemeinsamkeiten mit den Zwinglianern führten zu einem langfristig wichtigen Brückenschlag. Nachdem Calvin anfangs eher den gemässigten Lutheranern um Bucer und Melanchthon nahegestanden hatte, einigte er sich 1549 im Consensus Tigurinus mit Zwinglis Nachfolger Heinrich Bullinger auf eine gemeinsame Formel beim Abendmahlsverständnis, das unter ihnen umstritten gewesen war. Die theologischen Differenzen waren in diesen Monaten aber nicht die grösste Not. 1547 hatte Kaiser Karl V. die evangelischen Reichsstände im Schmalkaldischen Krieg besiegt. 1548 verfügte er für das Reich das Augsburger Interim, das die protestantische Glaubenspraxis stark einengte und von vielen als Ende der neugläubigen Bewegung verstanden wurde. Im unmittelbar schweizerischen Umfeld kam dazu, dass das zwinglianische Konstanz vom Kaiser besetzt wurde und seinen Status als Reichsstadt verlor. Links des Rheins drohten nun von dieser altehrwürdigen Bischofsstadt aus wieder die Habsburger. Umso wichtiger war es vor allem für die Zürcher und Berner, dass mit Genf nicht auch der andere, südwestliche Zugang zum Mittelland an eine katholische Macht – Savoyen oder Frankreich – fiel. Mit dem zweiten Helvetischen Bekenntnis von 1566 verfasste Bullinger dann in Übereinstimmung mit Calvins Nachfolger Théodore de Bèze eine für alle Reformierten gültige Bekenntnisschrift, die Confessio Helvetica. Damit gab es gleichsam ein schweizerisches Bekenntnis, das theoretisch vom Genfersee zum Bodensee reichte – die katholischen Kantone natürlich ausgenommen. Gleichwohl war eine Brücke geschlagen zwischen deutschsprachigen und französischsprachigen (Zugewandten) Orten, die zwar nicht ganz denselben Rechtsstatus besassen, aber sich im Glauben vereint wussten, der damals das wichtigste Band darstellte. Dagegen verfestigte sich mit dem Interim die zwinglianische Abneigung gegen die Lutheraner, sodass die schweizerischen Reformierten sich grundlegend vom Reich entfremdeten, wo nur wenige Territorien wie die Kurpfalz reformiert wurden.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.