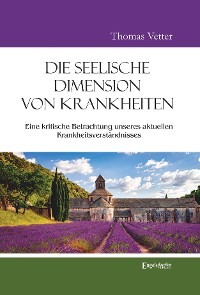Kitabı oku: «Die seelische Dimension von Krankheiten», sayfa 3
Das biomedizinische Verständnis von Krankheitsursachen
Für die Biomedizin ist dann eine Krankheit existent, wenn sie körperlich nachgewiesen wurde, oder wie im Fall von psychiatrischen Erkrankungen, eindeutige und typische Symptome zeigt. Als Ursache für einen Schlaganfall gilt zum Beispiel ein verstopftes Hirngefäß, was mit Ultraschall oder Angiografie bildgebend nachgewiesen werden kann. Ein Thrombus, der zur Verstopfung geführt hat, kann sich im Herzen gebildet haben. Es ist auch möglich, dass sich Verkalkungsstrukturen an der Halsschlagader abgelöst haben. Auch diese Verursachungen sind nachweisbar oder zumindest wahrscheinlich zu machen. Für eine rheumatische Erkrankung gilt eine Störung des Immunsystems mit der Folge des Angriffs von Immunzellen gegen den eigenen Körper als Ursache dieser Erkrankung. Auch die Stoffwechselaktivität dieser Immunvorgänge ist messbar. Für eine Parkinsonkrankheit gilt eine verminderte Produktion von Botenstoffen in bestimmten Regionen des Gehirns, die für den flüssigen Bewegungsablauf zuständig sind, als Ursache der Erkrankung. Medikamente, die diese Botenstoffe zuführen (Dopamin), mildern die Krankheitssymptome.
So lässt sich die Ursache jeder denkbaren Krankheit biomedizinisch erklären. Es ist fast immer ein mess- oder sichtbarer Ursprung der Krankheit zuordenbar, der als Krankheitsursache aufgefasst wird. Nun gibt es aber auch Krankheiten, deren Ursache biomedizinisch nicht erklärt werden kann. Hierzu zählen die meisten Krebserkrankungen, aber auch bestimmte psychiatrische Krankheiten sowie die Alzheimer-Demenz. Es wird sehr viel Energie und Geld darauf verwendet, die Ursachen auch dieser Erkrankungen zu erforschen, bisher mit recht bescheidenem Erfolg. Denn die Biomedizin geht davon aus, dass die Kenntnis der messbaren Ursachen der Erkrankung dazu führen kann, dass sich deren Behandlungsmöglichkeiten verbessern.
Bei genauer Betrachtung erschließen sich aber die wirklichen und letzten Ursachen einer Erkrankung der Biomedizin nicht. Das gestörte Immunsystem, die Thrombenbildung im Herzen oder an den Halsschlagadern, der gestörte Zuckerstoffwechsel als Ursache des Diabetes mellitus, die verminderte Dopaminproduktion im Gehirn bei der Parkinsonkrankheit sind doch nur die mess- und sichtbaren Ursachen, d.h. die materiellen Grundlagen der jeweiligen Erkrankungen. Was löst aber eine gestörte Immunreaktion aus? Was ist die Ursache fehlender Dopaminrezeptoren im Gehirn? Welcher Ursache liegt eine Thrombenbildung im Herzen oder Arteriosklerose an den Halsschlagadern zugrunde? Keine dieser letzten Ursachen, die eine Krankheit erst in Gang bringt, ist der Biomedizin bekannt. Dies gilt für alle bekannten Krankheiten, ja sogar für Verletzungen oder Erbkrankheiten. Denn genau genommen ist die Ursache des Beinbruches nicht der Fahrradsturz als solcher, sondern die Konstellation, die geherrscht hat, als sich der Fahrradsturz ereignet hat. Auch die Ursache einer Erbkrankheit ist nicht das mathematisch zufällige Vererben eines kranken Genes von den Eltern auf die Kinder, sondern in ihrem Ursprung doch auch in der Frage zu suchen, welche Konstellation dazu geführt hat, dass in der Ahnenfolge erstmals eine Person zum Träger einer Erbkrankheit wurde.
Die Hypothese von Risikofaktoren, die die Entwicklung bestimmter Krankheiten begünstigen, ist zwar hilfreich, denn sie resultiert aus Erfahrungswissen und statistischen Erhebungen und kann dazu beitragen, die Gefahr für die Entwicklung bestimmter Krankheiten zu vermindern, wenn diese Risikofaktoren vorbeugend vermieden werden. Aber sie begünstigen allenfalls die Entwicklung bestimmter Krankheiten, verursachen sie aber nicht. Diese Risikofaktoren sind auch nicht grundsätzlicher Natur, denn sonst hätte unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt als Kettenraucher nicht ein Alter von 96 Jahren erreicht, wo Rauchen als wichtigster Risikofaktor für Lungenkrebs, Herzinfarkt und Schlaganfall gilt.
Auch hier stößt die Biomedizin an ihre Grenzen und berührt damit die Fragen auch seelischer Verursachung von Krankheiten, denn die eigentlichen Ursachen von Krankheit sind nicht materiell fassbar, nicht sicht- und messbar, sondern sind sehr viel tiefer im Geflecht seelischer Konstellationen zu suchen, wo Geist, Körper und Umwelt miteinander verflochten sind.
Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass all das, was als Krankheit biomedizinisch mess- und sichtbar zu machen ist, nur materielle Äußerungsform oder Folgeerscheinung von Krankheiten ist, deren Grundlage und Ursache sich grundsätzlich von der biomedizinischen Sichtweise unterscheidet.
Problem der Klassifikation und Untergliederung von Krankheiten
Um sich in der Welt zurechtzufinden, bilden die Menschen seit Urzeiten Kategorien. Auch Tiere müssen sehr genau Fressfeinde oder auch Beutetiere erkennen, um überleben zu können. Kategorienbildung war ursprünglich für uns Menschen lebens- und überlebensnotwendig und hat uns die Entwicklung ermöglicht, die wir genommen haben. Dabei handelt es sich bei der Kategorienbildung immer um Verallgemeinerungen. Die Kategorie Baum vernachlässigt, dass es unterschiedliche Bäume gibt, wie Linden, Kastanien, Eichen oder Pappeln. Es vernachlässigt auch, ob es sich um einen großen oder kleinen Baum, einen alten oder jungen Baum, einen Baum in einer bestimmten Jahreszeit, mit oder ohne Blätter oder Blüten handelt. Der ganz eigene individuelle Baum, der vor unserem Haus steht, mit einer ganz eigenen Rinden- und Aststruktur und Anordnung der Blätter, die kein zweiter Baum in dieser Form aufweist, wird hierbei vernachlässigt. Ein solcher einzigartiger Baum gehört noch nicht einmal in unser vorrangiges Wahrnehmungsspektrum, denn wenn wir einen Baum sehen, gelingt es uns vielleicht noch anhand der Struktur und Blätter, die Art des Baumes zu bezeichnen. Wir können unterscheiden, ob er alt oder jung ist und wir wissen auf Anhieb, welcher Jahreszeit er ausgesetzt ist. Aber wir nehmen den einzelnen Baum mit seinen Besonderheiten nur wahr, wenn wir uns ganz bewusst ihm zuwenden.
Kategorisierung betreiben wir automatisch und oft unbewusst für alle Phänomene, mit denen wir im Leben konfrontiert sind, nicht nur für Lebewesen wie Bäume oder Tiere, sondern auch für Begriffe, Sprachen, Denkmuster oder Emotionen. Wir teilen auch Menschen in Kategorien ein. Zum Beispiel in solche, die wir sympathisch finden und solche, die wir unsympathisch finden oder in fremde und vertraute Menschen oder auch in kranke und gesunde Menschen.
Kategorienbildung ist notwendig und hilfreich für die Orientierung in unserer Umwelt und für die Fähigkeit, unser Leben zu bestreiten. Wir sprechen und denken sogar in Kategorien und unsere Wahrnehmung ist überwiegend eine Wahrnehmung in Kategorien. Wir vernachlässigen hierbei die ganz individuellen Gegebenheiten nicht nur eines Baumes oder eines Blattes, sondern auch des einzelnen Menschen, dem wir begegnen. Fast automatisch läuft hier für uns eine Kategorienbildung ab und wir ordnen einen uns bis dahin unbekannten Menschen innerhalb von wenigen Sekunden in sympathisch oder nicht sympathisch, hübsch oder nicht hübsch ein. Dass diese Kategorienbildung nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile bringt, liegt auf der Hand. Wir verbauen uns damit viel zu oft die Möglichkeit, den ganz eigenen Menschen mit seinen Begabungen, Fähigkeiten und Ansichten kennenzulernen.
Wir bilden auch Kategorien bei Krankheiten. Wir ordnen Krankheiten nach der Art ihrer Befunde, nach der Art ihrer Symptome, nach der Art ihrer vermeintlichen Ursachen oder nach ihren Auswirkungen in jeweils unterschiedliche Kategorien ein, d.h. wir fassen uns ähnlich erscheinende Krankheitsbilder in jeweils einer Krankheitsgruppe zusammen. Für die jeweilige Krankheitsgruppe haben sich entsprechende Untersuchungsverfahren und Behandlungsverfahren etabliert, die für diese Krankheitsgruppe dann auch eine gewisse Wirksamkeit entfalten. So kommt es, dass eine Krebserkrankung chirurgisch und eine bakterielle Infektionserkrankung mit Antibiotika behandelt wird. Krankheitskategorien zu bilden, ist aber auch hier eine Vereinfachung und geht auf Kosten der individuellen Krankheit des einzelnen Patienten. Denn Krankheitsgruppen sind nichts Statisches und streng von einander Abgegrenztes. Es gibt nicht DIE Krebserkrankung oder DEN Schlaganfall oder DIE Infektionserkrankung. Es gibt mehr Überschneidung zwischen einzelnen Krankheits- oder Störungsgruppen, als das ausschließliche Vorhandensein einer Krankheitskategorie. Es gibt eine Fülle unterschiedlicher Reaktionsmöglichkeit des Körpers oder der Seele auf Symptome oder die Krankheit. Umwelt, Familie und Gesellschaft beeinflussen die Sicht und die Reaktionsweise auf die Krankheit des einzelnen Patienten. Auch Erziehung, Charakter und Wissen haben Einfluss auf die Art der Wahrnehmungen einer Krankheit und darauf, wie damit umgegangen wird.
Die Kategorienbildung bei Krankheiten in der Biomedizin bewirkt einen Tunnelblick auf die Krankheit als Kategorie mit Lehrbuchwissen über diese oder jene Krankheitskategorie. Die zunehmende Orientierung an sogenannten Leitlinien für Diagnostik und Therapie bei bestimmten Krankheitskategorien ist zudem geeignet, diesen Tunnelblick zu verschärfen. Der Mensch in seiner Vielfalt geht dabei für Therapeuten und Ärzte verloren. Er wird sogar ausgeblendet, um den Blick auf das vermeintlich Wesentliche der Krankheit in seiner Kategorisierung nicht zu verstellen. Die Fähigkeit, zuerst den Menschen mit seinen Ressourcen, Fähigkeiten und Selbstheilungskräften zu sehen und, hieraus abgeleitet, einen ganz individuellen Blick auf die Krankheit des betroffenen Patienten zu entwickeln, ist nicht mehr Prinzip biomedizinischen Denkens und Handelns. Dadurch wird die wesentlichste Grundlage für individuelle Hilfe und Heilung vergeben.
Die immer differenziertere Unterkategorienbildung bei Krankheiten, die seit ca. 50 Jahren von Seiten wissenschaftlicher Medizin vorangetrieben wird und die neuerdings mit dem Schlagwort „personalisierte Medizin“ belegt wird, ist in den letzten 10 Jahren Ausdruck von Bemühungen der Biomedizin, eine bestimmte Reaktionsweise auf Medikamente und Therapien, abhängig von der jeweiligen Genkonstellation des Patienten, zu identifizieren. Sie sind nicht geeignet, das Problem zu entschärfen und missverständlich. Es führt vielmehr dazu, dass Ärzte noch mehr den Blick auf Lehrbuchwissen und eine zunehmend größere Fülle von Kategorien richten müssen, weg von den ganz individuellen und eben nicht in Kategorien pressbare Gegebenheiten des einzelnen Patienten. Die Nutzung von Kenntnissen der ganz individuellen Gegebenheiten des einzelnen Patienten in Diagnostik und Therapie erfordert vielmehr, sich vom Denken in Kategorien zu lösen, ein unvoreingenommenes, mitfühlendes und verständnisvolles Eingehen auf den einzelnen Patienten, unabhängig von der Frage, welcher Krankheitskategorie sein Leiden zuzuordnen ist.
Gute und hilfreiche Medizin ist insofern auf beides angewiesen - einerseits auf Kategorienbildung, um sich orientieren zu können. Andererseits auf den erfahrenen Blick auf die ganz eigenen Krankheitsbedingungen eines Patienten. Ein Patient mit einer schweren Depression wäre falsch in einer orthopädischen Klinik. Hierzu ist Kategorienbildung notwendig, um das Störungsbild des Patienten durch die richtigen Fachleute beurteilen, diagnostizieren und behandeln zu können. Einem Patienten mit schwerer Depression wird man aber auch als fähiger Psychiater dann nicht gerecht, wenn man nur die Depression im Blick hat und diese nur nach Kategorien und Leitlinien diagnostiziert und behandelt. Er muss sich dann nicht wundern, wenn die Behandlung nicht ausreichend erfolgreich ist oder bald ein Rückfall der Depression eintritt.
Das Problem statistischer Bewertungen in der Biomedizin
Ein ähnliches Problem ergibt sich aus der Orientierung an wissenschaftlich statistischen Erhebungen und Bewertungen als Grundlage für biomedizinisches Vorgehen.
Statistiken spielen für unser tägliches Leben eine wichtige Rolle. Der Prozentsatz von Stimmenabgaben für eine politische Partei bei der Bundestagswahl bestimmt darüber, wer uns regiert. Statistische Berechnungen über Klimaveränderungen lässt uns für die Zukunft eine Klimaerwärmung erwarten mit statistisch ermittelten Folgen für den Stand des Meeresspiegels und für Auswirkungen auf Landwirtschaft und Ernährung der Weltbevölkerung. Es wird mit statistischen Methoden ermittelt, was getan werden muss, um die Klimaerwärmung zu begrenzen. Statistische Ermittlungen spielen eine Rolle bei der Entscheidung über die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Produkten. Mit einfachen statistischen Methoden setzen wir fortlaufend unser Einkommen zu unseren Ausgaben in Beziehung mit dem Ziel, nicht über unsere Verhältnisse zu leben. Statistische Methoden sind insofern ein wichtiges Hilfsmittel für unsere eigene Orientierung und Ausrichtung auf die Zukunft.
Was ist Statistik? Bei der Statistik werden mathematische Verfahren angewandt, die uns Auskunft geben über die Häufigkeit bestimmter Gegebenheiten, Ereignisse, Produkte oder auch Krankheiten in Bezug zu einer Referenzgröße. Meistens wird hierbei eine Unterkategorie zu einer übergeordneten Kategorie in Beziehung gesetzt, um über die Häufigkeit der Unterkategorie Auskunft zu erhalten.
In der Biomedizin wird zum Beispiel geprüft, wie häufig bestimmte Erkrankungen bei einer definierten Anzahl von Menschen auftreten oder es wird geprüft, ob die Behandlungsmethode X im Vergleich zur Behandlungsmethode Y, angewandt bei einer bestimmten Krankheitskategorie, bei einer definierten Patientenzahl, im Durchschnitt wirksamer, gleich wirksam oder unterlegen ist. Mit statistischen Methoden wird auch die durchschnittliche Aussagekraft von Untersuchungsmethoden und Wirksamkeit nichtmedikamentöser Behandlungsmethoden wie chirurgischer Behandlung, Katheterbehandlung oder Strahlenbehandlung geprüft.
Da seit langem bekannt ist, dass die Untersuchungsergebnisse statistischer Erhebungen nicht wertfrei zu erhalten sind, zum Beispiel von der Erwartungshaltung des Untersuchers beeinflusst werden, werden bei diesen statistischen Untersuchungen zusätzliche Verfahren angewandt, die verhindern sollen, dass Ergebnisverfälschungen eintreten, die die statistische Erhebung unbrauchbar machen. Eine Maßnahme ist zum Beispiel die Testung einer Behandlung im Vergleich zu einer Scheinbehandlung (Placebobehandlung). Eine andere Methode ist die sogenannte Randomisierung, mit der versucht wird, beim Vergleich zweier Gruppen die Gruppen auch hinsichtlich Alter, Geschlecht, aber auch Begleiterkrankungen oder Krankheitsdauer oder Krankheitsschwere vergleichbar zu gestalten. Hierbei wird auch das Mittel der Zufallsverteilung angewandt. Eine weitere Methode ist die sogenannte Doppelblinderhebung, wo weder Patient noch Untersucher weiß, welche von zwei Methoden oder Medikamenten angewandt wird und wo schließlich auch der Auswerter unabhängig vom Untersucher bleibt.
Trotz konsequenter Einhaltung all dieser Vorsichtsmaßnahmen sind exakte statistische Ergebnisse, d.h. unverfälschte Ergebnisse, in der Biomedizin kaum möglich. Es ist bestenfalls eine Annäherung an exakte Ergebnisse mit letztlich hinreichender Aussagefähigkeit möglich. Dass auch diese strenge Einhaltung aller statistischen Prinzipien in der Biomedizin häufig nicht beachtet wird, ist hinlänglich bekannt. Selbst renommierte biomedizinische Wissenschaftler wurden wegen Fälschung oder Manipulation von Studienergebnissen entlarvt. Die Durchführung vieler statistischer Erhebungen, möglichst auch mit spektakulären Ergebnissen, erhöht das Renommee von Universitätskliniken oder Instituten und den Wissenschaftlern, die diese Erhebungen durchführen. Dass hier ein Anreiz zu Manipulation oder auch zu Masse auf Kosten von Qualität besteht, ist offensichtlich.
Die Statistik ist das wichtigste Werkzeug in der biomedizinischen Wissenschaft. Von ihr abhängig werden Untersuchungs- und Behandlungsverfahren bewertet und sie bilden die Grundlage von sogenannten Leitlinien im Umgang mit den verschiedenen Krankheitsbildern. Kein modernes medikamentöses Behandlungsverfahren in der Biomedizin wird etabliert ohne vorausgehende aufwändige statistische Überprüfungen zu deren Wirksamkeit.
Nichtmedikamentöse Behandlungsverfahren wie Operationen oder Katheterbehandlungen sind dagegen meist nicht mit exakten statistischen Methoden auf ihre Wirksamkeit prüfbar. Denn hier muss der Behandler wissen, welche Methode er anwendet. Insofern ist sogenannte doppelblinde Untersuchung des Behandlungserfolges kaum durchführbar. Die beste Wirksamkeitsprüfung einer Operationsmethode wäre die Prüfung gegenüber einer Scheinoperation. Gegen Scheinoperationen gibt es ethische und rechtliche Bedenken. Insofern sind Operationen oder andere nichtmedikamentöse Behandlungen nur aufgrund einer nachträglichen statistischen Prüfung etabliert. Hierbei wird der Anteil der Patienten geprüft, bei dem die Behandlung wirksam oder nicht wirksam war oder inwieweit die Behandlung wirksamer oder nicht wirksamer gegenüber einer anderen Behandlung war. Der größte Teil statistischer Fehlerquellen ist hiermit nicht ausgeschlossen und führt letztlich oft zu fehlendem Nachweis von tatsächlicher Wirksamkeit der Behandlungsmethode.
So ist für viele Operationen der Nachweis tatsächlicher Wirksamkeit oder ihrer Überlegenheit gegenüber medikamentöser Behandlung nicht erbracht. Dies gilt zum Beispiel für die meisten Operationen am Rücken oder der Bandscheiben. Für die arthroskopische Behandlung des Knies, einer der häufigsten operativen Behandlungen, wurde sogar der Nachweis erbracht, dass diese Behandlung nicht wirksamer ist als eine sogenannte Scheinbehandlung. Sie wird aber weiterhin tagtäglich in unserem Lande durchgeführt.
Die Statistik in der Biomedizin birgt aber nicht nur die Gefahr mangelnder Exaktheit der Ergebnisse und der Möglichkeit von Manipulation. Im Umgang mit Statistik in der Medizin offenbart sich ein grundsätzliches Problem. Dieses Problem ergibt sich aus der statistischen Methode selbst. Denn Statistik prüft immer nur Durchschnittswerte und Wahrscheinlichkeiten. Wenn statistisch ermittelt wurde, dass das Medikament A eine 10 Prozent bessere Wirkung hat als das Medikament B, heißt dies nichts anderes, als dass zum Beispiel von 100 behandelten Patienten mit dem Medikament B 30 und mit dem Medikament A 40 Patienten erfolgreich behandelt wurden. Als Arzt wird man zukünftig in der Behandlung dieser Krankheit das Medikament A verwenden. Das Medikament B rückt allenfalls an eine Ersatzposition oder darf aufgrund der statistischen Ergebnisse gar nicht mehr verwendet werden.
Es bleibt aber hierbei völlig unklar, ob von den 100 behandelten Patienten die gleichen 30 Patienten bei der Behandlung mit A profitiert hätten wie bei der Behandlung mit B oder ob sogar bei der Behandlung mit A Patienten profitiert hätten, die bei B nicht profitiert haben. Zudem bleibt auch für die Zukunft völlig unklar, welcher einzelne Patient nun von der Behandlung profitiert und welcher nicht. Dass ein Medikament zu 40 Prozent bei einer Krankheit gut wirksam ist, stellt im Vergleich noch eine recht gute Bilanz der Wirksamkeit des Medikaments dar. Der einzelne Patient kann aber mit diesem Ergebnis nichts anfangen. Denn bei ihm weiß niemand, ob er zu der Gruppe gehört, die auf das Medikament nicht ansprechen oder zu der, die auf das Medikament ansprechen. Es kann nur gesagt werden, dass er bei Einsatz des Medikaments A eine 10 Prozent höhere Chance hat, zu der Gruppe zu gehören, die auf das Medikament positiv anspricht, als auf das Medikament B. Letztlich gibt es keine Möglichkeit vorherzusagen, ob der einzelne Patient von der Behandlung profitiert oder nicht. Hier besteht nur die Möglichkeit, die Behandlung durchzuführen und am Resultat zu erkennen, ob sie sich als positiv erwiesen hat oder nicht. Dies ist ein Vorgehen, was bei einer Behandlung mit relativ nebenwirkungsarmen Medikamenten, wie zum Beispiel ein Versuch mit Parkinsonmitteln bei dem Verdacht auf das Vorliegen einer Parkinsonerkrankung, gerechtfertigt erscheint. Wie ist es aber bei Operationen, Bestrahlungen oder Behandlungen mit Zellgiften? Auch hier müssen wir zum Preis oft erheblicher Nebenwirkungen, auch Komplikationen und Folgeerscheinungen, bereit sein zu Versuch und Irrtum.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus statistischen Erhebungen in der Biomedizin dadurch, dass die Ergebnisse statistischer Erhebungen nicht ausreichend berücksichtigen, dass zum Beispiel die Behandlung A bei dem einen Patienten mit einer bestimmten Erkrankung am besten hilft, aber die Behandlung B bei dem anderen Patienten mit derselben Erkrankung besser hilft. Denn aufgrund statistischer Ergebnisse kommen gerade die Behandlungsmethoden oder Medikamente, die ja statistisch am schlechtesten abschneiden, kaum noch zur Anwendung oder die Zulassung zur Anwendung wird aufgehoben oder deren Anwendung gilt nicht mehr als leitliniengerecht. Selbstverständlich ist es mit statistischen Mitteln nur sehr schwer möglich, Untergruppen von Patienten einer Krankheit zu bilden, die dann das Ergebnis bringen würde, dass die eine Gruppe auf diese Behandlung und die andere Gruppe auf jene Behandlung besser reagiert. Denn um statistische Aussagen treffen zu können, benötigt man eine große Anzahl von Patienten, die untersucht werden kann und zudem im Gruppenvergleich zu wichtigen Parametern ähnlich ist.
Eine Medizin, die sich ganz vorrangig auf statistische Erhebungen gründet, gilt zwar in der Biomedizin als erstrebenswert. Sie wird in weiten Teilen schon angewandt und mit immensem Forschungsaufwand vorangetrieben. Es handelt sich hierbei aber um eine sehr einseitige und verallgemeinernde Medizin, die sich an Durchschnittswerten und statistischem Mittel orientiert. Die wichtigsten Grundlagen für Hilfe zur Genesung und Heilung werden hiermit vernachlässigt und müssen geradezu ausgeblendet werden. Eine auf Gruppendurchschnitt orientierte Medizin muss sich nur auf wenige Fragestellungen konzentrieren und kann nicht die Komplexität der Ursachen und Wirkungszusammenhänge des einzelnen kranken Menschen berücksichtigen. Sie muss bei erfolgloser Anwendung im Einzelfall bei einer statistisch als wirksam geltenden Behandlung, dem einzelnen Patienten gegenüber kapitulieren und müsste offen zugestehen, dass hier die als wirksam geltende Behandlungsmethode in diesem Behandlungsfall nicht wirkt. So offen und so geradlinig wird dies selten von einem Arzt gesagt. Es wird dann meist auf die Notwendigkeit der Änderung der Behandlung oder die Erhöhung der Medikamentendosis hingewiesen.
Der Umgang mit statistischer Testung von Behandlungsmethoden ist aber über das hier Gesagte hinaus noch deutlich komplexer. Statistische Tests von Untersuchungsverfahren erfordern einen hohen finanziellen Aufwand. Die Finanzierung für Medikamententests wird in Europa noch überwiegend von den Pharmafirmen gewährleistet. Diese haben ein wirtschaftliches Interesse daran, dass die Tests zugunsten ihres getesteten Medikaments ausgehen. Sie gewinnen Universitätsprofessoren, in deren Federführung die Tests durchgeführt werden und die damit in finanzielle Abhängigkeit der Pharmafirmen geraten. Da von dieser Finanzierung auch die Universität einen wesentlichen Anteil erhält, ist auch diese daran interessiert, dass die Auftraggeber mit den Testergebnissen zufrieden sind. Hieraus ergibt sich ein Geflecht von finanziellen Interessen, das häufig nicht ohne verfälschenden Einfluss auf Testergebnisse bleibt. Die Testanordnungen werden von vornherein so konzipiert, dass die Wahrscheinlichkeit eines positiven Testergebnisses sehr hoch ist. Testuntersuchungen, die mit negativem Testergebnis enden, d.h. wo die Unwirksamkeit oder deutlich verminderte Wirksamkeit einer Behandlungsmethode das Ergebnis der Untersuchung ist, werden so gut wie kaum durchgeführt oder nur dann, wenn ein Konkurrenzmedikament vom Markt verdrängt werden soll. Sie liegen eigentlich nicht im finanziellen Interesse der beteiligten Akteure. Dabei wären statistische Untersuchungen, die auf die Frage gerichtet sind, ob eine Behandlungsmethode überhaupt wirksam ist, von ganz erheblicher Bedeutung in der Medizin. Behandlungsmethoden, die nicht statistisch geprüft wurden, aber aus unterschiedlichen Gründen gut etabliert sind, würden dann, wenn sie sich als statistisch unwirksam erweisen, nicht mehr den Stellenwert einnehmen, den sie bisher hatten. Der Anteil nicht statistisch geprüfter Behandlungsmethoden, sowohl medikamentöser Behandlungen als auch chirurgischer Behandlungen, stellt immer noch den größten Anteil von Behandlungen in der Biomedizin dar.
Statistische Untersuchungen in der Medizin sind auf die Einwilligung des einzelnen Patienten angewiesen, der untersucht werden soll. Also werden entsprechende Untersuchungen nicht oder nur sehr selten durchgeführt bei nichteinwilligungsfähigen Patienten, zum Beispiel Kindern oder Demenzpatienten. Statistische Testuntersuchungen von Medikamentenwirkung in Europa oder in den USA durchzuführen, erfordert für die Pharmafirmen einen weitaus höheren finanziellen Aufwand, als diese Untersuchungen in Entwicklungsländern durchzuführen. Dass die Qualität der Testuntersuchungen einschließlich der Aufklärung und Einwilligung der Testpatienten in den Entwicklungsländern teilweise sträflich vernachlässigt wird, ging durch die Medien. Es kam zur Streichung der Zulassung einer umfangreichen Liste an Medikamenten, bei denen die geltenden Standards statistischer Erhebungen für den Wirksamkeitsnachweis eines Medikaments nicht eingehalten wurden.
Medizinisch-statistische Testuntersuchungen sind zudem nicht nur darauf gerichtet, ob eine Behandlungsmethode wirksam, nicht wirksam oder besser wirksam ist, als eine andere Behandlung. Sie müssen stets auch das mögliche Nebenwirkungsprofil, was sich aus der zu testenden Behandlungsmethode ergibt, mit berücksichtigen und dieses in Beziehung setzen zu bereits getesteten oder bereits etablierten Behandlungsverfahren. Damit wird vermieden, dass ein Medikament zur Anwendung kommt, welches sich einem anderen Medikament gegenüber als deutlich wirksamer erweist, aber schwerwiegende, vielleicht auch tödliche Nebenwirkungen hat. Denn stets gilt es auch zu prüfen, ob bei der Behandlungsmethode das Verhältnis zwischen Nutzen und Wirksamkeit einerseits und Nebenwirkungsprofil andererseits deutlich zugunsten des Nutzens überwiegt. Patienten reagieren nicht nur auf die Wirkung von Behandlungen, sondern auch auf die Nebenwirkungen sehr unterschiedlich. So kann es vorkommen, dass die geprüfte Behandlung sich zwar statistisch als ausgesprochen gut wirksam erweist, auch mit nur milden oder sehr selten schwerwiegenden Nebenwirkungen. Aber der Patient, der dann doch von einer schwerwiegenden Nebenwirkung betroffen ist, hat unter statistischem Blickwinkel einfach nur Pech gehabt. Besonders tragisch ist dies dann, wenn er auch zu der Patientengruppe gehört, bei der die Behandlung gar nicht wirksam sein konnte. In diesem Fall wurde eine nicht nur überflüssige, sondern auch schädliche Behandlung durchgeführt. Dies kommt leider häufig vor, besonders dann, wenn mehrere chronische Krankheiten langfristig und gleichzeitig behandelt werden. Es kann vorkommen, dass zehn oder fünfzehn verschiedene Medikamente eingesetzt werden. Dass sich eine solche Vielzahl von Medikamenten gegenseitig negativ beeinflusst, liegt auf der Hand. Medikamentenwechselwirkungen und -unverträglichkeiten sind eine der häufigsten Ursachen für Krankenhauseinweisung und -behandlung.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.