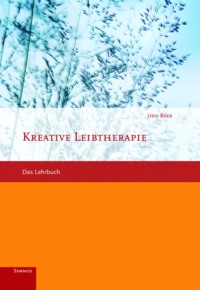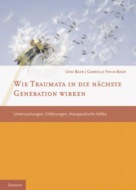Kitabı oku: «Kreative Leibtherapie», sayfa 8
Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin
Türler ve etiketler
Yaş sınırı:
0+Hacim:
563 s. 23 illüstrasyonISBN:
9783934933378Yayıncı:
Telif hakkı:
BookwireSeriye dahil "Semnos Lehrbuch"