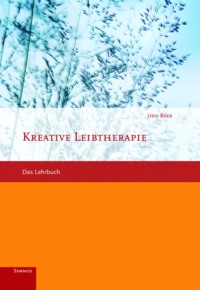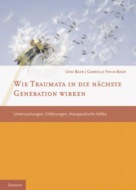Kitabı oku: «Kreative Leibtherapie», sayfa 6
2.2.8 Wirksamkeit
Menschen brauchen die Erfahrung, etwas bewirken zu können. Wenn eine Partnerin in einer Paarbeziehung äußert: „Es ist egal, was ich versuche, ich erreiche nichts. Und ich erreiche meinen Mann nicht”, und es bei solchen Erfahrungen bleibt, dann ist dieser Beziehung keine lange Zukunft vorherzusagen. Das Gefühl der Wirksamkeit ist den meisten Menschen so selbstverständlich, dass es kaum Beachtung findet. Erst wenn diese Wirksamkeit eingeschränkt ist, verboten wird oder ins Leere geht, dann wird ihr Fehlen zum Problem, kann zu Verunsicherung und Selbstabwertung führen und den gesamten Prozess des Erlebens einschränken.
Deshalb zähle ich die Wirksamkeit zu den Grundqualitäten der Leiblichkeit. Maurice Merleau-Ponty schrieb, dass der Mensch sich leiblich in seinem Handeln erfährt, und fasste diesen Aspekt prägnant zusammen: „Mein Leib ist da, wo er etwas zu tun hat.” (Merleau-Ponty 1966, S. 291)
Um die Bedeutung der Wirksamkeit zu verstehen, ist es hilfreich, auf den „Gestaltkreis” von Viktor von Weizsäcker Bezug zu nehmen. Viktor von Weizsäcker beschrieb in seinem „Gestaltkreis” eine Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen. Die Trennung in der naturwissenschaftlichen Medizin zwischen Wahrnehmungsmechanismen und Bewegungsapparat ist demnach nicht haltbar. Er beschreibt dies am Drehtürprinzip:
Ein Mensch bewegt sich in einer Drehtür, und darin wird diesem Menschen die Wahrnehmung der Bewegung sowohl der Tür als auch der eigenen Person sichtbar und spürbar – und gleichzeitig ist die Bewegung Ergebnis und sogar Teil der Wahrnehmung. Das Wechselverhältnis zwischen Bewegung und Wahrnehmung nennt er „Gestaltkreis” (von Weizsäcker 1997b, S. 83ff).
Dieses Wechselverhältnis zwischen Bewegen und Wahrnehmen verdichtet sich in der leiblichen Qualität der Wirksamkeit. Ohne das Grundgefühl, dass das eigene Drücken gegen eine Drehtür diese in Bewegung setzen wird, würde kein Mensch durch eine Drehtür gelangen. Schon in der Wahrnehmung der Drehtür ist diese Grunderwartung von Wirksamkeit enthalten.
Deutlich wird dieser Zusammenhang vor allem in der Entwicklung von Kleinstkindern in den ersten Lebensmonaten. Säuglinge machen die Erfahrung, dass sie Wirkung erzielen, wenn sie schreien oder strampeln. Und wenn sie die Erfahrung machen, dass niemand kommt, dass niemand auf ihre Äußerungen reagiert, dann werden diese Äußerungen entweder verzweifelter oder die Kinder resignieren und lassen in Wahrnehmung, Bewegung und anderen Impulsen nach. Werden aus Säuglingen Kleinkinder, wissen alle Eltern ein Lied davon zu singen, wie ihre Jungen und Mädchen ihre Wirksamkeit in ihrem Handeln entdecken und zum Beispiel immer wieder einen Löffel greifen und vom Tisch fallen lassen: Es klingt so schön und es kommt jemand und hebt ihn wieder auf. Piaget beschrieb diesen Prozess als eine Erweiterung des Gestaltkreises zu einem „Zweck-Mittel-Erfolgs-Kreis” (Piaget 1974, S. 220).
In der therapeutischen Arbeit begegnen uns Störungen der Leibqualität der Wirksamkeit vor allem als Einschränkungen der Beziehungswirksamkeit. In Problemen der Beziehungswirksamkeit nehmen die unterschiedlichsten Wirksamkeitsphänomene ihren Ausgangspunkt. Auch der Brandstifter, der Gegenstände anzündet, um ein Wirksamkeitsgefühl zu erleben (es brennt, die Feuerwehr löscht, die Presse berichtet, andere Leute haben Angst …), agiert sein fehlendes Wirksamkeitsgefühl an den Objekten aus, die er anzündet. (Wohlgemerkt: Das ist eine Erklärung, keine Entschuldigung.) Doch die größte Befriedigung erfährt er dadurch, dass und wie andere Menschen auf sein Handeln reagieren. Die Vermutung drängt sich auf, dass sein Gefühl von Wirkungslosigkeit seinen Ursprung in zwischenleiblichen Erfahrungen hatte. Solchen Zusammenhängen sind wir Leibtherapeut/innen in therapeutischen Prozessen immer wieder begegnet.
Eine Klientin litt an der Erfahrung und dem Gefühl der Nein-Wirkungslosigkeit. Sie hatte sexuelle Gewalt erleiden müssen, ihr Nein war nicht gehört worden.
Die andere Klientin litt an der Erfahrung und dem Gefühl der Ja-Wirkungslosigkeit. Sie war viele Jahre lang mit ihren Wünschen und Erwartungen ins Leere gegangen und hatte aufgehört, zu wünschen, zu fordern, zu erwarten.
Das Gefühl der Wirkungslosigkeit führt an dem einen Pol zum Ausagieren oft hektischer, aggressiver, verzweifelter Bemühungen, „irgendwie” Wirksamkeit zu erfahren, oder – an dem anderen Pol – zu resignativem Rückzug, der alle Symptome der Depression umfassen kann. Therapeutisch ist es wichtig, um den Zusammenhang dieser Symptome mit den Störungen der Leibqualität der Wirksamkeit zu wissen. Kreative Leibtherapie bietet vielfältige Wirksamkeitserfahrungen in den kreativen Tätigkeiten an. Erfahrungen der künstlerischen Gestaltung, des Tanzens oder Musizierens, des Schreibens oder der Entwicklung und Darstellung von Szenen sind immer auch Wirksamkeitserfahrungen, nicht nur im Hinblick auf den künstlerischen Ausdruck, sondern auch und letzten Endes entscheidend als Erfahrung von Beziehungswirksamkeit. Kreative Leibtherapeut/innen bieten Klient/innen Wirksamkeitserfahrungen an, in dem sie das Vertrauen in die schöpferische Kraft ihrer Klient/innen mit dem Vertrauen in die heilende Kraft therapeutischer Beziehungserfahrungen verbinden, die diese dann in andere Bereiche ihres Lebens übertragen können.
2.2.9 Zwischenleiblichkeit und Resonanz
Wir betonen in der Kreativen Leibtherapie die heilende Kraft der therapeutischen Beziehung. Dies hat seine Quelle in dem Verständnis, dass in der Zwischenleiblichkeit und Resonanz eine grundlegende Qualität jeden Erlebens besteht.
Jede leibliche Regung eines Menschen in seinen ersten Lebensmonaten entsteht als zwischenleibliche Erfahrung. Die These von der „autistischen” oder „narzisstischen” Phase früher Entwicklung wurde ebenso von der Säuglingsforschung widerlegt wie die von der „Symbiose” zwischen Mutter und Kind. Ob im Austausch der Blicke oder Laute, beim Stillen oder in anderen Berührungen – Säuglinge erleben sich und ihre Welt im leiblichen Austausch. Säuglinge und Kleinkinder sind weder bloße Anhängsel der Mütter noch ich-bezogene Wesen, die von der Welt nichts mitbekommen. Sie sind in ständigem Kontakt, in intensiver Begegnung und wechselseitigem Austausch auf allen Ebenen der Begegnung. Die Leibphänomenologen bezeichnen dies nach Merleau-Pontys Begriff der „intercorporéité” als Zwischenleiblichkeit. Dieser stimmige Begriff prägt das Menschenbild der Kreativen Leibtherapie und wird so zu einer zentralen Grundlage unseres Therapieverständnisses.
„Das Weltverhältnis des Säuglings lässt sich (…) als eine reine Zwischenleiblichkeit beschreiben.” (Fuchs 2000a, S. 275) Hier herrschen weder Autismus noch Symbiose, sondern ein sich immer weiter ausdifferenzierendes Wechselspiel leiblicher Interaktion unterhalb der Schwelle reflektierender Überlegung. Der Säuglingsforscher Daniel Stern hat diese Interaktion zwischen Mutter und Säugling als „Tanz” beschrieben (Stern 2011, S. 9).
Dieser Tanz der Zwischenleiblichkeit differenziert und entfaltet sich mit jeder weiteren Lebenswoche des Säuglings. Die meisten Gefühle zum Beispiel werden in den ersten sieben Lebensmonaten nur in der Interaktion mit den anderen erlebt, erst danach auch als emotionale Regungen, die erst selbst gelebt und dann mit anderen geteilt werden können (s. Stern 1998, S. 150). Aus diesen Erkenntnissen der Säuglingsforschung ist der Schluss zu ziehen: „Gefühle sind ursprünglich im ‚Zwischen‘ beheimatet, eingebettet in die leibliche Kommunikation von Mutter und Kind.” (Fuchs 2000a, S. 276)
Die erste und früheste unmittelbare Beeinflussung des Säuglings durch die Mutter oder andere nahe Bezugspersonen erfolgt über Erregungsverläufe, die sich später zu Erregungskonturen verfestigen können. Hohe oder niedrige Erregungsniveaus, stetige Erregungsverläufe oder abrupte Abbrüche werden in der frühen Zwischenleiblichkeit zwischen Mutter und Säugling übernommen und führen zu ersten Musterbildungen im Säugling. Wir haben diesen Umstand zur theoretischen Grundlage des Komplexen Theoriemoduls „Erregungsverläufe und -konturen” gemacht, das Sie unter den Big Ten finden.
In der späteren Entwicklung des Kindes werden mit den leiblichen Erfahrungen und dem wachsenden Vermögen des Kindes auch die leiblichen Interaktionen differenziert und weiterentwickelt. „Diese ‚Zwischenleiblichkeit‘ bildet ein übergreifendes, intersubjektives System, in dem sich von Kindheit an leibliche Interaktionsformen bilden und immer neu aktualisieren.” (Fuchs 2008b, S. 89)
Von besonderer Bedeutung bleiben dabei die Gefühle, die Stimmungen, das Befinden und die Atmosphären, die Fuchs als „Stimmungsraum” bezeichnet: „Ebenso werden wir von Stimmungen und Gefühlen durch Veränderungen des leiblichen Befindens erfasst. Sie lösen entweder Bewegungsanmutungen aus – wir fühlen uns z. B. gehoben oder gedrückt, angezogen oder abgestoßen; oder sie modifizieren die innerleibliche Dynamik, so dass wir uns etwa beengt, beklommen, gehemmt, befreit oder offen erleben. Wir geraten ‚in Erregung‘, also in eine beweglich-expansive Dynamik, oder wir fühlen uns ‚gedämpft‘, wenn eine dumpfe Zähigkeit der leiblichen Dynamik das teilnehmende Mitschwingen lähmt. – Ich bezeichne nun diese verschiedenen Formen der Wahrnehmung stimmungsräumlicher Phänomene als leibliche Resonanz. Der Leib ist gewissermaßen der ‚Resonanzkörper‘ des Stimmungsraums.” (Fuchs 2000a, S. 197)
Das Wort „Resonanz”, dem in Theorie und Praxis Kreativer Leibtherapie eine zentrale Bedeutung zukommt, stammt vom lateinischen „resonare”. Es bedeutet ein gegenseitiges Hin- und Herschwingen. „Resonanz ist eine Form der Wechselwirkung, ja, es ist die Form der Wechselwirkung schlechthin, über die alle raumzeitlichen Strukturen miteinander in Beziehung treten können.” (Cramer 1998, S. 14) Die Fähigkeit zur Resonanz ist eine grundlegende Qualität aller leiblichen Regungen. Sie beruht auf der Zwischenleiblichkeit und ist eine ihrer besonderen Erscheinungsformen, wir können sie als „Schwester” der Zwischenleiblichkeit bezeichnen.
Die unmittelbare Zwischenleiblichkeit ist nicht nur in der frühkindlichen Entwicklung beschreibbar, sie ist auch im Erwachsenenalter Bestandteil und Potential leiblicher Begegnungen: In intensiver Sexualität ebenso wie in zarter Berührung, im Austausch verstehender Blicke wie im Klang einer Stimme, die das Herz berührt. Selbst in der Feindschaft und gegenseitigen Abneigung zweier Menschen wirkt Resonanz. Waldenfels bezeichnet deshalb sehr treffend die „Zwischenleiblichkeit als Verschränkung von eigenem und fremden Leib.” (Waldenfels 2000, S. 284) Der Leib ist kein isoliertes, für sich existierendes Wesen, sondern befindet sich immer in zwischenleiblicher Kommunikation. Selbst wenn Kommunikation verweigert wird, bleibt dies Kommunikation, wie Merleau-Ponty schon 1945 aus der Analyse der Zwischenleiblichkeit ableitete: „Noch die verweigerte Kommunikation ist eine Weise der Kommunikation.” (Merleau-Ponty 1966, S. 413) Davon können die meisten Menschen, denen wir in paar- und beziehungstherapeutischen Konstellationen begegnen, ein leidvolles Lied singen.
In der Therapie begegnen wir Menschen mit unterschiedlichen Ausprägungen und individuellen Mustern der Zwischenleiblichkeit und Resonanz, Resonanzfähigkeit und Resonanzbereitschaft. Sie gehören bei jedem Menschen zur individuellen Persönlichkeit. Zum Thema in der Therapie werden sie, wenn Menschen unter ihren jeweiligen Mustern leiden. In der Kreativen Leibtherapie arbeiten wir mit Angeboten der Resonanz, vor allen Dingen in kreativen Dialogen, und stellen die Resonanz der Therapeut/innen in den Dienst der therapeutischen Interaktion.
Oft zu wenig Beachtung finden in therapeutischen Prozessen Atmosphären und deren nachhaltige Auswirkungen für die Klient/innen. Atmosphären entstehen und wirken über die Zwischenleiblichkeit. Wir Menschen erfassen Atmosphären in unserer Resonanz für das, was bei anderen und in der Umgebung schwingt und „in der Luft liegt”. Die kreativen Ausdrucksmöglichkeiten der Kreativen Leibtherapie, die hierfür den Klient/innen zur Verfügung gestellt werden, sind ein leicht zugänglicher Weg, Atmosphären, die in Menschen beeinflussend nachwirken, zu identifizieren und eine Haltungsänderung ihnen gegenüber zu erfahren.
Das Leiden der Menschen bewegt sich zumeist zwischen den Polen erstorbener Resonanzfähigkeit auf der einen und in der Aufgabe der Meinhaftigkeit in der Resonanzüberflutung durch andere. Hinzu kommen zahlreiche Formen spezifischer Resonanzmuster, in denen Menschen „feststecken” können.
Wir haben differenzierte Modelle der Resonanz entwickelt und werden sie in einem Raum der Big Ten (Kap. 4.11.3) ebenso vorstellen wie Wege der therapeutischen Veränderung mit Hilfe der Resonanz in der Kreativen Leibtherapie.
2.2.10 Ähnlichkeit
Vielleicht erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie einen Menschen wiedergetroffen haben, den Sie seit längerer Zeit nicht mehr gesehen haben. Sie erkennen ihn wieder, auch wenn die Person älter geworden ist, anders gekleidet ist, eine andere Frisur hat und sich vielleicht in einer anderen Stimmung befindet als bei der letzten Begegnung. Manches hat sich in der Erscheinungsweise dieser Person verändert, aber sie ist der Person, die Ihnen schon einmal begegnet ist, ähnlich und Sie können deshalb diesen Menschen wiedererkennen.
Die Ähnlichkeit ist eine grundlegende Eigenschaft der Leiblichkeit, und es sind vor allem drei Aspekte, die diese Qualität für den therapeutischen Kontext so bedeutsam machen.
Der erste Aspekt besteht darin, dass Ähnlichkeit eine grundlegende Art und Weise ist, wie wir Menschen wahrnehmen. „Ähnlichkeit liegt (…) letztlich jeder Wahrnehmung von etwas als etwas zu Grunde.” (Fuchs 2000a, S. 320) Die Menschen erkennen die Mona Lisa, auch wenn sie grafisch verfremdet ist, identifizieren eine Melodie, auch wenn sie in verschiedenen Stilen und Tonlagen gespielt wird. Wenn wir einen Vogel sehen, wissen wir, dass es ein Vogel ist, nicht weil uns die begriffliche Kategorie „Vogel” vorher erläutert wurde oder weil wir das Bild des Vogels aus seinen zahlreichen Einzelheiten zusammensetzen, sondern weil der Vogel, den wir sehen, den Vögeln, die wir kennen, ähnlich ist. Dieses Grundprinzip der Wahrnehmung ist von großem Vorteil, weil wir Menschen dadurch in der Lage sind, schnell unsere Umgebung zu erfassen und uns zu orientieren. Wir können neue Erfahrungen zügig zuordnen, ohne sie erst lange analysieren zu müssen. „Wahrnehmen bedeutet, eine erworbene Vorgestalt an den aktuellen Sinneseindruck heranzutragen, durch das sie sich an ihm erfüllt, auch wenn Details gar nicht übereinstimmen.” (Fuchs 2008, S. 44) Doch diese Wahrnehmungsweise bietet keine hundertprozentige Sicherheit, alles immer richtig zu erkennen und einzuordnen. Ein Chamäleon kann sich so tarnen, dass es – auf einem Baum sitzend – auf den ersten Blick wie ein Teil der Baumrinde aussieht. Das ist sein Schutz. Doch auch wenn die Menschen einige „Chamäleons” übersehen mögen – die Wahrnehmung mittels der Ähnlichkeit ist die Grundlage schneller Orientierung.
Die Ähnlichkeitsqualität in der Wahrnehmung ist deshalb die Grundlage für das Leibgedächtnis, mit dem wir uns später noch beschäftigen werden. Unser Leib erinnert sich an ähnliche Situationen, in jeder Freude klingt die leibliche Erinnerung an frühere freudige Situationen mit – aber in jeder Angst schwingen auch früher erlebte Ängste mit. Für die Therapie ist dies Chance und Falle zugleich. Chance, weil der positive Gehalt früherer Erfahrungen genutzt werden kann, Falle, weil ähnliche Strukturen von Ereignissen oder ähnliche Elemente der Wahrnehmung negative, zum Beispiel traumatische Erfahrungen reaktivieren können. Für die Pflegerin ist das Donnergrollen Ausdruck eines Gewitters, die alte Dame im Altenheim erschrickt und möchte in den Keller flüchten, denn für sie ist das Grollen des Donners der Klang des Artilleriebeschusses oder der Bombenabwürfe. Die Geräusche sind ähnlich und mobilisieren das Leibgedächtnis.
Auch in der Rolle als Therapeutin oder als Therapeut kann die Ähnlichkeit von Situationen einerseits nützlich sein, weil wir dadurch auf unsere Erfahrungen zurückgreifen können – aber sie kann auch in die Irre führen: Ähnlich ist nicht gleich, das heißt, die Gefahr besteht darin, das ähnliche Verhalten einer Klientin mit dem einer anderen, früher bekannten Klientin gleich zu setzen, während die Substanz dieses Verhaltens aber, bis auf einige ähnliche Erscheinungsformen, ganz andere Inhalte in sich tragen kann.
Ein zweiter wichtiger Aspekt der Ähnlichkeit besteht in der schon beschriebenen leiblichen Resonanz. Wir Menschen reagieren auf die behagliche Wärme eines beheizten Wohnzimmers im Januar ähnlich wie auf die Wärme einer intensiven freundschaftlichen Begegnung, den wärmenden Klang der Worte oder die warmherzige Ausstrahlung eines Menschen. „Die Ähnlichkeit wird also durch die gleiche leibliche Resonanz gestiftet.” (Fuchs 2000, S. 202) Ähnlichkeit wirkt also auch in Resonanzen, und auch hier begegnen wir wieder dem Doppelcharakter zwischen Chance und Falle. Gerade weil Resonanzen über Ähnlichkeiten wirken, können sie überhaupt als leibliche Qualität zu Tage treten. Wenn ein Mensch sich nur auf eine genau gleiche und nicht auch ähnliche Situation einschwingen könnte, würde es bestenfalls zu einem Bruchteil der Begegnungen kommen, die diese Bezeichnung verdienen.
Die Herausforderung für den Menschen im Gegenüber besteht darin, dass es insbesondere Therapeutinnen und Therapeuten obliegt, die Ähnlichkeit jeweils zu überprüfen, um nicht zu Pauschalisierungen oder Verallgemeinerungen zu kommen. Wenn wir Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass hinter dem leicht aufgesetzten Lächeln von drei Menschen eine versteckte Aggressivität gestanden hat, werden wir bei einer vierten Person dies auch aufgrund der Ähnlichkeit vermuten. Doch hier kann der Kontext ein völlig anderer sein.
Zur beschriebenen leiblichen Qualität der Resonanz bzw. der Kommunikation im weiteren Sinne gehört auch die Fähigkeit, sich mit anderen Menschen zu identifizieren.
Besonders als Kinder lernen Menschen viel, indem sie andere Menschen imitieren. Dies setzt die Fähigkeit voraus, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen, und dies ist nur möglich, wenn wir den anderen Menschen als uns ähnlich erleben. Auch hier zeigt sich Ähnlichkeit als Leibqualität. In dem folgenden Zitat von Michael Tomasello findet sich der Zusammenhang von Ähnlichkeit und Lernen wieder. Er unterscheidet drei Grundtypen kulturellen Lernens: „Imitationslernen, Lernen durch Unterricht und Lernen durch Zusammenarbeit. Diese drei Typen kulturellen Lernens werden durch eine einzige besondere Form sozialer Kognition ermöglicht, nämlich durch die Fähigkeit einzelner Organismen, ihre Artgenossen als ihnen ähnliche Wesen zu verstehen, die ein intentionales und geistiges Leben haben wie sie selbst. Dieses Verständnis ermöglicht es ihnen, sich in die geistige Welt einer anderen Person hineinzuversetzen, so dass sie nicht nur vom anderen, sondern auch durch den anderen lernen können (…). Wenn ein Mensch etwas ‚durch‘ einen anderen lernt, identifiziert er sich mit diesem anderen und seinen intentionalen und geistigen Zuständen.” (Tomasello 2006, S. 17) Therapeut/innen sind insofern immer auch Lehrende durch Vorbild, ob sie das wollen oder bemerken oder nicht. Das ist wichtig zu wissen. Darüber hinaus ist dieser Aspekt wichtig, weil Klient/innen immer auch dadurch geprägt sind, mit welchen Menschen sie sich identifiziert haben und was sie von ihnen übernommen haben. Diesen Spuren gehen wir in der Kreativen Leibtherapie nach. Und wir bieten neue Erfahrungen durch neue Identifikationen in Rollenspielen, mit tänzerischen und musikalischen Identifikationen und vielen anderen mehr.
Zum Lernen durch Identifikation gehört auch die Wahlmöglichkeit. Kinder identifizieren sich einerseits im Spiel und in der Fantasie mit Pippi Langstrumpf, Luke Skywalker oder anderen Figuren, die sie aus der Fülle der Identifikationsangebote auswählen. Und andererseits identifizieren sie sich mit realen Personen aus ihrem nahen Umfeld. Kleine Kinder haben in der Familie nur eingeschränkte Wahlmöglichkeiten, sich auszusuchen, mit wem sie sich identifizieren und mit wem nicht. Sie müssen mit den ihnen nahen Menschen vorliebnehmen. Doch je älter die Menschen werden, desto größere Wahlmöglichkeiten haben sie, ob sie das durch Identifikation oder Teilidentifikation Erfahrene annehmen wollen oder nicht, und desto größere Auswahl haben sie bei den Identifikations-„Kandidat/innen”.
Und noch ein Hinweis: Manche Klient/innen verlieren sich in Identifikationen und verlieren ihre Meinhaftigkeit, andere sind nur eingeschränkt identifikationsfähig, was im extremen Fall mit einer Einschränkung oder gar dem Verlust des Mitgefühls einhergehen kann.
Der dritte Aspekt der Leibqualität der Ähnlichkeit besteht darin, dass Ähnlichkeit auch unser Verhalten prägt. Die Art und Weise, wie ein Mensch gewöhnlich vom Stuhl aufsteht oder Telefongespräche eröffnet, ist nie vollständig identisch, aber ähnlich. Den Gestaltkreis Viktor von Weizsäckers zitierend habe ich den Zusammenhang von Wahrnehmen und Bewegen beschrieben. Ähnlichkeit bezieht sich folglich nicht nur auf das Wahrnehmen, sondern auch darauf, wie Menschen sich in der Welt bewegen und verhalten. Die Ähnlichkeit des Verhaltens führt zu Gewohnheiten und zu Mustern, mit denen wir uns im Folgenden beschäftigen werden.