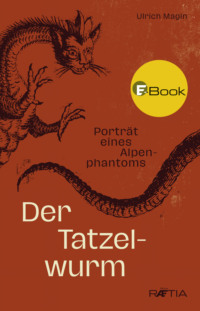Kitabı oku: «Der Tatzelwurm», sayfa 4
Vom Tatzelwurm verfolgt: erste Meldungen aus Österreich
Bislang haben wir vor allem die Ansichten der Gelehrten kennengelernt, nicht die der einfachen Leute, und die Meldungen stammten fast ausschließlich aus der Schweiz. Mitte des 18. Jahrhunderts meldet sich Österreich zu Wort, zunächst mit einer etwas fischigen Geschichte, dann mit einer der berühmtesten Darstellungen des Tatzelwurms. Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem der Eigenname des Tatzelwurms zum ersten Mal auftaucht, denn anders als in der Schweiz gilt die beobachtete Spezies nicht mehr allgemein als „Drache“.
Die erste Begegnung ergab sich bei einem frühen Rekordversuch, der aber gleich international Wellen schlug. So berichtete das britische „Gentleman’s Magazine“, eine damals monatlich in London erscheinende Zeitschrift, darüber. Am 22. Juli 1750 hatte sich nämlich ein Fischer in den Kopf gesetzt, in der Donau bei Linz in Oberösterreich zum tiefsten Punkt zu tauchen:
„Als er nach einiger Zeit nicht wieder hochkam, warfen seine Kameraden ihre Netze nach ihm aus. Nach vielen vergeblichen Versuchen brachten sie letztlich doch seinen Körper nach oben, von dem ein Arm und ein Bein sich in einem verrotteten Baumstamm verfangen hatten. Als sie daran gingen, den Körper aus den Maschen zu lösen, um ihn ins Boot zu legen, erblickten ihre Augen eine Schlange von gewaltigen Ausmaßen, die sich an seine linke Brust geheftet hatte. Sie erschraken darüber so sehr, dass sie aufschrien; da ließ das Ungeheuer von seiner Beute und warf sich, nachdem es sie in furchterregender Weise angezischt hatte, in den Fluss zurück.“73
Die zweite oben angesprochene Meldung betrifft die wohl berühmteste Darstellung des Tatzelwurms, nämlich auf einem Bildstock in Unken, einem Ort im Bundesland Salzburg, gleich an der Grenze zu Deutschland. Doch es gibt zwei Überlieferungen davon.
„Im gahen [jähen] Schrecken starb hier von Springwürmern verfolget Hans Fuchs aus Unken 1779.“ So steht es auf einem Marterl, einem Bildstock mit auf Holz gemaltem Bild zur Erinnerung an ein Unglück, das in jenem Jahr dort aufgestellt wurde. Auf dem Marterl sind zwei große Eidechsen mit glatter Haut und vier Beinen mit jeweils vier Zehen abgebildet, die riesigen Salamandern gleichen. Ihre Größe mag etwa zwei Meter betragen, und eines der beiden abgebildeten Exemplare wirkt fett und wohlgenährt. Diese Darstellung hat viele Tatzelwurmforscher veranlasst, sie als erstes wahrheitsgetreues Porträt des Alpendrachen zu betrachten, es verhält sich jedoch weniger eindeutig, als es zunächst scheint.
„Da das Bild die Jahreszahl 1779 trägt, muß es öfters schon erneuert worden sein, denn unmöglich konnte es 150 Jahre allem Wind und Wetter stand halten“, äußert sich der Südtiroler Tatzelwurmforscher Karl Meusburger 1931 etwas skeptisch.74 Anscheinend stand damals das Marterl noch, bis in die heutige Zeit hat es nicht überdauert, es existieren bloß zwei Abbildungen. Keine davon zeigt das Original, sondern beide wurden nur vorgeblich nach dem Original gezeichnet. Schon deshalb lässt sich heute nicht mehr feststellen, wie die Tatzelwürmer auf diesem Marterl wirklich aussahen. Die älteste erhaltene Darstellung ist eine „getreue Copie“, die der Revierförster Nero 1859 für das Buch „Wildanger“ des Münchner Mineralogen und Schriftstellers Ritter Franz von Kobell (1803–1882) anfertigte. „Also dürften wir in dieser Zeichnung die dem Originale am ehesten entsprechende Abbildung haben“, meint dazu der Tatzelwurmforscher Hans Flucher.75 Diese Abbildung wiederum wurde 1872 für eine Reproduktion in dem „Buch der Welt“ des Verlags Carl Hoffmann kopiert. Für dieses in wöchentlichen Lieferungen als illustriertes Unterhaltungsblatt erscheinende Buch hat der Kopist allerdings die Hintergrundlandschaft, das Aussehen der Ungeheuer und des dargestellten Mannes extrem stark verändert.76 Er trägt nun neueste Tiroler Tracht, liegt auf dem Rücken und nicht mehr mit Gesicht nach unten, und was die Würmer angeht, so stellt der Zoologe Otto Steinböck (1893–1969) ganz richtig fest:
„Auf beiden Tafeln sind je zwei Tatzelwürmer in ungefähr gleicher Stellung abgebildet; der eine in Seitenansicht, der andere in der Aufsicht. Der erstere ist in der alten Fassung am ehesten noch mit einem Hund zu vergleichen; jedenfalls ist der mit Ohren versehene Kopf (abgesehen von der dreispitzigen Zunge), die Stellung der Beine und der Schwanz säugerähnlich dargestellt. Ganz anders in der neuen Fassung; da ist der Kopf, allerdings ohne Ohren, schweineähnlich, die Stellung der Beine aber und der Schwanz lurchartig dargestellt. Der seitlich zusammengedrückte Schwanz würde auf einen Molch als Vorbild hinweisen.“77

1779 starb Hans Fuchs aus Unken von Springwürmern verfolgt. Auf dieser Variante des Marterls von Unken hält sich Fuchs des Giftes wegen die Nase zu. Abgebildet in Franz von Kobells „Wildanger“, 1859.

Die Version von 1872, abgebildet in dem „Buch der Welt“ des Verlags Carl Hoffmann, zeigt eine andere Leiche und zwei anders gestaltete Würmer.
Ob nun aber die Abzeichnung von 1859 das, was ursprünglich auf dem Bild zu sehen war, getreulich bewahrt oder selbst bereits stark veränderte, ist schwer zu sagen. Das Marterl zeigt kein Foto des Tatzelwurms, sondern, wie ebenfalls Steinböck feststellte, ganz einfach zwei ins Riesenhafte vergrößerte schwarze Alpensalamander. Man fragt sich ohnehin, wie ein Toter noch erzählt haben soll, was ihn zu Tode erschreckte? Es wird sich im Laufe dieser Darstellung noch öfter erweisen, dass zusätzliche Aussagen eher Unklarheit schaffen, als dass sie strittige Fragen einer bestimmten Sichtung zu klären vermögen!
Eine weitere Beobachtung erfolgte im Sommer 1781 bei Ebensee in Oberösterreich. Schon der Landshuter Botaniker Joseph August Schultes (1773–1831) erwähnt, so schreibt Franz von Kobell 1859 in seinem Buch „Wildanger“,
„von diesem Thiere gehört zu haben, als er im Jahre 1804 eine Excursion auf die Gletscher des Dachsteins machte, auch erzählte ihm der Wundarzt Wattmann zu Ebensee, daß ein Bauer, der am Rettelstein am Gemundersee auf Gemsen ausging, einen Lindwurm, eine Schlange von der Dicke eines dreijährigen Kindes geschossen habe. Der Beschreibung nach hielt Schultes das Thier für eine große Eidechse und Wattmann vernahm auf seinen Wunsch den Bauer um den näheren Vorgang. Dieser erzählte, daß er das Thier, welches sich ihm bergan, pfeifend, mit aufgesperrtem Rachen, doch etwas unentschlossen, näherte, im Sommer des Jahres 1781 erlegt habe. Es sey 5 Fuß [1,50 m] lang gewesen, von eidechsenförmiger Gestalt, der Kopf gleich dem einer Ziege (ohne Ohren), im Rachen viele scharfe spitze Zähne. Der Leib dick wie oben angegeben, mit einem starken schweren Schwanz und mit 4 Füßen, wovon die hinteren etwas länger gewesen. Die Farbe der Haut war bräunlichschwarz, am Bauche etwas weiß gefleckt, auch hatte es ¾ Zoll lange, aber sehr dünn stehende Haare, so daß zwischen jedem etwa ein fingerbreiter Abstand gewesen. Er hatte das Skelett 5 Jahre aufbewahrt, dann aber bis auf eine Rippe, die 7 Zoll lang war, weggeworfen. Wattman sah diese Rippe. Der Schütze war als ein gerader von jeder Prahlsucht freier Mann bekannt.“78
1796 datiert die allgemeine Beschreibung eines nun Birgstutzen genannten Tieres im Salzburgischen. Der Chronist Lorenz Hübner (1751–1807) erwähnt in seiner „Beschreibung des Erzstiftes und Reichsfürstenthums Salzburg“ die dort ansässige giftige Eidechse:
„Die grüne Eidechse (Lacerta agil. L. im Gebirge Hadachsel genannt), eine Art Lacerta seps L. [= Gifteidechse], welche aber noch nicht genau beschrieben, und im Gebirge unter dem Nahmen Birgstutzen bekannt und gefürchtet ist. Die Alpenbewohner erzählen von diesen Thieren allerhand Mährchen, welche vermuthlich größten Theils Kinder des Schreckens sind. Die Birgstutzen haben 4 kurze Füsse, und sollen beynahe die Dicke eines Armes und die Länge einer Elle haben, wenn die Furcht nicht jedes Maß vergrößerte. Man hält sie für sehr giftig, und sie sind, so viel man aus den sehr verschiedenen Beschreibungen abnehmen kann, ein Mittelding zwischen Eidechse und Schlange.“79
Nur vereinzelte Sichtungen: die anderen Alpenländer
Vereinzelt findet man Berichte auch aus den anderen Alpenländern. 1654 soll ein Gämsenjäger im französischen Jura auf einen mit Schuppen bedeckten Drachen mit dem Schwanz und Kopf einer Schlange oder eines Pferdes sowie vier 30 Zentimeter langen Beinen gestoßen sein.80 Die ersten Südtiroler Berichte datieren um das Jahr 1780. Der 1925 im Alter von 97 Jahren verstorbene Johann Gluderer erzählte den Leuten,
„daß sein Großvater, als er im Martelltale Schafe hütete, des öftern eine ‚Steinkatze‘ nicht bloß flüchtig gesehen, sondern auch genau beobachtet habe. Das Tier war von schmutziggrauer Farbe und hätte neben der Größe auch die Gestalt einer Katze gehabt, wenn nicht die Schnauze etwas verlängert gewesen wäre und der Schwanz eine flache Spitze gehabt hätte. Vorn waren zwei Tatzen sichtbar, die, wie die in die feuchte Erde eingedrückte Fährte zeigte, mit Krallen bewehrt waren. Mit Hilfe dieser Krallen konnte das Tier auch über Felsen klettern. Ging es langsam, bediente es sich nur dieser zwei Tatzen, und schleifte den Hinterleib nach. Beim Verfolgen einer Beute aber, sowie bei der Flucht bewegte es sich sprungweise, indem es den Rücken krümmte und sich so weiter schnellte. Bergab zog es die mehr seitlich stehenden Tatzen ein und schoß, den Boden kaum berührend, wie ein Pfeil dahin. Einmal sah unser Hirt, wie es einem jungen Hasen nachsetzte, ihn ergriff und damit im Gebüsch verschwand. Das Tier muß über sehr feine Sinnesorgane verfügt haben, denn trotzdem es nicht gerade scheu war, gelang es nie unbemerkt an dasselbe heranzukommen.“81
Das sind, man wundert sich, recht viele und sehr präzise Details aus dritter Hand! Bereits acht Jahre zuvor soll auf der Tarscher Alm ein Drache erlegt worden sein.82
Will man nun die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts vorherrschenden Merkmale des Tatzelwurms – so wie er sich bisher vor allem in der Schweiz, in Österreich und in nur wenigen anderen Alpengebieten gezeigt hat – zusammenfassen, so ist dieses Alpenphantom ein großes und ungewöhnliches, echsen- oder schlangenartiges Tier mit dem Kopf einer Katze oder eines Reptils und einer schwer zu bestimmenden, weil stetig anders geschilderten Zahl von Beinen. Es kann erschlagen werden, verfault aber rasch, es ist in jedem Fall giftig, trägt zuweilen eine Mähne oder einen Kamm, es pfeift und melkt die Kühe leer.
Die Eroberung des Alpenraums: die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts
Im 19. Jahrhundert werden so viele Sichtungen gemeldet, dass es sinnvoller ist, die Übersicht in zwei Teilen wiederzugeben, jeweils geografisch nach den heutigen Grenzen geordnet. Aus der ersten Jahrhunderthälfte liegen 40 Berichte vor: Spitzenreiter ist Österreich mit 15, danach kommt die Schweiz mit 12 Berichten. Deutschland mit zwei, Italien mit vier (davon zwei aus Südtirol) und Frankreich mit drei Meldungen spielen keine große Rolle.
Bergstutzen in Österreich
Interessant ist, dass sich der geografische Schwerpunkt Anfang des 19. Jahrhunderts von der Schweiz nach Österreich verlagert. Aus Österreich liegen nicht nur die meisten Sichtungsberichte, sondern auch die meisten allgemein beschreibenden Texte zu dem Tier vor, das nun durchgängig als Bergstutz oder Tatzelwurm bezeichnet wird. Um 1800 soll im Mölssee, auf 2.200 Metern über dem Meer im Wattental im Südosten von Innsbruck gelegen, ein Büchsenmacher aus Hall ein „Krokodil“ erschossen haben. In seinen Todeszuckungen biss es ihn in den Arm, der daraufhin teilweise gelähmt blieb. Dieses Krokodil brachten die Einheimischen jedoch nicht mit dem Tatzelwurm in Verbindung, sondern sie dachten, es sei aus dem Meer gekommen, mit dem der Mölssee über unterirdische Tunnel verbunden sei. Das berichtet – leider ohne Angabe einer Quelle – der Innsbrucker Luis Schönherr, der sich neben UFO- auch intensiv mit Tatzelwurmsichtungen beschäftigt hat.83
Eine der bekanntesten Darstellungen des Tatzelwurms als eine Art großschuppiger Fisch mit kleinen Pfoten stammt aus Georg von Schultes Beitrag „Etwas über den Bergstutz oder Stollwurm in den Alpen“ im „Neuen Taschenbuch für Natur-, Forst- und Jagdfreunde auf das Jahr 1836“.84 Es ist keine Fantasiezeichnung, sondern illustriert eine Sichtung. Ein alter Mann erzählte ihm, wie er in jungen Jahren am höchsten Berg in den Salzkammergut-Bergen, dem Gamsfeld in der Gosau, einen „Birgstutz“ erschlug. Das Tier sei hell silbergrau gewesen, hätte geglänzt und drei dunkle Längsflecken auf dem Rücken getragen. Der Leib sei mannesarmdick und rund 60 Zentimeter lang gewesen. Der Stutz hatte zudem

Georg von Schultes „Bergstutz oder Stollwurm in den Alpen“ von 1836 in einer Umzeichnung des Autors.
„kurze, wenig bemerkbare Füsse, konnte sich aber doch ziemlich behende fortbewegen. Gierig schlage ich nach dem Thier, ohne es Anfangs treffen zu können. Es flieht einer Felsenspalte zu, wird aber von mir eingeholt und als ich einen zweiten Streich führe, schnellt sichs an meinem Rock in die Höhe und ich fühle mich in die Hand gebissen, worauf es mir bald gelingt, das wüthende Thier umzubringen. Aber schon nach wenigen Augenblicken fühle ich einen glühenden Schmerz, ich eile nach Hause und da mir Arm und Hand mächtig anschwollen, lasse ich den Wundarzt rufen, welcher den Biss für giftig erklärt und zur Abnahme des Arms schreiten will. Doch konnte ich mich zu dieser gewaltsamen Operation nicht entschliessen, sondern liess die Heilung durch gelindere Mittel versuchen, welche auch nach mehreren Monaten, die ich unter den heftigsten Schmerzen zugebracht hatte, endlich gelang.“85
Doch nicht alle glaubten, dass es sich dabei tatsächlich um einen Tatzelwurm handelte, vielleicht wäre ja doch eine andere Erklärung plausibler. Der österreichische Schriftsteller, Diplomat und Forschungsreisende Josef Freiherr von Doblhoff (1844–1928) jedenfalls identifizierte das Tier als Natter.86 Und auch die „Allgemeine Literatur-Zeitung“ zeigte sich in ihrer Besprechung des Buches von Schulte kritisch:
„Dieses höchst wahrscheinlich fabelhafte Thier wird hier, nach den Sagen der Alpenbewohner nicht nur beschrieben, sondern auch abgebildet!!, was wenigstens einen Beweis für die lebhafte Phantasie des Vfs. liefert. Um dieses Thier in das naturhistorische System aufzunehmen, wird es jedoch einer bedeutenderen Autorität bedürfen, als der des alten Wirthes in der Gosau (worauf sich der Vf. vorzüglich beruft), welche Rec., gestützt auf persönliche Bekanntschaft, nicht hoch anschlagen kann.“87
Doch nicht alle waren damals bereits so skeptisch. Der Reiseführer „Der Badeort Gastein“ von 1842 schreibt über den Bergstutz:
„Er soll nach der Aussage mehrerer Augenzeugen 2 bis 3 Schuh lang sein, am Hinterteil abgestutzt, mit zwei längeren Vorderfüßen und scharfen Krallen versehen sein, einer Eidechse gleichen, die bei Annäherung des Menschen pfeifend, mit funkelndem Auge sich zur Wehr setzt und junge Lämmer und Ziegen mit unglaublicher Stärke anfällt.“88
Vielleicht erkannte man damals schon den Tatzelwurm als mögliche Touristenattraktion, denn im selben Jahr meint auch der deutsche Reiseschriftsteller und Bremer Stadtbibliothekar Johann Georg Kohl (1808–1878) in einem Reisebericht:
„Sehr verbreitet, besonders in Steiermark, ist z. B. der Aberglaube an den sogenannten ‚Bergstutzen‘. Dieser Stutzen soll eine Art Drache sein mit vier Füßen, mit einem Katzenkopf, mit einem langen dicken Schweif und mit giftigen Zähnen. Er greift die Menschen nicht von freien Stücken an; kommt man aber auf ihn zu, so beißt er, und der Gebissene muß sterben. Der Erzherzog Johann, der in allen Richtungen hin wohlthätig auf seine Aelpler einzuwirken sucht, hat einen Preis von 30 Ducaten auf die Erlegung und Einbringung eines solchen Stutzen ausgesetzt. Auch auf die Erlegung einer furchtbar großen Schlange, die in einem hohen Gebirgssee leben soll, hat er einen Preis gesetzt. Ich muß indeß sagen, ich glaube nicht, daß diese Preisaussetzung einen Einfluß auf die Veränderung des Aberglaubens haben wird. Denn selbst, wenn das Gespenst nicht erlegt wird, bleibt die Sache ganz unentschieden. […] Der Aberglaube von dem ‚Bergstutzen‘ soll auf die wirkliche Existenz einer in den Alpen vorkommenden Natter basirt sein.“89
Ob also Aberglaube oder nicht, einer Erwähnung in seinem Reisebericht war der Bergstutzen wert. Der „Forstverwalter i. Pens. C. Vogl“ berichtete dem Tatzelwurmforscher Josef von Doblhoff von einer Begegnung mit dem Wurm und fügte gleich ein paar Jagdtipps hinzu, wo man das Tier in der Steiermark antreffen könnte:
„Die meiste Aussicht, einen Tazzelwurm zu erhalten, ist in Obersteiermark, da ich dort am Lackenberg anno 1847 auf Geheiß meines vorgesetzten Districtsförsters Ramsauer einen solchen Tazzelwurm oder Birgstutzen über einen Stock, wo er aufrecht stand und ähnlich einer Gemse pfiff, mit dem Bergstock hinabschlug, dann aber im Himbeergesträuch nichts mehr weiteres sah. Dort wurden solche Thiere auch von den Senderinnen öfters wahrgenommen und als sehr gefährlich geschildert. Hier sind nur sehr vereinzelte Fälle in Fusch, Rauris und am Rettenstein bekannt und diese auch schon älteren Datums. Am sichersten werden solche Thiere in dem zerklüfteten Terrain vom Lackenberg, Griming etc. des Forstverwaltungsbezirkes Hinterberg zu treffen sein, d. h. sich erhalten haben. Nachdem ich nun in Ruhestand bin, [ist es meine Absicht,] mich eingehender mit solchen Leuten zu befassen, denen am ersten Gelegenheit geboten ist, um sie auch über Fang, Behandlung etc. zu informiren.“90
Die Anstrengungen des pensionierten Forstverwalters führten jedoch zu keinem Fang, zumindest wurde von keinem berichtet. Auch Hofoberforstrat i. R. Franz Rayl fing den Tatzelwurm nicht, obwohl er das für leicht möglich hielt. In einem Brief berichtete er 1900:
„Es war genau vor 51 Jahren, als ich im Gosauforste, am rechten Ufer des vorderen Gosausees, etwa ½ Stunde aufwärts beschäftigt war. Ich hatte vier Arbeiter an meiner Seite[, als] ich eines, mir ganz unbekannten Tieres gewahr wurde, welches mit dem Vorderteile unter dem Felsen lag, so daß ich nur den rückwärtigen Teil desselben sehen konnte. Dieser sichtbare Körperteil mag etwa 35 Zentimeter lang gewesen sein, wovon zirka die Hälfte auf den grausigen, an der Wurzel gewiß 6 Zentimeter und auf den am Stumpf abgestutzten Ende 3 Zentimeter starken, plumpen Schwanz entfielen. Zwei Füße, ähnlich der Eidechse, aber natürlich ungewöhnlich groß, lagen faul zur Seite des Körpers. Die Grundfarbe dieses ungewöhnlichen Tieres war schmutziggrau und spielte hin und wieder, aber nur ein wenig, in Braun und hatte über den Rücken bis zur Schwanzwurzel eine dunklere, ringförmige Färbung, so daß es aussah, als wären es Schuppen, die sich gegen den Schwanz zu verkleinerten. Ob der Körper mit kurzen Haaren besät war, konnte ich nicht ausnehmen, aber ich glaube, es war so.
Lange konnte ich dieses grausige Tier nicht beobachten, denn Abscheu und ängstliches Gefühl überkamen mich; ich sprang einige Schritte seitwärts, winkte den vier Arbeitern, zu mir zu kommen und sich diese Seltenheit zu besehen; aber auch diese, ansonst herzhaften und unerschrockenen Leute sprangen bei dem Anblicke dieses Wundertieres noch schneller zurück als ich und wir verließen dann die Arbeit der Probefläche gänzlich.
Es wäre ein leichtes gewesen, dieses Tier mittelst einer langen Holzgabel an den Boden festzuhalten, aber ich glaube, daß sich kaum jemand dazu herbeigelassen hätte, weil dies Angst und Schrecken vor einem solchen Tiere nicht zuließen.“91
Lindwürmer in der Schweiz
Der Berner Naturforscher Samuel Studer (1757–1834) ist ein weiterer Name in der großen Tradition früher Naturforscher der Schweiz. Der Metzgersohn schlug eine theologische Laufbahn ein, war erst Pfarrer von Büren, dann Professor für Theologie an der Berner Hohen Schule. Er interessierte sich für die Naturforschung, erfasste als Erster die Schweizer Schneckenarten, begründete die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft und die Naturforschende Gesellschaft in Bern mit und vertrat – noch vor Darwin – evolutionäre Gedanken. 1814 beschäftigte er sich mit Sichtungen großer Reptilien in der Schweiz:
„Von Unterseen weg bis einerseits auf die Grimsel, und andererseits bis gegen Gadmen hin, in einer Strecke von 10–12 Stunden, und unter Leuten die nichts von einander wissen, einander weder von Angesicht noch dem Namen nach kennen, und nur in dieser Gegend unsers [Landes, jedoch nicht] jenseits der südlichen Alpenkette in Italien oder dem Kanton Tessin, wo ich derselben Sache vergeblich nachgefragt habe, […] herrscht der beynahe allgemeine Glaube, daß zuweilen nach einer schwülen Hitze, und wenn sich das Wetter bald zu ändern droht, sich eine Art von Schlangen mit ganz kurzen Füssen sehen lasse, welche die Einwohner, denen eine Schlange überhaupt ein Wurm, und ein kurzer dicker Fuß ein Stollen ist, daher auch Stollenwürmer heißen. […] Mehrere Personen aus jenen Gegenden, die ich […] näher über dieselben befragte, kamen darinn überein, daß es kurze und sehr dicke Schlangen seyn sollen, mit einem fast runden Kopf, ungefähr wie ein Katzenkopf, und mit kurzen Stollfüßen. Ueber die Zahl […] waren sie indessen nicht immer einig, doch sprachen die Glaubwürdigsten, und die sich zugleich für Autopten oder Augenzeugen solcher Thiere ausgaben, stets nur von zwey, andere aber von vier, noch andere von sechs Füßen, und endlich einige sogar von einer ganzen Menge von dem Bauch herunter hängender Zizen oder Warzen auf welchen sich der Wurm, wie auf so viel kurzen Füßen fortbewegt habe. Ueber die Länge des Thiers stimmten sie auch nicht immer zusammen überein, so wenig als über seine Dicke oder Stärke. Jene geben sie von ungefähr 3 bis 6 Fuß an, und diese vergleichen sie bald mit dem Arm und bald mit dem Schenkel eines starken Mannes. Man muß aber bemerken, dass sie auch junge und alte Stollenwürmer von einander unterscheiden.“
Er kenne viele Augenzeugen, „die mich auf das Heiligste versicherten, selbst solche Stollenwürmer gesehen und wohl gar getödtet zu haben“92.

Der Berner Naturforscher Samuel Studer vermutete 1814 den Stollenwurm in der Umgebung des Grimsel. Das Foto zeigt den Blick auf den Grimselsee, das Grimsel-Hospiz und den Räterichsbodensee.
„An einem sehr heißen Maymorgen im Jahr 1811 sagte er [der Grimsel-Spitalmeister Jakob Leuthold] zu dem Schulmeister Heinr. im Dorf, der ihm daselbst die Schafe hüten half, er solle doch hingehen und sehen, ob diese sich im Gaden [Scheune] an dem Schatten befänden? Der Schulmeister ging hin, trat vor die Thür, durch welche die Sonne hell und warm an die gegenüberstehende Wand schien. Hier blickte er nun mit nicht geringem Entsetzen unter einem an der Wand angebrachten Barnen (Krippe) einen scheußlichen Stollenwurm, dessen ganze Länge kaum ein Klafter, die Dicke aber mehr als eines Mannes Schenkel betragen mochte. Das Thier stellte sich auf seine zwey, etwa 5 Zoll langen und eines starken Mannsfingers dicken Stollfüße, hob seinen Kopf, der wohl zwey Hände breit, kurz und dick war, etwa einen Schuh von der Erde in die Höhe, blickte den erstaunten Schulmeister mit Augen, die von der Größe waren, wie sie eine grosse Henne hat, an, züngelte eine zweygespaltene Zunge heraus und stellte seine Füße wohl bei 1 ½ Fuss weit auseinander. Einen eigentlichen Hals hatte es nicht, eher stand der Körper zwischen dem Kopf und Hals etwas auswärts und war daselbst am dicksten. Sonst war der Kopf wie ein anderer Schlangenkopf, nur breiter, flacher und ohne aufgeworfene Nase. Oben über den Rücken war der Wurm mit kurzen dünnen Haaren, wie mit Pflaum bekleidet, die aber keinen Kamm bilden. Nach einer kurzen gegenseitigen Betrachtung (der Schulmeister sagte etwa zweymal das Vaterunser lang, während welcher Zeit er ihn genau habe betrachten können) kam der Grausen in den Mann und er stellte thöricht draus, soweit ihn seine Füsse tragen mochten.“93

Unter Verwendung einer Vorlage, die eine Handwühle (Bipes) zeigt, fertigte Studer 1814 diese Fantasiedarstellung des Tatzelwurms.
Studer verglich sein Material mit dem Drachenkapitel von Scheuchzer und stellte viele Übereinstimmungen fest: 1) der Katzenkopf, 2) die große Dicke bei einer Länge von 6 bis 7 Fuß [1,80 bis 2,10 m], 3) die kurzen Füße, 4) die Farbe sowie 5) „in dem haarichten Ueberzug“94. Studer schloss daraus, dass es sich beim Stollenwurm um eine noch unentdeckte Form von Molch oder Kriechtier handelte.
Studer gab seinem Aufsatz den Stich eines Stollenwurms bei, der ein eigentümliches Nachleben führte. Der Stich selbst ist die spiegelverkehrte Wiedergabe der Abbildung einer Handwühle, eines Reptils aus Mexiko, aus der Naturgeschichte des französischen Gelehrten Bernard Germain Étienne de Lacépède (1756–1825), die 1788 in Paris erschien. Offenbar hielt Studer den Stollenwurm für eine solche Wühlart.
Bernard Heuvelmans (1916–2001), der Begründer der modernen Kryptozoologie, erhielt wiederum einen Brief mit einer groben Skizze nach Studers Bild, die stark verfälschend war und angeblich aus einem Almanach, den „Alpenrosen“ des Jahres 1841, stammte. Dieses Bild geistert als Augenzeugenskizze durch einschlägige Veröffentlichungen und ist doch nicht mehr als die Kopie einer Kopie eines Bildes, das keinen Tatzelwurm zeigt! Das Jahr 1841 ist wohl ein Zahlendreher von Studers Publikation von 1814; geduldige Recherchen des französischen Kryptozoologen Michel Raynal haben die ganze Verwirrung erst 2019 aufgedeckt.95

Studers Vorlage war ein Stich des französischen Forschers Bernard Germain Étienne de Lacépède von 1788.

So bildete der Kryptozoologe Bernard Heuvelmans den Tatzelwurm ab – angeblich nach einer Vorlage aus der Zeitschrift „Alpenrosen“ von 1841.
Studers These vom noch unentdeckten Alpentier fand Zustimmung: „Hier müßen wir auch der, in vielen Gegenden dieser Region ziemlich allgemein verbreiteten Sage erwähnen“, so der Schweizer Zoologe Heinrich Rudolf Schinz (1777–1861) 1815 in seinem „Die Vögel der Schweiz“,
„die sogar von feynwollenden Augenzeugen hie und da bekräftiget wird, daß es hier eine Art von großen, schwarzen, eidechsenartigen Reptilien mit zwey kurzen Füßen gebe, der man im Berner Oberland den Namen des Stollenwurms beylegt. Wenn gleich die übrigens ziemlich übereinstimmenden Nachrichten, die wir hierüber gesammelt haben, etwas abentheuerlich klingen und an die alten Fabeln vom Drachen und Lindwurm erinnern, so verdienen sie dennoch die Aufmerksamkeit der Naturforscher und können vielleicht zur Entdeckung einer noch unbekannten Eidechsen- oder Schlangenart führen.“96
1817 stellte der Schweizer Dichter und Philosoph Johann Rudolf Wyss (1781–1830) in seiner „Reise in das Berner Oberland“ nach einem kurzen Exkurs zu mythischen Lindwürmern etwas skeptischer fest:
„Während aber die Drachen in der jetzigen Schweiz als ausgestorben oder vertilgt betrachtet werden, ist das Oberland noch voll von Sagen und Zeugnissen über ein schlangenartiges Unthier, welches mit dem einheimischen Namen des Stollenwurms bezeichnet, und nach unverdächtigen Zeugnissen vieler Landleute fast jährlich hier oder dort gesehen wird. Man beschreibt dieses Wesen als eine Art von Schlange, die ganz kurze Füßchen habe; und da die Schlangen überhaupt Würmer heißen, ein kurzer dicker Fuß aber ein Stollen genannt wird, so entstand der besondere Name für dieses Geschöpf. Fast durchgängig giebt man ihm einen runden Katzenkopf, und bald 2, bald 4, bald mehrere Füße, nach der Art, wie die Raupen sie haben. Mitunter schildert man es als behaart, und gewöhnlich als verhältnißmäßig dick aber kurz. Ich wage jedoch keineswegs die Eigenthümlichkeit dieses Geschöpfes als erwiesen anzunehmen.“97
Wyss führt mehrere verbürgte Begegnungen an, bei denen Stollen- und Haselwürmer mittels Magie erlegt wurden, und meint aus eigener Anschauung, der typische Almwirt wisse fast nichts von Tieren, die keine Nutztiere seien.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.