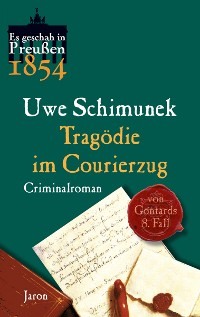Kitabı oku: «Tragödie im Courierzug», sayfa 2
Zwei
13. Januar, 12 Uhr mittags
Ferdinand von Gontard lief den Flur der Kommandantur des Grenadierregiments König Friedrich Wilhelm II. Nr. 10, genannt 1. Schlesisches, hinunter. Der Gang flößte ihm Respekt ein. Oft kam er als kleiner Lieutenant nicht in diesen Teil der Kasernenanlage, und wenn es jemanden aus dem Fußvolk hierher verschlug, dann drohte nicht selten Ärger.
Wen Ferdinand von seinen Vorgesetzten auch ansprach wegen des Leichenfundes, alle wimmelten ihn ab und verwiesen auf den Kommandeur des 1. Bataillons, Generalmajor Meinrad von Frohwitz. Bei dem liefen alle Fäden der Garnison in Breslau zusammen, er war nur noch dem Kommandeur des gesamten Grenadierregiments, von Kortzfleisch, unterstellt. Also blieb Ferdinand nichts anderes übrig, er musste zum »Alten«, wie Frohwitz in der gesamten Garnison genannt wurde. Wer immer über den Bataillonskommandeur redete, sprach dessen Spitznamen mit einer Mischung aus Spott und Ehrfurcht aus. Frohwitz’ offensichtlicher Gebrechlichkeit bei Appellen stand sein scharfer Verstand gegenüber. Altgediente Offiziere behaupteten gar, Frohwitz könne Gedanken lesen. Das hielt Ferdinand zwar für übertrieben, aber es war auch ihm in den wenigen Begegnungen mit Frohwitz bisher schwergefallen, dessen durchdringendem Blick standzuhalten.
Im ersten Stock hingen die Porträts verdienter Offiziere der Garnison. Die Uniformen auf den Gemälden waren über und über mit Orden, Ehrenzeichen und Kordeln besetzt. Da erzählten die alten Offiziere immer etwas von Blut und Treue, und dann behängten sie sich mit opulentem Glitzerkram wie Weiber. Ferdinand dachte an seinen Vater, der sich über die hohen Offiziere und deren pompöse Abbildungen stets lustig machte. An dieser Galerie hätte er seine helle Freude gehabt. Ferdinand dagegen bekam bei jedem weiteren ernsten Gesichtsausdruck ein mulmigeres Gefühl.
Am Ende der Galerie bog der Gang zu Frohwitz’ Dienstzimmer ab. An der Ecke saß ein Corporal und gähnte.
»Ich möchte zu Herrn Generalmajor von Frohwitz, um eine Meldung zu machen«, sagte Ferdinand.
»Geht nicht«, nuschelte der Mann.
Ferdinand zögerte einen Augenblick. Vor ihm saß zwar lediglich ein Corporal, dem eine solch unhöfliche Rede einem Lieutenant gegenüber nicht zustand, aber immerhin handelte es sich um den Diensthabenden vor dem Zimmer des Bataillonskommandeurs. Zudem war der Kerl bestimmt zehn Jahre älter als Ferdinand. Wie würde sein Vater, der Oberst-Lieutenant von Gontard, sich in dieser Situation verhalten? Zumindest würde er sicher nicht vor einem Corporal kuschen.
»Ich habe etwas Wichtiges zu melden, Herr Corporal.« Ferdinands Stimme wurde mit jedem Wort fester. »Und reden Sie gefälligst in vollständigen Sätzen mit mir!«
Der Corporal guckte wie ein Saufkumpan kurz vor einer Kneipenschlägerei. Wenigstens gähnte er nicht mehr, sondern sagte laut: »Ich habe meine Befehle, Herr Lieutenant. Der Generalmajor möchte nicht gestört werden.«
»Was ist denn das für ein Gebrüll?«, hallte es aus dem Gang.
Ferdinand erkannte die Stimme des Kommandeurs. Der Alte klang müde, so als habe er gerade ein Vormittagsschläfchen beendet. Frohwitz näherte sich mit gemessenen Schritten – oder schlurfte er?
Der Corporal sprang auf und zeigte auf Ferdinand. »Der junge Lieutenant missachtet Ihre Befehle, Herr Generalmajor!«
»Mit Verlaub, ich habe eine wichtige Meldung zu machen.« Ferdinand wandte sich direkt dem Alten zu. »Ich habe nur versucht, das dem Corporal zu vermitteln.«
»Hm.« Der Alte schaute Ferdinand eindringlich an. Da war er wieder, dieser forschende Blick. Nach einem Moment fuhr der Kommandeur fort: »Dann kommen Sie doch mit, Herr Lieutenant!« Frohwitz trottete gen Dienstzimmer, und Ferdinand folgte ihm.
Der Corporal hätte mit seinem Blick das Fegefeuer einfrieren können. Ferdinand genoss den Erfolg.
Im Dienstzimmer setzte sich der Kommandeur hinter einen barocken Secretär und sagte: »Sie müssen dem Corporal sein ungehobeltes Verhalten verzeihen. Wenn die Diensthabenden nicht so abweisend wären, fände ich nie Ruhe.«
Ferdinand merkte, wie seine Kinnlade herunterklappte. Grinste der Alte ihn an?
»Nun, mein junger Herr Lieutenant, ich habe gehört, Sie haben interessante Neuigkeiten.«
Wusste der Alte schon Bescheid? Und wenn ja, woher?
»Berichten Sie!«
»Ich habe an der Oderwiese eine Leiche entdeckt.«
»Das ist mir bekannt, Herr Lieutenant.«
Also tatsächlich … Ferdinand wusste nicht, was er dem Kommandeur noch berichten sollte. Er sagte: »Ich bin nicht sicher, ob ich die Zivilbehörden unterrichten soll. Ich habe meinen direkten Vorgesetzten bereits über den Fund informiert, aber keine klare Anweisung erhalten.«
Frohwitz hob einen Brieföffner vom Schreibtisch und richtete die Klinge auf Ferdinand. »Haben Sie bei der Leiche Hinweise auf eine Zugehörigkeit zur Armee Seiner Majestät gefunden?«
»Nein, Herr Generalmajor. Wobei die Kleidung kaum noch zu erkennen war. Einen Helm habe ich jedenfalls nicht entdeckt.«
Der Kommandeur tippte mit der Spitze des Brieföffners gegen den Zeigefinger seiner linken Hand. »Bei einem toten Zivilisten gäbe es keinen Zweifel, den würden wir den Zivilbehörden überlassen. Bei einem Armee-Angehörigen würden wir uns hingegen der Sache annehmen …«
»Ich kann Ihnen dahingehend leider keine zuverlässige Auskunft geben.«
Frohwitz legte den Brieföffner zurück auf die Tischplatte und schaute auf wie ein Großvater vom Märchenbuch. »Ihrem Vater eilt der Ruf voraus, solchen Fällen selbst auf den Grund zu gehen. Sie haben keine derartigen Ambitionen?«
»Sie meinen …«
»Ich würde sagen, Sie melden sich am Nachmittag wieder bei mir, Herr Lieutenant, und dann sehen wir, welche Informationen Sie zusammengetragen haben. Bis dahin behandeln wir die Sache vertraulich.«
Christian Philipp von Gontard lief die Linden entlang. Um genau zu sein, drängte er sich durch das Gewimmel – zwischen den Waschweibern mit ihren Körben hindurch, vorbei an Lumpensammlern, Bürgersleuten und Landeiern, die auf der Suche nach Halt in der großen Stadt waren. Alle paar Schritte bot ein Kolporteur brüllend seine Ware feil. Und das war nur das Fußvolk, das sich die Straße mit den Kutschen, Reitern und Pferdeomnibussen teilen musste. Gontard kam es so vor, als ob der Verkehr im Herzen der Residenzstadt immer dichter würde. Die Menschen schienen kaum zum Luftholen zu kommen vor lauter Eile. Wurde er einfach zu alt für diesen Trubel?
An der Friedrichstraße hatte sich ein Menschenauflauf gebildet. Ein fliegender Händler pries eine Zeitschrift an: Die Gartenlaube. Vor allem einfaches Volk umringte den Kolporteur und riss ihm die Blätter förmlich aus der Hand. Gontard kannte Die Gartenlaube von der Küchenmamsell. Die hatte das illustrierte Familienblatt im vergangenen Jahr erstmals mitgebracht und in jeder freien Minute darin geschmökert. Inzwischen kaufte sogar Gontards Frau Henriette gelegentlich die Zeitschrift. Er selbst hatte einzelne Artikel überflogen und für harmlos befunden. Sollten die Frauen ihren Spaß haben. Wenn ihm die vielen Käufer nur nicht den Weg versperrten! »Platz da!«, rief er.
Tatsächlich versuchten einige der Mamsellen, zur Seite auszuweichen. Nur war da kein Platz. Die Frauen zeterten wie aufgescheuchte Hühner. Doch als sie zu Gontard glotzten, riefen sie eilig Entschuldigungen.
Gontard lief einen großen Bogen um den Pulk und trat auf die Friedrichstraße. Hier bewegten sich die Fuhrwerke im Schritttempo durch das Gedränge. Auf der anderen Straßenseite sah es kaum besser aus. Erst in Richtung der Dorotheenstraße wurde die Menge lichter. Zum Glück war das sein Weg. Gontard legte einen finsteren Blick auf, und tatsächlich machten ein paar arme Schlucker Platz. Mit jedem Schritt kam er leichter voran. Nach ein paar Metern achtete er gar auf einzelne Gesichter in der Masse. War das nicht … Oje!
»Herr Oberst-Lieutenant, was für ein schöner Zufall!« Criminal-Commissarius Waldemar Werpel kam ihm entgegen und war so gut gelaunt, als sei er auf dem Weg zu seiner Beförderung.
»Herr Criminal-Commissarius, ich bin etwas in Eile«, flunkerte Gontard. Eigentlich war es egal, ob er in fünf, zehn oder zwanzig Minuten zum Mittagessen in seinem Haus um die Ecke ankam.
»Ach, ich dachte, Sie wollen vielleicht etwas über die aktuellen Criminalfälle hören …« Werpels Grinsen wurde immer breiter.
»Gibt es etwas zu berichten?«, fragte Gontard und fand, dass er eine Spur zu interessiert klang.
»Gestern stand der Tagelöhner Helm vor Gericht und wurde verurteilt.«
Gontard kannte die Geschichte aus der Gerichts-Zeitung. Der Arbeiter hatte einen Kollegen erstochen, ein anderer Arbeitskamerad hatte danebengestanden und alles bezeugen können. Die Tat war vor ein paar Monaten geschehen, gar nicht weit von hier, in der Großen Friedrichstraße No. 219. Im Hof des Geheimen Justizraths Bode hatten die drei Tagelöhner Holz geschlagen, als es zu dem Streit gekommen war. Da hatte es nicht viel zu ermitteln gegeben.
»Stellen Sie sich vor, Herr Oberst-Lieutenant, der Kerl hat noch in der Verhandlung das Unschuldslamm gespielt, obwohl er längst überführt war!« Werpel stemmte seinen rechten Arm in die Seite.
Gontard fiel auf, dass der Polizist immer dicker wurde – noch ein paar Pfund mehr, und er würde den Arm strecken müssen, um bis zum Gürtel zu gelangen. »Wie hat dieser Helm denn versucht, sich aus der Sache herauszuwinden?«, fragte Gontard. »Der Fall lag doch ziemlich klar.«
»Der Beschuldigte hat angegeben, vom Opfer und dem Zeugen angegriffen worden zu sein und in Notwehr gehandelt zu haben.« Werpel hob die Hand und fuchtelte mit dem Zeigefinger herum. »Doch von seiner Aussage kurz nach der Tat ist ein genaues Protokoll vorhanden. Im Verhör hatte Helm mir gegenüber zugegeben, dem Opfer zugerufen zu haben: ›Siehst du, Schweinehund, das geschieht dir recht!‹ In der Verhandlung hat er davon nichts mehr wissen wollen und sich als Unschuldslamm gegeben.«
Eine solche Wandlung kannte Gontard nur zu gut. In der Zelle hatten selbst die übelsten Gesellen genug Zeit, nach einer Ausrede zu suchen.
»Der Richter hat sich von dem Burschen nicht blenden lassen. Fünf Jahre darf der Kerl hinter Gittern schmoren.« Werpels Brust schwoll vor Stolz. Das machte allem Anschein nach sogar Eindruck auf die Passanten. Sie strömten herbei und ließen dabei einen ehrfürchtigen Abstand zu Gontard und Werpel von bestimmt einer halben Elle.
Gontard fand das Gehabe des Commissarius übertrieben. Der hatte lediglich einen Hitzkopf seiner gerechten Strafe zugeführt. Gontard dachte an die Criminalfälle, die er selbst in den vergangenen Jahren gelöst hatte. Bei den Tätern hatte es sich um ganz andere Kaliber gehandelt, Verbrecher, die nicht einfach vor Zeugen zustachen und sich alsbald von herbeigerufenen Polizisten in die Vogtei abführen ließen. In diesen Fällen hatte der Commissarius selten eine so selbstgefällige Miene aufgesetzt wie jetzt. Werpel übte sich bei kniffligen Angelegenheiten eher in der Kunst des Im-Weg-Stehens.
»Und Sie, Herr Oberst-Lieutenant, ermitteln Sie derzeit in einem Criminalfall?«, fragte Werpel gut gelaunt.
»Ach, Herr Commissarius«, antwortete Gontard, »ich habe derzeit viel zu tun. Seit mein neuer Bursche krank daniederliegt, merke ich, dass mir der Strohkopf bei allem Ärger doch das Leben erleichtert hat. Selbst wenn ich über eine Leiche stolpern würde, bliebe mir keine Zeit für Ermittlungen. Vermutlich würde ich mich einfach an Sie wenden.«
Die Küchenmamsell wuchtete den Suppentopf auf den Tisch in der Essküche. Sie verteilte die Portionen: eine Kelle für Henriette von Gontard, eine halbe für Luise, die Tochter des Hauses, und drei für Gontard. Es roch nach Kartoffeln, und Gontard verspürte Hunger.
Die Mamsell verließ die Küche. Henriette faltete die Hände zum Gebet. Gontard tat es seiner Frau gleich und blickte zu Luise. Die war mit ihren siebzehn Jahren eine junge Frau geworden. Gontard staunte beinahe jeden Tag über seine herangewachsene Tochter. Er wunderte sich nicht nur über die rundlichen Formen seiner Kleinen, noch mehr verwirrten ihn die erwachsenen Gesichtszüge Luises. In ihrem Antlitz zeichnete sich durchaus Anmut ab, aber für Gontards Geschmack hätte seine Tochter öfter lächeln dürfen.
Nach einem kurzen Nicken von Henriette sprach Gontard das Tischgebet, dann aßen alle. Gontards Hunger schien eigentümlicherweise mit jedem Löffel größer zu werden. Er zwang sich, die Suppe nicht hinunterzuschlingen, und blickte zu seiner Frau.
Vielleicht deutete Henriette das als Aufforderung, etwas zu sagen. »Es sind milde Tage«, stellte sie fest.
Luise nickte so ernsthaft, als sei sie in einer Behörde für Wetterangelegenheiten beschäftigt.
Gontard löffelte die Suppe. Draußen auf der Straße lag kein Schnee, aber immer wenn er ins Haus kam, war er doch froh über die wohlige Wärme des Heimes. In der Küche reichte der Herd sogar, ihn ins Schwitzen zu bringen. Gontard öffnete einen Knopf seiner Uniformjacke. Die Blicke von Frau und Tochter ruhten auf ihm. Er hielt das Wetter nicht für ein passendes Gesprächsthema, insbesondere wenn es nur um den Austausch von Belanglosigkeiten ging. Mit Schweigen würde er jedoch allem Anschein nach nicht davonkommen. Also erwiderte er: »Wenn ich den Himmel anschaue und den Wind bedenke, steht wohl Kälte bevor.« Damit schien alles gesagt. Sie aßen schweigend weiter. Mit jeder Minute erschien Gontard die Stille drückender. Noch vor einer halben Stunde hatte ihm die Hektik Unter den Linden fast die Nerven geraubt, und nun ertrug er die Ruhe nicht.
Luise hatte ihre Mahlzeit bereits beendet und legte den Löffel zur Seite.
Gontard überlegte, ob das Mädchen genug aß, war aber dann sicher, dass Henriette sich um so etwas kümmerte.
»Hast du nach dem Mahl noch Zeit, das neue Klavierstück anzuhören, das deine Tochter gerade lernt?«, fragte Henriette und schob dabei ihren leeren Teller beiseite.
»Selbstverständlich. Was spielst du gerade, Luise?«
Die Tochter schluckte.
»Sie übt am ersten Satz der Schumann’schen Phantasie. Ich finde, sie macht das ganz bezaubernd.«
Gontard teilte Henriettes Enthusiasmus für Luises Klavierspiel nur selten. Eine Clara Schumann würde sie wohl nicht werden. Allerdings spielte sie gut genug, um später in der eigenen Familie zu feierlichen Anlässen ein Ständchen zu geben. Das war zu begrüßen, wie er fand, auch wenn die Kleine sich für seinen Geschmack mit der Familiengründung noch ein paar Jahre Zeit lassen konnte.
»Sie hat mich heute Morgen ganz vorzüglich mit ihrem Spiel unterhalten«, fuhr Henriette fort.
Luise hob den Kopf, als wolle sie etwas sagen, hielt die Worte aber zurück.
»Auch die schwierigen Phrasen in d-Moll klingen nun gut. Ich bin so stolz auf unsere kleine Pianistin.«
»Mutter, bitte!«, zischte Luise.
Henriette zuckte zusammen und schaute zu ihrer Tochter. Plötzlich sah sie müde aus und alt. Sie drehte den Kopf und blickte fragend zu Gontard. Sekunden verronnen. »Luise, kannst du mir bitte erklären, was das soll?«, fragte Henriette, ohne ihren Kopf zu wenden.
»Entschuldige bitte. Es ist doch nur …« Luise vollendete den Satz nicht.
»Ich weiß manchmal nicht, was mit ihr los ist«, sagte Henriette.
Vermutlich sollte Gontard als Familienvorstand jetzt eingreifen und ein Machtwort sprechen. Doch zum einen fiel ihm nichts ein, was er hätte sagen können, und zum anderen wusste er nicht einmal, an wen er seine Worte hätte richten sollen. Worum ging es hier überhaupt? Luise sprach schon seit Jahren nicht allzu viel mit ihm. Gontard fragte seine Tochter gelegentlich nach ihrem Befinden, und sie erklärte in hübscher Regelmäßigkeit, ihr gehe es ausgezeichnet. Henriette hatte bislang nicht von Sorgen berichtet, was ihre Tochter anging, deshalb beließ Gontard es beim Schweigen.
»Mutter, ich bitte noch einmal um Verzeihung, aber ich fühle mich noch nicht so weit, die Phantasie jemandem vorzuspielen.«
War er denn ein Fremder?, fragte sich Gontard.
Henriette sah ihn unentwegt an, als erwarte sie etwas von ihm. Auch Luises Blick wanderte von der Mutter zu ihm.
»Lass das Mädchen doch!«, sagte Gontard.
Das schien nicht der rechte Satz gewesen zu sein. Sowohl Henriette als auch Luise runzelten die Stirn. Dabei sahen sie einander so ähnlich, dass Gontard beinahe lachen musste.
Drei
13. Januar, ½ 3 Uhr nachmittags
Hier muss es doch irgendeinen Hinweis geben«, sagte Ferdinand von Gontard.
»Ick kann hier überhaupt nix erkennen.«
Der Leichnam lag nach einer halben Stunde Buddelei weitgehend frei. Doch noch immer ließen sich keine Details ausmachen. Freilich handelte es sich um eine ordentliche Sauerei. Die Maden hatten im vergangenen feuchten Herbst ganze Arbeit geleistet. Von dem Mann, der vor ihnen ruhte, konnten sie sich kaum ein Bild machen. Die Stofffetzen der Hose mochten von einer Uniform stammen, am Oberkörper hatte der Tote vielleicht ein grobes Hemd getragen. Zumindest eines stand fest: Wenn er einen Waffenrock sein Eigen genannt hatte, musste er diesen vor seinem Tod abgelegt haben. Von einer Pickelhaube gab es ebenfalls nach wie vor keine Spur.
»Vielleicht kieken wa mal drum rum«, schlug Quappe vor.
»Das ist keine schlechte Idee.« Ferdinand stapfte los. Mit jedem Schritt versank er tiefer im Schnee. Das Gehölz endete an der flussabgewandten Seite an einem Waldstück. Zwischen den Buchen wucherten im Sommer bestimmt die Farne, jetzt ragten die Bäume kahl aus dem glatten Weiß. Bis zu den ersten Buchen ging es leicht bergan.
»Scheiße!«, brüllte Quappe. Der Bursche war bis zur Hüfte in einer Schneewehe versunken. Er wühlte sich aus dem Loch und jaulte dabei wie ein Köter unter der Knute. »Ick gloob, mein Fuß fällt ab.«
Ferdinand reichte Quappe die Hand, zog ihn hoch und wies mit einem Nicken nach rechts. »Da vorn liegt ein Baumstamm, dort können Sie sich hinsetzen.«
Der Stallbursche legte Ferdinand die Hand über die Schulter. Gemeinsam bewältigten sie so den Weg zum Baumstamm. Ferdinand kam sich vor wie ein Soldat, der einen Verwundeten vom Schlachtfeld schleppte. Hoffentlich hatte Quappe sich nicht das Bein gebrochen.
»Aua! Verdammta Mist!«, jammerte Quappe. Er saß auf dem Stamm und zerrte an seinem Stiefel.
Ferdinand überlegte schon, ob er Quappe aus dem Schuhwerk helfen sollte. Doch der bekam den Fuß glücklicherweise allein frei. Unter den groben Lappen, die Quappe als Fußwickel benutzte, wurde eine ordentliche Schwellung sichtbar. »Legen Sie doch ein bisschen Schnee auf den Knöchel, Quappe! Das kühlt.«
Mit einem Wimmern bückte Quappe sich und pappte Klumpen für Klumpen Schnee auf seinen Fuß, bis dieser nicht mehr zu sehen war. Er drückte die weiße Masse fest und nörgelte: »Ick werd mir bestimmt erkälten.«
»Später, Quappe«, sagte Ferdinand. »Vorerst bleiben Sie hier sitzen! Und ich schaue mich noch mal im Dickicht um.«
»Sein Se vorsichtig!«
Ferdinand lachte und hob die Hand zu einem militärischen Gruß. Für den Weg zurück zum Gestrüpp nutzte er die bereits in den Schnee gedrückten Spuren. Als er den verletzten Quappe zum Stamm geschleppt hatte, war ein richtiger Pfad entstanden. Am Rande der Hecke untersuchte Ferdinand die Wehe näher, in der Quappe versunken war. Mit festen Stiefeltritten stieß er den Schnee beiseite. Darunter verbargen sich eine Kuhle oder ein Graben. Der Boden war braun und hart. Der Schnee stob unter Ferdinands Tritten in alle Richtungen. Jetzt erkannte Ferdinand, dass weder Kuhle noch Graben zu seinen Füßen lagen, sondern eher eine Art Trampelpfad.
Der Pfad führte in das Gestrüpp. Ferdinand kämpfte sich vorwärts. Vorsichtshalber schob er den Schnee vor jedem Schritt beiseite. In seinem Rücken jammerte Quappe schon wieder herum, und zumindest einer sollte gut zu Fuß bleiben. Nach ein paar Schritten gabelte sich der Pfad: Nach rechts führte er in den Wald hinauf, links teilte er die Sträucher. War der Mann an dieser Stelle ins Gebüsch gelangt? Ferdinand folgte dem Pfad ins Innere des Gestrüpps. Nach drei Schritten musste er sich bücken, da die Äste im Wipfel ineinandersteckten und eine Art Dach bildeten.
»Is allet jut bei Ihnen?«
»Ja!«, rief Ferdinand über die Schulter. »Von hier hinten müsste ich an die Leiche herankommen.«
»Sein Se achtsam!« Quappe wimmerte ohne Unterlass.
»Ja, ja.« So kurz vor dem Ziel hatte Ferdinand keine Zeit für die Sorgen des Stallburschen. Er brach ein paar nach unten ragende Äste ab und quetschte sich weiter durch das Gestrüpp. Drei Fuß vor der Fundstelle häufte sich Schnee an einem Strauch. Für ein bisschen Laub darunter war der Batzen zu groß. Ferdinand trat vorsichtig gegen den Schnee. Grobes Gewebe kam zum Vorschein. Ein Kleidungsstück? Ferdinand bückte sich und zog vorsichtig an dem Stoff. Der steckte fest. Als Ferdinand kräftiger zerrte, riss das Gewebe, und er hielt einen Fetzen in der Hand. Der Lappen war lehmbraun und augenscheinlich vermodert, bevor der Frost ihn unter dem Laub eingefroren hatte. Nun zerfiel das Textil bei der geringsten Beanspruchung. Er musste auf anderem Weg an das mutmaßliche Kleidungsstück herankommen. Vorsichtig legte Ferdinand seinen Fund mit den Händen frei. Weiter unten schien der Stoff besser erhalten zu sein. Es handelte sich um einen Waffenrock, das wurde immer deutlicher. Unter einem Ärmel lugte eine Pickelhaube hervor.
Christian Philipp von Gontard genoss die Ruhe in der Lesestube der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule. Nur ein weiterer Offizier saß am anderen Ende des Raumes und studierte schweigend eine Zeitschrift. Gontard hielt seine Pfeife in der linken und die Illustrirte Zeitung in der rechten Hand. Das Blatt aus dem sächsischen Leipzig schaffte Wundersames: Es wurde von Männern und Frauen gelesen. Gontard fesselten die langen Texte über politische, militärische und technische Themen, während die Abbildungen der neuesten Mode aus ganz Europa Henriette und seine Tochter gleichermaßen begeisterten. Dabei war die Illustrirte Zeitung keines dieser billigen Familienblätter, wie es die Kolporteure feilboten.
Gontard blätterte auf die zweite Seite, die den Nachrichten aus deutschen Landen und Europa vorbehalten war. Über Preußen gab es in dieser Woche nur einen kleinen Absatz. Gontard las: Die Festzeit hat eine politische Stille im Gefolge, die nur durch Gerüchte, Muthmaßungen und Besprechungen unterbrochen wird, welche wir übergehen müssen. In der Folge behandelte der Nachrichtenüberblick den Tod des Generals von Radowitz und ging auf den persönlichen Kondolenzbrief Seiner Majestät ein. Dass der Leichnam des Generals nach Erfurt überführt worden war, wusste Gontard schon. Dort diente Radowitz’ ältester Sohn als Offizier beim 31. Infanterieregiment, und in der Garnisonsstadt konnte der alte Radowitz seine Ruhe neben der bereits zuvor verstorbenen Tochter finden.
Danach berichtete der Absatz zu Preußen über einige Wirtschaftsangelegenheiten. Gontard überflog die Zeilen bis zu diesem Satz: Ein Erlass des einstweiligen Polizeidirektors in Stettin, Assessor Rudolff, wodurch der Ostseezeitung sehr enge Grenzen bei der Besprechung des russisch-türkischen Streits gesetzt worden waren, ist vom Minister des Inneren nicht gebilligt worden. Gontard stutzte. Innenminister Ferdinand von Westphalen galt weiß Gott nicht als Garant für Pressefreiheit. Sein Ministerium unterhielt das berüchtigte preußische Spitzelwesen. Gerüchten zufolge ließ er sogar Prinz Wilhelm wegen dessen kritischer Haltung zum Krimkrieg überwachen. Ausgerechnet dieser Minister sorgte nun dafür, dass die Stettiner ausgewogen informiert wurden – das war kaum zu glauben.
Gontard las in diesen Wochen die Illustrirte Zeitung aus dem Sächsischen intensiver als sonst, weil sie über die Krim berichtete. Er blätterte um, und sogleich begannen die ausführlichen Reports. Unter der Überschrift Vom Kriegsschauplatze fasste das Blatt die letzten Ereignisse zusammen: die Geländegewinne der Russen bei Poschow und unweit von Eriwan, die Hoffnung der Türken auf die Erhebung der Tschetschenen im Kaukasus, die Truppenkonzentration und einzelne Gefechte an der Donau, die Verschiebung von russischen Armee-Einheiten in die Walachei … Allerorten standen sich gigantische Truppen gegenüber, so verzeichnete der Bericht auf türkischer Seite allein längs der Donau und außer den stark besetzten Positionen von Schumla und Varna 123 000 Mann, während die Russen nur 110 000 zählen, bei einem Angriffe aber auf einem Punkte leicht mehr Truppen concentriren können, als ihnen der Feind dort gegenüber zu stellen hat. Welch ein Irrsinn, wie viele dieser Soldaten mit Hilfe der modernen Waffentechnik verheizt wurden!, dachte Gontard. Dafür hatten deutsche Dichter Shakespeares Wendung food for powder mit dem viel treffenderen Begriff Kanonenfutter übersetzt und in die deutsche Sprache aufgenommen.
Nach dem Überblick befasste sich die Illustrirte Zeitung mit der Schlacht von Oltenitza und dem Seekampf vor Sinope en détail. Mehr noch als der Text faszinierte Gontard die halbseitige Abbildung der Flottenverbände auf dem Schwarzen Meer. Das Bildnis war aus einer Perspektive von der offenen See her gefertigt. Im Vordergrund hatten mehrere Dutzend Kriegsschiffe die Segel gesetzt, zwischen den gewaltigen Dreimastern kreuzten kleinere Schiffe und auch eine Handvoll Boote mit Männern an den Rudern. Im Hintergrund, zu Lande, ragte die Festung von Sinope in die Höhe und sah imposanter aus als das Gebirge am Horizont.
Der Krieg war nicht nur durch die Flotte sichtbar, sondern schlich sich auch in Weiß ins Bild: in Form von Qualm. Die weißen Wolken auf dem Bild krochen über die spiegelglatte Wasserfläche wie die pure Unschuld. Die schiere Größe ließ allerdings auf den Schrecken gewaltiger Explosionen schließen. Gontard fuhr ein Schauer über den Rücken. Hinter der erhabenen Darstellung ahnte er den Tod in einer neuen, industriellen Form. Die Wolken auf dem Bild nahmen den armen Seelen das Gesicht und ließen sie im Zahlenwerk der Berichte verschwinden. Auch aus den Schornsteinen der Fabriken und Lokomotiven entwich solcher Qualm. Die neuen Formen von Krieg, Arbeit und Verkehr versteckten Schweiß und Blut zugunsten von Bilanzen …
Der Sergeant des Schuldirektors trat herbei und beugte sich zu ihm hinunter. »Der Herr Generaloberst von Schnöden würde Sie jetzt empfangen.«
»Ick würde jetzt lieber nach Hause jehn«, quengelte Quappe.
»Wir nehmen nur diesen winzigen Umweg und befragen die Männer dort«, bestimmte Ferdinand von Gontard und zeigte zum Oderufer. Gleich neben einem Wellenbrecher saßen zwei Angler und guckten über ihre Ruten auf den Fluss.
»Muss det sein?«
»Nun machen Sie mal halblang, Quappe! Wenn ich Sie erst nach Hause bringe und dann wiederkomme, sind die beiden Männer sonst wo.«
Quappe stützte sich auf einen großen Ast, den Ferdinand ihm vor ihrem Aufbruch aus dem Wald geholt hatte.
Ferdinand sah, wie Quappe das Bündel mit dem Waffenrock und der Pickelhaube schulterte und so langsam loshumpelte, als müsse das verletzte Bein sofort amputiert werden. Am liebsten hätte er den Kerl mit einem kräftigen Tritt in den Hintern geheilt. Aber nein, Ferdinand ließ sich nicht von einem Stallburschen provozieren. Er lief los, überholte den Hinkenden und drehte sich nicht mehr um. Bis zu den Anglern war noch ein Stück Weg zurückzulegen. Er hatte nicht ewig Zeit, schließlich erwartete der Bataillonskommandeur seinen Bericht schon an diesem Nachmittag.
Der Pfad am Ufer war festgetrampelt. Auf dem Marsch flussaufwärts blies Ferdinand der Wind ins Gesicht. Das verhieß nichts Gutes, aus dem Osten kam zumeist Kälte nach Breslau. Von der Aue wehten Schneekristalle herüber und bissen in die Gesichtshaut, als wären sie winzige Insekten. Ferdinand lief schneller, dabei beugte er den Oberkörper gegen die Brise. Eine Rute zum Stützen wäre nicht schlecht gewesen. Er hätte einen zweiten Ast abbrechen sollen, dachte Ferdinand. Doch nun blieben bis zu den beiden Männern nur noch wenige Schritte.
Die Angler starrten auf den Fluss, vermutlich hörten sie die Schritte gegen den Wind nicht.
»Guten Tag, die Herren!«, rief Ferdinand, um die Fischer mit seinem plötzlichen Auftauchen nicht zu erschrecken.
Die beiden drehten ihre Köpfe gleichzeitig zu ihm, besser hätten geübte Tänzer das auch nicht gekonnt. Eine Antwort bekam Ferdinand nicht.
»Ich habe ein paar Fragen an Sie.«
Die beiden glotzten, als wären sie selbst Fische.
»Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nicht über Gebühr beanspruchen. Es dauert wirklich nur einen Augenblick.« Ferdinand sprach gegen den Wind an und rief sich zugleich ins Bewusstsein, dass er ein Offizier Seiner Majestät in Uniform war. Deshalb beschloss er, den freundlichen Ton abzulegen, sollten die Angler nicht bald zuvorkommender reagieren. Zunächst versuchte er, einen respekteinflößenden Gesichtsausdruck zu machen.
»Guten Tag, Herr Offizier!«, sagte der Angler, der näher zu Ferdinand saß, und erhob sich.
Warum nicht gleich so?, dachte Ferdinand und betrachtete den Mann. Der Fischer war in mehrere Lagen schäbiger Kleidung eingepackt. Aus dem Mantel mit den zahllosen Flicken guckten eine Joppe und ein grobes Hemd heraus. Alle Kleidungsstücke mussten ihre Farbe bereits vor Jahren verloren haben. Der Angler trug außerdem eine Mütze aus derber Wolle, aus welcher der graue Zottelbart direkt herauszuwachsen schien. Der Graue zog die Mütze und schaute zu seinem Kumpel. Der sah ebenso ärmlich aus, sein Bart war allerdings von sattem Schwarz. Vermutlich zählte der zweite Mann zehn, fünfzehn Jahre weniger. Er nahm seine Mütze ebenfalls ab, deutete einen militärischen Gruß an und schwieg.