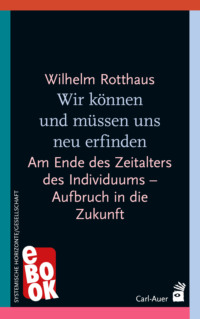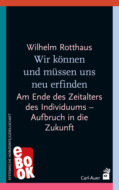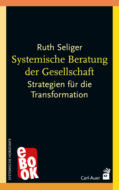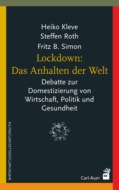Kitabı oku: «Wir können und müssen uns neu erfinden», sayfa 3
Allgemeine Charakteristika der Gesellschaft
Das Leben des Menschen im Frühmittelalter ist in all seinen Handlungen und seinen Bezügen durchdrungen von religiösen Vorstellungen. All sein Tun und alle Dinge, mit denen er umgeht, werden in Beziehung zu Christus und dem Glauben gesetzt. Alle gesellschaftlichen Regeln und Gebräuche werden daraufhin untersucht, ob sie mit den Worten der Bibel in Übereinstimmung zu bringen sind. Daraus resultiert eine Einheitlichkeit der Weltanschauung, die alle Lebensbereiche bestimmt. Das Universum ist eine von Gott geschaffene Einheit. Gott ist die höchste Instanz, und alles, was er in seiner Vollkommenheit geschaffen hat, ist sakrosankt und kann nicht hinterfragt werden. Die ständische Gliederung der Gesellschaft und die mit ihr verbundene Ungleichheit der Lebensbedingungen ist eine akzeptierte Tatsache, die keinen Widerspruch auslöst.
»Alles Existierende geht auf ein zentrales regulatives Prinzip zurück, fügt sich in eine geordnete Hierarchie ein und befindet sich in einem harmonischen Verhältnis zu den anderen Elementen des Kosmos. Da das regulative Prinzip der mittelalterlichen Welt Gott ist, der als das höchste Gut und die höchste Vollkommenheit betrachtet wurde, erhalten die Welt und alle ihre Bereiche eine religiös sittliche Färbung.
Im mittelalterlichen ›Weltmodell‹ gibt es keine ethisch neutralen Kräfte und Dinge: Sie alle sind mit dem kosmischen Konflikt von Gut und Böse in Wechselbeziehung gesetzt und in die weltweite Heilsgeschichte einbezogen. … Das, was dem Menschen des Mittelalters als eine Einheit erschien, die in der Gottheit ihre Vollendung fand, war auch in Wirklichkeit eine Einheit – denn es bildete die sittliche Welt der Menschen jener Epoche.«14
Das Leben im Frühmittelalter ist Gemeinschaftsleben. Vielfältige Gefahren lassen die Menschen nach Geborgenheit in gesellschaftlichen Bindungen suchen. Ständische Verhaltensnormen geben den Lebensstil vor und bestimmen, was der Einzelne zu tun und zu lassen hat. Das Handeln des Einzelnen ist dem Wohl der Gruppe, der er zugeordnet ist, unterworfen, ebenso wie die Gruppe sich wiederum an den Interessen der größeren Gemeinschaft zu orientieren hat.
Der Alltag vollzieht sich zunächst einmal im Rahmen des Hauses bzw. der Familie*, die zumeist aus den Eltern und zwei oder drei Kindern besteht. Die Familie eines Haushalts ist die kleinste Lebenseinheit und eine Produktionsgemeinschaft, die jedoch für sich allein nicht lebensfähig ist, sondern in Kooperation mit anderen Familien lebt und arbeitet. Der Familienname richtet sich entweder nach der Familie des Mannes oder (etwas seltener) nach der Familie der Frau. Die Verwandtschaft der Frau ist offensichtlich ebenso wichtig wie die des Mannes. Die Namen werden häufig der sozial höherstehenden Familie entnommen, um sozialen Aufstieg anzuzeigen.15 Die Ehe ist nicht Folge, sondern Voraussetzung gefühlsmäßiger Zuneigung. Liebe ist im Frühmittelalter ein viel gebrauchter, allerdings vornehmlich auf die Gottes- und Nächstenliebe bezogener Begriff.
Kinder wachsen als »kleine Erwachsene« in der Gemeinschaft auf. Sie schauen sich das, was die Erwachsenen tun, von diesen ab und führen das entsprechende Verhalten der Erwachsenen aus, sobald sie körperlich dazu in der Lage sind. Sie leben in einem informellen »natürlichen Lehrlingsverhältnis«.
»Kinder trugen die gleichen Kleider, spielten die gleichen Spiele, verrichteten die gleichen Arbeiten, sahen und hörten die gleichen Dinge wie die Erwachsenen und hatten keine von ihnen getrennten Lebensbereiche.«16
Die Kinder der Bauern werden schon früh zur Mitarbeit herangezogen. Unterricht erhalten bestenfalls einige Kinder aus der kleinen Oberschicht. Sie lernen in einer Art Priesterschule gemeinsam mit Erwachsenen das Lesen und Schreiben. Eine besondere Form von Erziehung gibt es nicht. Das Problem der Sozialisierung, der Einführung des jungen Menschen in die Gesellschaft, gilt – so Gurjewitsch17 – »mit dem Taufakt als gelöst«.
Das Selbstbild des Menschen
Der Mensch im Frühmittelalter lebt eingebunden in seine soziale Gruppe und damit an dem Platz, an den er von Gott gestellt worden ist. Er gehört zu einem größeren, höheren Ganzen und muss im Rahmen dieses Ganzen die ihm übertragene soziale Rolle ausfüllen. Sie ist ihm vorgegeben und wird als seine Berufung (vocatio) betrachtet. Er nutzt seine persönlichen Fähigkeiten dazu, um mit größtmöglichem Erfolg seine soziale Vorherbestimmung zu verwirklichen.
Das Verhalten des frühmittelalterlichen Menschen wird festgelegt durch den Verhaltenskanon seines Standes, der den Lebensstandard, die Ideale und Werte, die Denkgewohnheiten und Verhaltensformen bestimmt. Diese Vorgaben hat er bestmöglich zu verwirklichen. Abweichungen von der Norm werden nicht geduldet, weil sie den christlichen Vorbildern widersprechen und für den Glauben als gefährlich gelten. Meinungsäußerungen, die den Meinungen derer widersprechen, die allein das Recht haben, sich zu Glaubensangelegenheiten zu äußern, gelten als Ketzerei. Das Verbrechen des Ketzers besteht nicht zuletzt darin, dass er intellektuelle Überheblichkeit zeigt und die eigene Meinung der Meinung jener vorzieht, die allein bevollmächtigt sind, sich zu Glaubensangelegenheiten authentisch zu äußern. Es ist zudem die Aufgabe des frühmittelalterlichen Menschen, sich um das Allgemeinwohl zu sorgen, um damit auch das eigene Wohl zu erreichen. Das eine gilt als undenkbar ohne das andere.
Gebser18 beschreibt das Selbsterleben der Menschen im Mittelalter mit den Worten:
»Der Mensch erlebt sich organisch eingebettet innerhalb eines Beziehungssystems, er wird durch dieses getragen und in seinen Handlungen bestimmt. Seine Vorstellungen und Wahrnehmungen sind insgesamt ganzheitlich, so wie er sich selbst als Person nur in Abhängigkeit vom Ganzen erlebt. Tradition und Überlieferung werden in ritualen Formen weitergegeben. … Es herrscht ein sehr starker subjektiver Beziehungsreichtum zwischen den Menschen und den Dingen, ebenso wie zwischen den Menschen untereinander. Wird jemand in die Gemeinschaft seiner Sippe, seines Stammes hineingeboren, so fühlt er sich mit ihr zeitlebens fest verbunden. Niemals verlässt er diese Gemeinschaft, ohne die er als mythischer Mensch nicht existenzfähig wäre.«
Der Einzelne ist, wie Stapelfeldt19 hervorhebt, unmittelbar vergesellschaftet und existiert nur als Moment der Gemeinschaft. Der Mensch erlebt sich als eine unmittelbare Einheit von Körper und Seele, Natur und Denken. Dieses Denken erfolgt in Bildern und Metaphern, in Gleichnissen und Erzählungen. Die Sprache ist konkret-anschaulich. Sie enthält keine Begriffe, die Abstraktion ermöglichen. Der Mythos deutet die Welt insgesamt.
Durch das Christentum sieht Gurjewitsch20 den frühmittelalterlichen Menschen in eine in sich widersprüchliche Situation gestellt: Einerseits wird er als gottähnlich, dem Bilde seines Schöpfers nachgebildet, angesehen. Da die Welt für den Menschen geschaffen wurde, kann man im Menschen die ganze Welt und ihre Einheit finden. Er teilt mit den Engeln die Fähigkeit, zu verstehen und zu urteilen. Der Mensch ist somit als gottunmittelbares Wesen die Krone der Schöpfung. Andererseits aber ist der Mensch ein Sklave Gottes. Doch der Dienst an Gott erniedrigt nicht, sondern hebt den Menschen empor und erlöst ihn. Allerdings erfordert Dienen Demut und die Unterdrückung der persönlichen Neigungen, die den rigoristischen Idealen des Christentums widersprechen. Erlösung und Vollendung des Menschen sind erst in der anderen Welt möglich. Eine freie Entwicklung der Persönlichkeit ist auf Erden ausgeschlossen.
Sehr eindrücklich lässt sich das frühmittelalterliche Menschenbild an den Heiligenviten und Chroniken ablesen, die im frühen Mittelalter eine hohe Bedeutung hatten. Die Charakterzüge der dort dargestellten Menschen werden typisiert dargestellt und lassen sich kaum zu einem Gesamtbild vereinen. Die Menschen werden vorwiegend geschildert als Träger bestimmter Eigenschaften, wie zum Beispiel des Stolzes, der Tapferkeit, des Edelmuts oder der Feigheit, der Habsucht, der Böswilligkeit und Verderbtheit. Sie handeln in den historischen Erzählungen weniger als konkrete Persönlichkeiten, sondern vielmehr als personifizierte positive oder negative moralische Werte. Änderungen, die im Verlaufe des dargestellten Lebens auftreten, geschehen plötzlich, für den Leser unvorbereitet. Der Verzagte findet plötzlich Mut, der Habsüchtige schaut auf das Ende der Welt und verteilt sein Geld als Almosen und der Sünder tut Buße und führt von Stund an ein gottgefälliges Leben.
»Nicht umsonst stellte man im Mittelalter so gern personifizierte Tugenden und Laster dar. Güte und Habsucht, Hochmut und Klugheit, Sanftmut und Gerechtigkeit wurden, ähnlich wie Zeit, Alter und dergleichen mehr, ständig in menschlichen Gestalten verkörpert, die sich selbständig auf den Seiten der Romane und Poeme, in Miniaturen und als Skulpturen bewegen und wirken. Diese allegorischen Wesen traten in der Rolle von Führern und Lehrern des Menschen auf: Sie veranlassten ihn zu diesen oder jenen Handlungen und flößten ihm die betreffenden Gefühle ein. Der Mensch selbst erwies sich in der Stellung einer Marionette, der diese verkörperten Eigenschaften Leben verliehen. Der Mensch befand sich in der Regel zum gegebenen Zeitpunkt in der Macht irgendeiner dieser sittlichen Kräfte, und unter deren Einfluss führte er dann seine Handlungen aus. Die Initiative ging von diesen Kräften aus, sie war nicht im Kern der ganzheitlichen Persönlichkeit verwurzelt. In der menschlichen Seele kämpften verschiedene Kräfte, doch deren Ursprung befand sich außerhalb der Persönlichkeit. Deshalb waren auch diese Kräfte oder moralischen Eigenschaften selbst unpersönlich, und sowohl die Tugenden als auch die Laster waren Allgemeinbegriffe. … Ihre Anwesenheit im Menschen bestimmte dessen Geistesverfassung und Verhalten. Sie drangen in ihn ein, ähnlich wie nach mittelalterlichem Glauben der Teufel in den Menschen eindringen konnte, und verließen ihn ebenso, wie die unreine Kraft (der Teufel) die menschliche Haut verließ. Die mittelalterlichen Moralisten verglichen die Seele des Menschen mit einer Festung, in der die Tugenden von den sie überfallenden Lastern belagert sind.«21
Nicht selten wird das Bild vom Menschen als einem »Gefäß« verwandt, das mit unterschiedlichem, im Verhältnis zu seinem Wesen äußerlichem Inhalt gefüllt ist.
Die Natur, die Dinge, die Umwelt
Ein herausragendes Merkmal des frühmittelalterlichen Menschen ist seine Nähe zur Natur. Der weit überwiegende Teil der Bevölkerung führt eine naturalwirtschaftliche Lebensweise und findet im unmittelbaren Austausch mit der Natur die Hauptquelle der Befriedigung seiner grundlegenden Bedürfnisse. Die Natur ist für ihn lebendig und beseelt, anthropomorph, und verfügt über moralische Qualitäten. Eine eindeutige Abgrenzung zwischen dem frühmittelalterlichen Menschen und der Natur ist kaum festzustellen.
»Er findet in der Welt seine eigene Fortsetzung und entdeckt gleichzeitig auch in sich selbst das Weltall. Sie schauen gleichsam gegenseitig ineinander hinein.«22
»Die Natur ist für das Mittelalter gleichbedeutend mit den vier Elementen, aus denen sich Universum und Mensch zusammensetzen, der ja seinerseits ein Miniaturuniversum, ein Mikrokosmos ist. Der Leib des Menschen ist, wie es im Eludicarium* heißt, aus den vier Elementen gebildet. ›Deshalb nennt man ihn einen Mikrokosmos, d. h. Welt im Kleinen. Denn tatsächlich besteht er aus Erde: das ist das Fleisch; aus Wasser: das ist das Blut; aus Luft: das ist der Atem; aus Feuer: das ist die Wärme‹.«23
Die Sicht auf sich selbst und die Sicht auf die Dinge der Welt sind für den frühmittelalterlichen Menschen eng miteinander verbunden. In den Berichten der Historiker wird immer wieder beschrieben, dass der damalige Mensch mit dem Blick auf sich selbst – wie in einem Spiegel – die Natur wahrnimmt und in der Natur sich selbst erkennt. Die Natur stellt für ihn zudem ein Symbol der unsichtbaren Welt dar. Die Betrachtung der irdischen Welt eröffnet einen kleinen Blick auf die andere, höhere Ebene, die nicht unmittelbar zu erfassen ist. Der Weg zu ihrer Erkenntnis verläuft vom Sichtbaren zum Unsichtbaren.
»Einerseits zwar ist die Schöpfung Erzeugnis Gottes, aus ihm freigesetzt, entlassen, entäußert, andererseits aber ist sie nicht das ganz Andere, Fremde, Antigöttliche, das Gott als zweites, autonomes Prinzip gegenübertritt … Vielmehr ist die Schöpfung Gottes Produkt, das trotz aller Entäußerung eine gewisse Beziehung auf ihn bewahrt und an ihm partizipiert. … So ist die Schöpfung – die Natur – zwar nicht Gott selbst, sondern ›nur‹ sein Produkt und damit etwas anderes als Gott, wohl aber bleibt sie ›sein‹ Produkt und ist insofern mit dem Prädikat ›göttlich‹ zu versehen.«24
Die in der Genesis (1,27) beschriebene Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott garantiert ihm eine Position zwischen Gott und der übrigen Natur, die häufig dadurch ausgedrückt wird, dass der Mensch mit seinem Leib der Natur angehört und mit seiner Seele dem ewigen göttlichen Bereich. Darauf aufbauend sieht der frühmittelalterliche Mensch
»in der Natur das Mitgeschöpfliche, mit dem der Mensch sympathetisch – mitfühlend, mitleidend, miterlebend – verbunden ist. Alle Geschöpfe werden als Mitbrüder und Mitschwestern … angesehen, die zu einem einzigen Lebens- und Sinnzusammenhang gehören.«25
Gott hat dem Menschen den Auftrag gegeben, mit und in seinem Leben durch naturgemäßes Handeln die göttliche Ordnung der Dinge zu erfüllen und aufrechtzuerhalten. Er hat den Menschen mit Vernunft ausgestattet, damit er Gott in den Dingen, in der Natur erkennt und versteht. Der zentrale Gedanke des Frühmittelalters lautet: universalia sunt realia ante rem (Allgemeinbegriffe sind Wirklichkeiten und stehen vor dem Ding). D. h.: Die Ideen und die Gattungsbegriffe wie »Dreifaltigkeit«, »Lebewesen« oder »Rose« sind das eigentlich Reale, nur sie sind wirklich, während die Dinge der Welt lediglich Abbilder oder Symbole dieser Wirklichkeit der Universalien sind.
Aufgabe des Menschen ist es unter anderem, die verborgenen Analogien zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos, von denen die Welt voll ist, zu erkennen. Sie werden durch äußere Zeichen sichtbar, die Gott auf die Oberfläche der Dinge gesetzt hat. Die kleinen dunklen, in Weiß eingefassten Samen des Eisenhuts sind ein Zeichen dafür, dass die Pflanze gegen Augenleiden hilft. Die Ähnlichkeit der Walnuss mit dem Gehirn deutet daraufhin, dass diese gegen Kopfschmerzen hilft. Wissen bedeutet die Entzifferung von Zeichen und Signaturen in der Natur.
Dazu dient das Aufdecken von Ähnlichkeiten, das in der frühmittelalterlichen Kultur eine hohe Bedeutung hat. »Den Sinn zu suchen, heißt an den Tag zu bringen, was sich ähnelt. Das Gesetz der Zeichen zu suchen, heißt die Dinge zu entdecken, die ähnlich sind.«26 Dies ist ein Erkenntnisansatz, der sich bis in die Zeit der Renaissance hält. Nicht nur nah beieinander liegende Dinge wie Meer und Erde, Körper und Seele ähneln sich in diesem Denken, sondern auch weit voneinander entfernte: Im Gesicht spiegelt sich der Himmel, den Augen entsprechen Sonne und Mond, Pflanzen und Gräser sind irdische Sterne. Daneben gibt es subtilere Ähnlichkeiten, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen: Die Sterne stehen zum Himmel im gleichen Verhältnis wie die Gräser zur Erde, und der menschliche Körper ist ein Abbild des Kosmos: Seine Adern sind Flüsse, seinen sieben Hauptgliedern entsprechen die sieben Metalle in der Erde. Auch ganz Unterschiedliches oder Entferntes kann durch die Kraft der Sympathie Ähnlichkeit gewinnen: Die Sonnenblume vollzieht die Bahn der Sonne nach, die Wurzel der Pflanze treibt dem Wasser zu.
Im frühmittelalterlichen Denken werden Dinge zudem in ein Netz symbolischer Bezüge gestellt. Kein Ding existiert isoliert für sich, es weist immer auch auf andere Dinge hin. Jedes Ding besitzt, so glaubt man, nicht nur eine materielle, sondern auch eine symbolisch-geistige Seite. Die Welt ist voller symbolischer Bezüge, ein riesiges Netzwerk symbolhafter Zusammenhänge von Korrespondenzen, – ein endloses Band von Anziehung und Abstoßung, von Sympathie und Antipathie, von Ähnlichkeiten und Unendlichkeiten. Die sieben Öffnungen im Gesicht des Menschen entsprechen den sieben Planeten am Himmel. Die Falten in der Hand eines Menschen zeigen dessen durch die Bewegung der Planeten bestimmtes Schicksal an.
»Alles ist mit allem verwandt, alles steht in symbolischer Beziehung. Dinge sind in dieser Denkweise nicht statisch, sie besitzen dynamischkinetische Aspekte. Die Identität von Dingen entsteht aus ihrem dynamischen Wechselspiel mit anderen Dingen, zum Beispiel der Menschen mit der Konstellation der Sterne. In den Dingen gibt es verborgene Seiten, denen ein objektiver Status zugeschrieben wird. Naturerkenntnis ist ein interpretierendes Nachvollziehen des geheimen Sinns der Dinge (Hermeneutik des Mittelalters). Im sichtbaren Zeichen können der unsichtbare Sinn, die Werte, die Zwecke, die Symbole, die Analogien erfasst werden. Dazu ist es notwendig, auf die Zeichen der Natur zu achten, im Buch der Natur zu lesen (legere in libro naturae). Das Wissen um die Natur bedarf einer Entzifferung der Natur (Signaturlehre).«27
Die Wissenschaft
Für die Menschen mit einer theozentrischen Weltkonzeption bedarf die Welt keiner wissenschaftlichen Erklärung, sie wird unmittelbar aufgefasst. Auch die Logik dient der Enthüllung göttlicher Geheimnisse – des Aufbaus des Weltalls und des Platzes, den der Mensch darin einnimmt. Die Denker des Frühmittelalters sind ständig auf das tiefe Erfassen Gottes, des Schöpfers aller sichtbaren Dinge, orientiert. Diese Dinge existieren nicht ihrer selbst wegen, sondern nur als Mittel zur Erkenntnis des göttlichen Wesens.
»Die Schöpfung ist eine einzige große Heilstatsache, die Welt ein Phänomen des Glaubens: An diesem Elementarsatz hat wohl kaum irgendein mittelalterlicher Mensch jemals gezweifelt. Man hatte eben die Lehre Jesu voll begriffen, deren Kern in der ernsten und einfachen Mahnung besteht, zu glauben; nicht daran zu zweifeln, dass diese Welt ist und dass sie ein Werk Gottes ist.«28
Ein wissenschaftlicher Beweis wird dadurch geführt, dass man auf die Aussagen der Bibel und der Kirchenväter verweist. Dabei spielt das Symbol eine große Rolle. Der Weg zur Erkenntnis der Welt führt über das Begreifen der Symbole und das Erfassen ihres verborgenen Sinns. Das Symbol ist unmittelbarer Ausdruck der Realität, die man unmöglich mit dem Verstand erkennen kann.
»Das gesamte Diesseits ist nichts anderes als das Symbol des Jenseits; deshalb besitzt jedes beliebige Ding einen doppelten oder vielfältigen Sinn, und neben der praktischen besitzt es eine symbolische Anwendung. Die Welt ist ein Buch, das von Gottes Hand geschrieben wurde, in dem jedes Wesen ein Wort darstellt, das mit Sinn erfüllt ist.«29
Folglich ist es Aufgabe des frühmittelalterlichen Denkers, die wahre Bedeutung der Symbole zu enthüllen. Insofern stellt der Symbolismus durchaus kein unnützes Spiel der Vernunft dar. Er ist ein Mittel der intellektuellen Aneignung der Wirklichkeit.
Die theoretische Analyse der frühmittelalterlichen Denker geht ständig vom Ganzen aus. Deshalb sieht man im Einzelnen vorwiegend das Symbol des Allgemeinen. Das mittelalterliche Symbol ist niemals ethisch neutral. Die Symbolhierarchie ist gleichzeitig auch eine Werthierarchie. Jedes Ding auf Erden, jedes beliebige Wesen besitzt eine bestimmte Würde in Abhängigkeit von dem Platz, den es in der Hierarchie des Ganzen einnimmt. Zentrum und Gipfel des Ganzen ist Gott, und alle seine Schöpfungen, von den höchsten bis zu den niedrigsten, von den Engeln bis zu den Insekten und Steinen, dienen ihm.
Wie schon mehrfach betont, wird die Welt nicht als in Bewegung und Entwicklung aufgefasst, sondern als in ihren Grundlagen beständig und ewig. Veränderungen und dadurch ausgelöste Probleme spielen in der Wahrnehmung der frühmittelalterlichen Menschen keine große Rolle. Die (bedeutsamen) Geschehnisse in der Welt brauchen keine (kausale) Erklärung, sondern vielmehr eine Deutung im Zusammenhang der göttlichen Weltordnung. Die Dimensionen des Ursachennetzes waren »ausgeschlossen. Eine künstliche Welt war konstruiert, ohne Sicht der Konsequenzen«30 Deshalb finden sich in wissenschaftlichen Schriften selten Gedanken und Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen zwei oder mehreren Ereignissen und Erscheinungen in Form von Ursachen und Folgen.
»Die kausale Erklärung (spielte) eine untergeordnete Rolle und hatte nur in Erörterungen zu ganz konkreten Fragen eine Bedeutung, doch die Welt insgesamt wird in den Augen der mittelalterlichen Denker nicht von den Gesetzen der Kausalität gelenkt. Zwischen den verschiedenen Erscheinungen existieren keine horizontalen Verbindungen (des Typs ›Ursache – Wirkung‹ ›Aktion – Reaktion‹), sondern eine vertikale Hierarchie: Jedes irdische Ding besitzt einen transzendentalen Prototyp, ein Vorbild, das … seinen tieferen Sinn enthüllt. Die Beziehungen zwischen dem Vorbild und der Erscheinung sind stabil und unveränderlich.«31
Insgesamt entsteht im Frühmittelalter ein »enzyklopädisches Denkgebäude maximaler Größe und gleichzeitig maximaler Integration aller Details«32. Die theologisch fundierte Philosophie vereint Glauben und Wissen, besticht durch eine nur nach langem Studium beherrschbare Feinheit und Komplexität des Arguments und imponiert durch eine eigene subtile Ästhetik. Die Philosophie der Neuzeit wird später durch die im Frühmittelalter entwickelten zentralen Zielvorgaben des Nachdenkens geprägt: die Theorie eines einheitlichen, weltumspannenden, an Universitäten gelehrten, von Wissenschaften produzierten Wissens und die Suche nach einer letzten »Weltformel«.