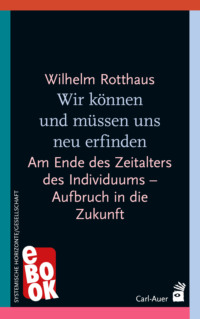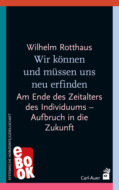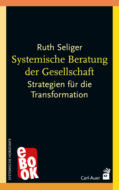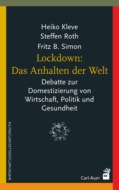Kitabı oku: «Wir können und müssen uns neu erfinden», sayfa 4
Die Sprache
Die Sprache ist ähnlich wie die oben beschriebenen Symbole ein Zeichensystem unter vielen anderen und unlösbar mit der Welt verbunden. Das Wort repräsentiert im Denken der Menschen des Frühmittelalters nicht das Ding, sondern es ist seine materielle Schrift, seine ihm von Gott auferlegte Signatur. Die unterschiedlichen Bereiche der menschlichen Tätigkeit und des wissenschaftlichen Denkens besitzen dementsprechend auch keine eigene, nur ihre zugehörige Fachsprache. Alle wichtigen Begriffe sind mehrdeutig, und in verschiedenen Kontexten erhalten sie ihren eigenen, besonderen Sinn. Die Fähigkeit, eine »mehrdeutige Erklärung« ein und desselben Textes zu geben, ist eine nicht wegzudenkende Eigenschaft des Intellektuellen in dieser Zeit.
So gibt es im Frühmittelalter durchaus zahlreiche mathematische Erörterungen und damit auch eine Sprache mathematischer Symbole. Diese mathematischen Symbole sind jedoch gleichzeitig theologische, da die Mathematik selbst auch eine »sakrale Arithmetik« darstellt und den Bedürfnissen einer symbolhaften Auslegung göttlicher Wahrheiten dient. Die Sprache der Mathematik ist deshalb bestenfalls ein Dialekt der allgemeinen Sprache der christlichen Kultur, in der die Zahl häufig als ein sakrales Symbol dient und einen Gedanken Gottes repräsentiert.
»Zahlen und geometrische Körper sowie Figuren (Sphäre, Kreis, Quadrat usw.) sind nicht Alleingut der Mathematik; in ihnen drückt sich die Weltharmonie aus, sie tragen bestimmte magische und sittliche Bedeutungen. Diesem Bewusstsein war nicht die Mathematik in unserem Sinn, sondern die ›sakrale Mathematik‹ wesentlicher. Von Augustinus stammt das Verständnis der Zahlen als Gedanken Gottes; deshalb vermittelte die Kenntnis der Zahlen die Kenntnis des Universums selbst. Die heiligen Zahlen in der Bibel waren voller Geheimnisse, sie wurden ständig gedeutet, wobei man bestrebt war, das Wesen des Kosmos zu enthüllen.«33
Etymologien sind im Frühmittelalter sehr populär, nicht weniger als Enzyklopädien (manchmal fielen sie auch zusammen). Dem Worte eine Deutung zu geben heißt, das Wesen der von ihm bezeichneten Erscheinung zu enthüllen. Die mittelalterlichen Etymologien dienen den Menschen jener Epoche als Leitfaden für das Eindringen in das Geheimnis der Welt. Dabei werden auch Herleitungen von Wörtern praktiziert, die lediglich auf einer Übereinstimmung oder Nähe des Wortklangs beruhen. So leitet beispielsweise Isidor von Sevilla das Wort homo von humus – »Erde« – ab. Das erscheint plausibel; denn der Mensch ist von Gott aus Erde geschaffen, und zu Erde wird er wieder. Der Herrscher (rex) und sein Handeln (regere) werden mit recte agere (»richtig und gerecht handeln«) in Beziehung gesetzt und davon abgeleitet. Daraus wird gefolgert: Ein König muss gerecht regieren. Und decorus (»anständig«, »herrlich«) wird von decus cordis (»Schönheit der Seele«) hergeleitet; denn die körperliche und sichtbare Schönheit ohne moralische Grundlage gilt als etwas Böses und als Ausgeburt des Teufels.
Allerdings darf nicht übersehen werden, dass der weitaus überwiegende Teil frühmittelalterlicher Kommunikation mündlich erfolgt und dass die frühmittelalterliche Gesellschaft letztlich eine »orale Gesellschaft« ist. Formen der nonverbalen Verständigung haben eine große Bedeutung. Rituale und vorgeprägte Verhaltensmuster spielen in der Kommunikation eine große Rolle. Das betrifft nicht nur die Messliturgie, Bußakte (barfuß und in wollenem Gewand) und Rechtsbräuche bis zur Königskrönung, sondern auch andere politische Vorgänge, wie Unterwerfungen, die symbolhaft eine Niederlage eingestanden.
»Auch Emotionen (Empörung, Tränen, Zerknirschung) konnten hier als Mittel bewusst ›inszenierter‹, ›öffentlicher Kommunikation‹ eingesetzt werde … Als der Mainzer Erzbischof Konrad um Gnade für alle bat, die gegen ihn gefehlt hatten, ›seufzte der König, ergriffen von Erbarmen, und vergoss unsägliche Tränen‹. … Insgesamt ergibt sich ein recht geschlossenes Bild einer bewusst eingesetzten ›nonverbalen Kommunikation‹, so dass man das Mittelalter geradezu ein Zeitalter der Zeichen genannt hat.«34
Armut, Reichtum und Handel
Die Bewertung von Armut und Arbeit, Eigentum und Reichtum fällt im Frühmittelalter sehr unterschiedlich und ambivalent aus, auf allen Ebenen zwischen positiv und negativ schwankend. Die Armut ist eine charakteristische Erscheinung in der Epoche des Feudalismus, zumal sie die Mehrzahl der Bevölkerung betrifft. Die Armen genießen einerseits kein Ansehen und werden weitgehend verachtet; der Adel schaut auf diese Menschen der Unterschicht geringschätzig herab. Andererseits sieht man in der Armut auch einen Zustand der Auserwähltheit. Die »Armen Christi« (pauperes Christi) sind Menschen, die keine irdischen Güter erstreben, um sicherer das Himmelreich zu erlangen.
In der Arbeit sieht man einerseits einen Fluch, der das Menschengeschlecht bedrückt, andererseits eine Tätigkeit, die den Menschen aus der übrigen Welt hervorhebt und ihn zum Herrn der Natur macht. Das Arbeiten wird vorwiegend als Normalzustand des Menschen angesehen. Das christliche Prinzip lautet: »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.« Die Arbeit wird nach der damals verbreiteten Lehrmeinung des Christentums nicht mit der Erschaffung des Menschen zur Notwendigkeit. Sie ist vielmehr infolge des Sündenfalls notwendig geworden und stellt demnach eine Strafe Gottes dar. Untätigkeit zählt zu den schweren Sünden.
Auch das Verhältnis zum Reichtum ist von Gegensätzlichkeit geprägt. Eigentum kann dem Heil der Seele dienen, kann sie aber auch daran hindern, paradiesische Glückseligkeit zu erlangen. Der Konflikt in der Erörterung der Bedeutung von Eigentum besteht einerseits in der Aussage des Matthäusevangeliums: »Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.« Andererseits basiert die Feudalgesellschaft auf Eigentum – dem Großgrundbesitz des Adels und der Kirche sowie dem kleinen Arbeitsbesitz der Bauern und Handwerker. Dennoch erhält im Verlaufe des Frühmittelalters der Reichtum niemals bedingungslose Rechtfertigung und Billigung. Er ist erlaubt, doch unter bestimmten Bedingungen und mit bedeutenden Vorbehalten. Die christliche Religion sanktioniert die feudale Ordnung, doch ihr Verhältnis zum Eigentum ist recht widersprüchlich.
Die Kirchenväter weisen mehrfach darauf hin, dass die ersten Menschen, die sündlos waren und unmittelbar mit Gott in Verbindung standen, weder Arbeit noch Eigentum kannten. Der Herr übergab die von ihm geschaffene Erde wie auch ihre Früchte und alle Lebewesen in die Macht des Menschen; doch er wollte, dass sie diese gemeinsam besitzen. Nur der Eigennutz des Menschen im Zustand des Sündenfalls führte zum Privateigentum. Folglich kommen das Eigentum und der teilbare Besitz nicht von Gott; sie sind vielmehr das Resultat der Habsucht der Menschen und der Unvollkommenheit ihrer Natur nach der Vertreibung aus dem Paradies. Die Lehre von der Gerechtigkeit hat in ihrer frühmittelalterlichen Interpretation nichts mit dem Begriff Gleichheit gemein. Im Zustand der gefallenen Menschheit sind sowohl Privateigentum als auch Ungleichheit unter den Menschen, die durch die Herkunft, den Erfolg oder den Vermögenswohlstand hervorgerufen werden, unumgänglich. Die Ungleichheit der Menschen ist für die frühmittelalterlichen Denker axiomatisch.
Nach Gurjewitsch stellten die Aufforderungen der frühmittelterlichen Prediger zum Verzicht auf Eigentum
»zu einem guten Teil bloße Rhetorik dar. Die Mehrheit der Gesellschaft war geneigt, sie lediglich als einen Anlass zur Zerknirschung über die eigene Unvollkommenheit und Unfähigkeit aufzufassen, anstatt in der Tat buchstäblich den christlichen Prinzipien der Armut zu folgen. Aber damit die Hauptmasse der Gläubigen die kategorischen Gebote der evangelischen Armut mit dem Besitz an Eigentum vereinbaren konnte, mussten in der Gesellschaft Menschen existieren, die die Erfüllung des Gelöbnisses der freiwilligen Armut auf sich nahmen. Sie gaben der übrigen Gesellschaft ein Beispiel, das nachzuahmen diese außerstande war. Sie gaben ihr damit zugleich den Trost, dass sie als die von Gott Erwählten durch ihr gerechtes Verhalten und den Verzicht auf irdische Güter und Interessen das Menschengeschlecht in seiner Gesamtheit retten. Diese Funktion übernahmen die Mönchsordnen, vor allem die Bettelorden. Ihnen war das Gebot der Armut ein grundlegendes Prinzip.«35
Die Kirche ist der größte Eigentümer von Grundbesitz in der Feudalgesellschaft und in vielfältiger Weise mit den weltlichen Großgrundbesitzern verbunden. Deshalb macht sie nicht den Versuch, das Privateigentum abzulösen und die Besitztümer umzuverteilen. Die Theologen verurteilen denn auch weniger das Prinzip des Eigentums selbst als vielmehr dessen Missbrauch. Als Kriterium für den Unterschied zwischen erlaubtem und unerlaubtem Eigentum gelten nicht seine Ausmaße, sondern die Ziele, die der Eigentümer damit verfolgt. Die einzige Vorschrift der Kirche, die auf eine teilweise Umverteilung der Güter gerichtet ist, beschränkt sich auf die Mahnung zum Almosengeben. Die Armen und Besitzlosen stehen in der Auffassung des Mittelalters Christus näher als die Eigentümer; in ihnen sieht man das Bild Christi selbst. Deshalb erscheint die Existenz der Besitzlosen als notwendig, und niemand denkt darüber nach, die Armut zu beseitigen. Bettler sehen sich selbst als von Gott Erwählte und streben nicht danach, sich aus der Armut zu befreien. Die Herrscher und Feudalherren unterhalten gewöhnlich an ihren Höfen eine große Zahl von Bettlern, geben ihnen Geld und beköstigen sie. Oft nehmen diese Ausgaben riesige Ausmaße an, und die reichen Leute verausgaben für die Bettler bedeutende Mittel. Große Bedeutung wurde dem Unterhalt von Bettlern und Notleidenden auch in den Klöstern beigemessen. In Cluny zum Beispiel ernährt man manches Jahr bis zu 17.000 Arme.
»Der Reichtum ist für den Feudalherren ein Mittel zur Unterhaltung gesellschaftlichen Einflusses und der Bestätigung seiner Ehre. Der Reichtum allein bringt keinerlei Achtung. … Ein Herr aber, der ohne Berechnung sein Einkommen und die Beute vergeudet, verdient, sogar wenn er über seine Verhältnisse lebt, noch Gelage veranstaltet und Geschenke verteilt, jegliche Hochachtung und Ruhm. … Der Reichtum ist ein Zeichen, das von Tugend, Freigebigkeit und großzügiger Natur des Herren zeugt.«36
Das Land, die Hauptform des feudalen Eigentums, ist jedoch kein Objekt freier Verfügung und keinesfalls ein Objekt von Handelsoperationen. Der Feudaleigentümer kann sich auch nicht die ganze Einnahme vom Land zu seinem Nutzen aneignen und muss Dienste – beispielsweise dem König – leisten, die mit diesem Besitz verbunden sind. Der Feudalherr steht mit seinem erblichen Lehen in einer »Ehrenehe«. Außerdem hat er nicht das Recht, die Bauern von dem Land zu vertreiben, auf dem sie arbeiten. Den Herren verbindet mit dem Land und mit den das Land bestellenden abhängigen Menschen kein bloßes materielles Interesse, sondern ein kompliziertes System von Ausbeutungsverhältnissen, von politischer Macht und Untertänigkeit, von Sitten und Tradition, von Achtung und Schutz.
Das »Weltmodell« des frühmittelalterlichen Menschen entspricht seiner begrenzten Tätigkeit auf einem verhältnismäßig engen Raum, im Umgang mit einer relativ geringen Zahl anderer Mitglieder der Gesellschaft, mit denen er persönliche, nicht anonyme Beziehungen eingeht, die sich in direkten Kontakten ausdrücken. Das Geld und die Waren, die sich in dieser Gesellschaft im Umlauf befinden, spielen im Frühmittelalter noch keine große Rolle. Geld wurde im Frühmittelalter als etwas verstanden, was verbraucht wird. Aristoteles folgend hielten die mittelalterlichen Denker es für unfruchtbar; seine einzige Bestimmung sei es, als Mittel des Austausches zu dienen.
Der Handel wird im Übrigen wesentlich dadurch eingeschränkt, dass die Zahlen mit römischen Ziffern geschrieben werden, die in einem nur beschränkten Zahlenraum Mengen kennzeichnen können und zum Rechnen kaum geeignet sind. Dafür nutzt man neben anderen Methoden das Rechenbrett, den Abakus, bei dem Steine oder Kugeln, auf senkrechten Stangen angeordnet, die Einer, die Zehner, die Hunderter und die Tausender darstellen. Allerdings war das Rechnen mit dem Abakus eine Kunst, die damals nur ganz wenige Menschen beherrschten.
Grundsätzlich aber erkennen die mittelalterlichen Theologen die Notwendigkeit des Handels für die Existenz der Gesellschaft an, wenn er dem allgemeinen Nutzen dient. Unter dieser Voraussetzung ist auch ein Handelsgewinn gerechtfertigt, falls er gemäßigt ist, als gerechtes Entgelt für das Risiko, die Arbeiten und Aufwendungen (stipendium laboris) angesehen werden kann und die Existenz des Händlers sichert. Außerdem kann der Gewinn aus dem Handel durch wohltätige Ziele gerechtfertigt sein, für die er verwendet wird.
Mit den Geldverleihern jedoch – den Wucherern – geht die Kirche keinerlei Kompromisse ein und verbietet ihnen sogar, unrechtmäßig erworbene Gelder testamentarisch für die Bedürfnisse der Wohltätigkeit zur Verfügung zu stellen. Von den Wucherern und ihren Erben fordert man, dass alles das, was als Prozente erhalten wird, den von ihnen »geplünderten« Schuldnern zurückerstattet wird.
»Der Wucherer bereichert sich, genau genommen, an der Zeit; denn wenn er Geld leiht, bekommt er es nach einem bestimmten Zeitabschnitt zurück und fordert Prozente. Doch niemand kann mit der Zeit Handel treiben – mit Gottes Schöpfung, die zum allgemeinen Wohl gegeben wurde. Der Handel mit der Zeit ist eine ›Verkehrung der Ordnung der Dinge‹ (Bonaventura).«37
Das kirchliche Verbot, den Wucherzins einzustreichen, wird zudem mit den Worten Christi begründet: »Tut wohl und leihet, dass ihr nichts dafür hoffet« (Lukasevangelium 6,35). Der Geldvertrag kann folglich nur den Charakter einer unentgeltlichen Hilfe und eines freundschaftlichen Darlehens tragen. Ein beliebiger Zuwachs zu der entliehenen Summe (außer einem freiwilligen Geschenk als Zeichen der Dankbarkeit) wird als unrechtmäßiges Einkommen verurteilt.
»Während ein Kaufmann, der die Ware teurer verkaufte, als er sie gekauft hatte, noch eine Rechtfertigung in den Aufwendungen, die mit der Lagerung und dem Transport der Ware verbunden waren, und in der Notwendigkeit, eine Belohnung für die erwiesenen Dienste zu erhalten, finden konnte, besaß der Wucher in den Augen der mittelalterlichen Theologen keinerlei Rechtfertigung. Das Einkommen der Wucherer ist unmoralisch und sündhaft, denn sie erhalten es, ohne zu arbeiten, und ›verdienen das Geld sogar im Schlaf‹, an Festtagen ebenso wie auch an Markttagen.«38
Ethik und Recht
Die Ethik des frühen Mittelalters spiegelt das gemeinschaftsgebundene Selbst- und Weltbild des Menschen. Sie zeigt sich gleichermaßen in den Ideen der Kirche über Sünde und Buße wie in den Vorstellungen des frühmittelalterlichen Rechts über Schuld und Sühne. Die Auffassungen zur Sünde und Buße überliefern die so genannten »Bußbücher«. Sie sind sozusagen ein Fallkatalog möglicher Sünden und der ihnen zuzuordnenden Bußen. Sie dienen als Richtlinie für den Priester, wenn er eine Buße festlegen muss. Dabei sind lediglich die objektiven äußeren Merkmale des Tatbestandes zu berücksichtigen.
Das frühmittelalterliche Deliktrecht, das Sanktionen im Hinblick auf Vergehen von Diebstahl und Raub bis Körperverletzung und Tötung behandelt, legt ebenfalls das Schwergewicht auf die Tat. Denn durch die Tat wird die Lebensordnung verletzt; sie führt zu einer Entordnung, die schnellstens wieder zu beseitigen ist. Die Störung der Harmonie, in der alles menschliche Leben aufgehoben ist, muss wiederhergestellt und das Heil wiedergewonnen werden. Das geschieht durch einen Ausgleich der Unrechtsfolgen.
»Die Rekonstruktion der Ordnung fordert ein ganz bestimmtes, starr festgelegtes Tun, eine Buße in ganz bestimmter Höhe oder anderes. Ist diesem Gebot entsprochen, dann ist die entstandene Lücke geschlossen und die Symbiose im ordo der Welt wieder hergestellt. Die Folge der Tat, die man so irreführend auch für das frühe Mittelalter ›Strafe‹ nennt und die dazu dienen sollte, einen Riss im Weltgebäude zu kitten, ist ein ganz objektiver Vorgang, ein objektives und seit alters her bekanntes Mittel. Es ist, um einen Vergleich zu gebrauchen, ein Medikament zur Heilung.«39
Man spricht davon, dass das frühmittelalterliche Deliktrecht auf dem so genannten Kompositionensystem beruht. Dieser Begriff ist abgeleitet von compositio – »Buße«. Er bezeichnet die Sühnung einer Strafe durch Zahlung eines Sühnegelds an das Opfer der Straftat bzw. dessen Familie oder Sippe. Das Delikt schädigt die Sippe des Opfers; kollektiv haftbar ist die Sippe des Täters, die durch die Erlegung der Buße – im Falle einer Tötung: des Wergeldes (Sühnegeldes) – einer Sippenfede vorbeugt. Das Geld oder sein materielles Äquivalent ist eine Genugtuung für die Kränkung der Opfersippe, geleistet durch die Verwandtschaft des Täters. Die Sanktion wird nach dem Ausgang der Tat bemessen, für die Schadenersatz und Wiedergutmachung zu leisten ist.
»Man unterschied zwischen Mord und Totschlag, differenzierte dabei jedoch nicht, wie heute, nach Motiv und Absicht, sondern danach, ob die Tötung eingestanden oder verheimlicht wurde. Die Volksrechte sahen für schwere Vergehen durchaus die Todesstrafe, meist durch Erhängen, Enthaupten oder Ertränken, sowie andere Körperstrafen (Verstümmelung, Hiebe) vor … Seit karolingischer Zeit traten Verbannung oder auch die Einweisung in ein Kloster vielfach an die Stelle der Todesstrafe.«40
Bei einem Gerichtsprozess ist es von großer Bedeutung, dass die notwendigen Prozeduren eingehalten und Formeln vorgetragen werden. Für wahr wird das gehalten, was im Gericht mittels Schwüren und Eiden und unter der Beachtung aller vom Rechtsbrauch vorgeschriebenen Prozeduren bewiesen wird. Den Schwüren, Ritualen, Gottesurteilen und Zweikämpfen glaubt man mehr als irgendwelchen gegenständlichen Beweisen und Beweisstücken; denn man nimmt an, dass sich im Eid die Wahrheit offenbare und der feierliche Akt nicht entgegen dem Willen Gottes ausgeführt werden könne.
Das frühmittelalterliche Zivilrecht kennt keine freie Verfügung über Grundeigentum. Die einzige Ausnahme bilden für lange Zeit die Seelgerätstiftungen, also die Abgabe von Grundbesitz an die Kirche, die dem Stifter als gutes Werk zum Heile seiner Seele angerechnet werden sollen. Grundsätzlich jedoch gehört ein Grundstück zum Gesamtgut eines Personenverbandes. Es wird als Teil der Lebensgrundlage einer Sippe betrachtet und nicht als verhandelbarer Vermögenswert.41
Man muss davon ausgehen, dass Ehen in der Regel von Verwandtschaftsgruppen arrangiert werden. Denn die auf Verwandtschaft beruhenden Strukturen sind im Frühmittelalter die bedeutendsten soziale Faktoren. Im Eherecht des Frühmittelalters gibt es aber auch die so genannte Konsensehe. Doch dürfte es sich in der Regel um einen Sippenkonsens handeln, nicht um einen Konsens der einzelnen Brautleute.
»Nach den verbreiteten Vorstellungen ist das Recht ›ein Stück der Weltordnung‹ und ebenso ewig und nicht zu beseitigen wie auch die Welt selbst. Die Welt ist nicht denkbar ohne Gesetz, sei es die Welt der Natur oder die Welt der Menschen. Das Recht ist die Grundlage der gesamten menschlichen Gesellschaft, auf ihm bauen die Beziehungen zwischen den Menschen auf: ›Wo die Gesellschaft ist, dort ist auch das Recht‹ (ubi societas, ibi jus). Jede Art von Lebewesen und sogar die Dinge haben ihr eigenes Recht – dies ist eine obligatorische Eigenschaft jeder beliebigen göttlichen Schöpfung (daher konnte nicht nur einem Menschen, sondern auch einem Tier und sogar einem unbelebten Gegenstand die Verantwortung für ein Vergehen zugeschrieben werden). … Da Gott als die Quelle des Rechts galt, folgte daraus, dass das Recht nicht ungerecht oder schlecht sein kann; es ist das Gute und das Wohl im tiefsten Sinne des Wortes. Recht und Gerechtigkeit sind Synonyme.«42
Wenn ein König den Thron betritt, legt er gleichzeitig dem Recht den Eid ab. Das Frühmittelalter kennt keinerlei besonderes Staatsrecht. Der Herrscher muss die Gewohnheit achten und in Übereinstimmung mit ihr regieren. Wenn er das Gesetz verletzt, müssen sich die Untergebenen nicht der Ungerechtigkeit unterordnen. Eine Rechtsverletzung vonseiten des Herrschers nimmt diesem die gesetzlichen Machtgrundlagen und befreit die Untergebenen von dem Eid, den sie ihm geleistet haben. Die Untergebenen sind verpflichtet, das Recht zu verteidigen, auch gegenüber dem Herrscher, der es verletzt. Die Pflicht, das Recht zu wahren, entsteht nicht aus dem Vertrag, sondern aus der Vorstellung von der universellen Kraft des Rechts, der alle untergeordnet sind.43
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.